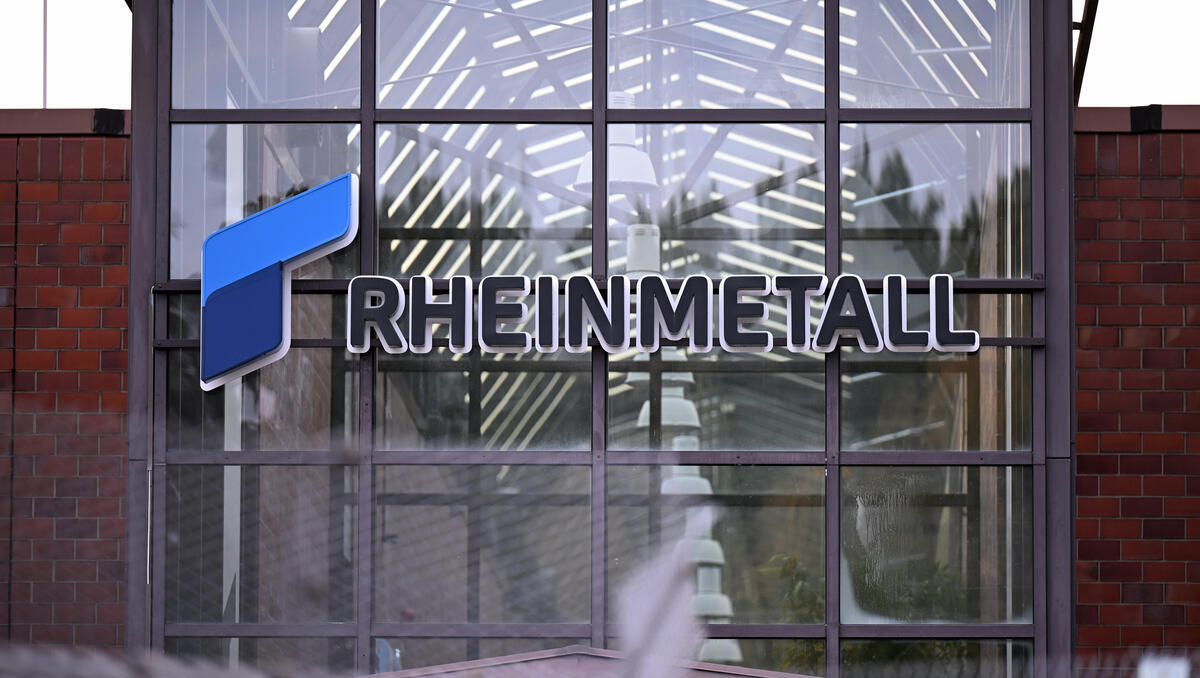Lesen Sie hier die Fortsetzung der Analyse über das Ende des Wachstums der einflussreichen Ökonomin Dambisa Moyo:
4. Monopolisierung und Marktkonzentration
Eine vierte wichtige Wachstumsbarriere ergibt sich aus der Steuer- und Regulierungspolitik. Hier gibt es eine zunehmende Tendenz, der Marktkonzentration zu begegnen, indem man Unternehmen zur Aufspaltung zwingt. Dieser Druck hat bereits in vielen Sektoren ungewollt Oligopole und Monopole hervorgebracht. Im Laufe der Zeit ist es dazu gekommen, dass einige wenige Unternehmen – manche das Produkt von Fusionen, andere wachstumsbedingte natürliche Monopole – die Energie-, Pharma-, Airline- und Technologiesektoren dominieren.
Die fünf größten US-Technologieunternehmen dominieren nicht nur ihren eigenen Sektor; sie repräsentieren zudem 20 Prozent des gesamten Aktienmarktes. Diese Konzentration der Marktmacht in den Händen einiger weniger Unternehmen hat sich zu einer Einladung zu Steuererhöhungen und einer verschärften Überprüfung durch Regulierungsbehörden entwickelt, die den führenden Wachstumsmotoren der Volkswirtschaft die Dynamik nehmen könnten.
5. Deglobalisierung
Fünftens schließlich dürfte die postpandemische Ära eine Zeit beschleunigter Deglobalisierung sein, da sich die Tendenzen hin zum Protektionismus weiter verfestigen werden. Diese Nullsummenpolitik spiegelt umfassende Herausforderungen für die liberale internationale Ordnung wider. Die Regierungen greifen – teils in Reaktion auf den populistischen Druck von Arbeitnehmern und anderen Interessengruppen – zunehmend ein, um heimische Industrien zu verteidigen: En erkennbarer Anstieg des Protektionismus ist zu verzeichnen (zu beobachten beispielsweise in dem eskalierenden chinesisch-amerikanischen Handels- und Technologiekonflikt).
Gegenwärtig sind alle fünf Säulen der Globalisierung akut bedroht: Handel, Kapitalflüsse, Einwanderung, die Verbreitung von Ideen und die multilateralen Institutionen. Die Welthandelsorganisation meldet, dass Einfuhrzölle und Quoten für Waren und Dienstleistungen immer häufiger Verwendung finden und dass die Gesamtwachstumsrate beim Handel gefallen ist.
Schlimmer noch: Handelsvereinbarungen werden zersplitterter, da viele Länder statt auf globale und regionale Verträge auf bilaterale Verhandlungen setzen. Dies war eindeutig US-Präsident Donald Trumps bevorzugte Strategie gegenüber Südkorea, Mexiko und anderen Ländern, und es ist inzwischen auch der Standardansatz Großbritanniens. So unterhält das Land, nachdem es Anfang des Jahres offiziell aus der EU ausgetreten ist, bilaterale Handelsverhandlungen sowohl mit den USA als auch mit Japan.
In ähnlicher Weise stehen die globalen Kapitalflüsse unter zunehmendem Druck. Der DHL Global Connected Index, der ein umfassendes aktuelles Bild des Zustands der Globalisierung bietet, wurde 2018 durch niedrigere Kapitalflüsse nach unten gezogen – insbesondere sinkende ausländische Direktinvestitionen. Tatsächlich sind die weltweiten ausländischen Direktinvestitionen inzwischen zwei Jahre in Folge gefallen, und zwar von zwei Billionen Dollar im Jahr 2016 auf 1,3 Billionen Dollar im Jahr 2018. Darüber hinaus stehen eine ganze Reihe von Regierungen, darunter viele in Schwellenmärkten, unter zunehmendem Druck, Kapital zu schützen und zu bewahren, und haben daher mit der Einführung von Kapitalkontrollen reagiert.
Nun, da die Welt unter COVID-19 taumelt, sind die Kapitalflüsse noch weiter gesunken. Im März und April wurden laut dem Institute of International Finance mehr als 100 Milliarden Dollar aus Schwellenmarktanleihen und -kapitalbeteiligungen abgezogen. Und laut dem Pew Research Center wird die Pandemie die weltweiten Überweisungen von Migranten in ihre Heimatländer – die tendenziell von den reichen in die armen Länder fließen – in diesem Jahr um 20 Prozent reduzieren. Durch diesen Rückgang der internationalen Kapitalflüsse wird es für Kreditnehmer schwieriger, auf Dollar lautende Schulden zurückzuzahlen, und für Staaten wird es schwieriger, Kapital anzulocken, um Investitionen und Wachstum zu finanzieren.
Auch die Verbreitung von Ideen ist gefährdet. Eine wichtige sich abzeichnende Bedrohung ist hier der Aufstieg des „Splinternets“. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts könnte sich das globale Internet in konkurrierende, von China beziehungsweise den USA angeführte technologische Sphären aufspalten. Eine derartige Fragmentierung – von Daten, Plattformen und Protokollen – würde die globalen Lieferketten weiter destabilisieren und den pandemiebedingten wirtschaftlichen Schaden noch erhöhen.
Eine letzte Form der Deglobalisierung schließlich ist die Abkehr vom Multilateralismus im weiteren Sinne. Da einige Länder (namentlich die USA) aktiv die globalen Institutionen untergraben, wird es zunehmend schwierig, neue Institutionen ins Leben zu rufen, die imstande sind, die drängendsten heutigen Probleme zu bekämpfen – vom Klimawandel bis hin zur Entschleunigung des Handelswachstums. Dem Beispiel der Großmächte folgend bereiten sich immer mehr Länder darauf vor, auf eigene Faust engere nationale Agenden zu verfolgen.
Die Lehren der Geschichte
Die Geschichte gibt uns möglicherweise einige Hinweise, in welche Richtung wir uns bewegen. Amerikas Gilded Age, das Goldene Zeitalter (1870-1910) war eine Phase robusten Wirtschaftswachstums, starker Konzerne und der Globalisierung, aber auch der Monopole, Oligopole und zunehmender Einkommensungleichheit. Ihm folgten unmittelbar der Erste Weltkrieg und dann die Spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 mindestens 50 Millionen Menschen das Leben kostete.
Die nächste große globale Krise waren der Börsenkrach von 1929 und die Große Depression. Diese Krise leitete eine neue Ära ein, in der die Rolle des Staates wuchs und er größeren Einfluss auf die Wirtschaft nahm. Eine vom Smoot-Hawley-Zollgesetz des Jahres 1930 ausgelöste Welle des Protektionismus führte zu einem Einbruch beim Welthandel. Der Sozialstaat wurde in vielen westlichen Ländern deutlich ausgeweitet, und Kartellgesetze etablierten sich. Die nächste goldene Wachstumsphase sollte erst 20 Jahre später einsetzen und war weitgehend durch den Wiederaufbau nach dem Krieg bedingt.
Heute steuert die Weltwirtschaft auf eine Phase zu, in der der Staat eine sogar noch größere Rolle spielt. Die Politiker stehen unter wachsendem Druck, die Regulierung auszuweiten, die Steuern zu erhöhen und dort, wo die Konzentration zu stark zugenommen hat, Unternehmen und Branchen aufzuspalten. Die globale Architektur, die seit 75 Jahren den internationalen Handel und das internationale Finanzwesen stützt, ist ins Taumeln geraten.
Am besorgniserregendsten ist, dass das Zusammenspiel dieser Faktoren so gut wie garantiert, dass wir auf eine lange Phase blutleeren Wirtschaftswachstums zusteuern. Die Weltwirtschaft war schon vor dem Ausbruch der Pandemie in schlechtem Zustand. Viele entwickelte und sich entwickelnde Regionen wuchsen kaum oder gar nicht, und manche waren bereits im Schrumpfen begriffen.
Das deutsche BIP-Wachstum fiel 2019 auf ein Sechs-Jahres-Tief von 0,6 Prozent und lag im vierten Quartal nahezu bei null. Die deutsche Wirtschaftsentwicklung war symptomatisch für die allgemeine Abschwächung der EU-Wirtschaft 2019: Das Wachstum verlangsamte sich auf 1,5 Prozent (nach 2,1 Prozent im Vorjahr) und auf bloße 0,1 Prozent im vierten Quartal. Und viele der weltgrößten Schwellenvolkswirtschaften – wie Brasilien, Russland und Südafrika – erreichen noch nicht einmal dieses Wachstumsniveau. Im Juni prognostizierte der IWF für das laufende Jahr eine globale Kontraktion von fast fünf Prozent.
Die Bedeutung dieser Zahlen wird deutlich, wenn man bedenkt, dass eine Volkswirtschaft um jährlich mindestens drei Prozent wachsen muss, um ihr Pro-Kopf-Einkommen innerhalb einer Generation (rund 24 Jahre) zu verdoppeln. Für arme Volkswirtschaften mit einem viel niedrigen wirtschaftlichen Ausgangswert liegt die für eine echte Verringerung der Armut erforderliche Mindestwachstumsrate noch viel höher.
Zusätzlich zu dem dürftigen Wirtschaftswachstum kämpfte die Weltwirtschaft schon vor der Pandemie mit enormer Staatsverschuldung und hohen Haushaltsdefiziten, die sie im Gefolge der Finanzkrise von 2008 angehäuft hatte. Auch schienen weitere Faktoren eine ohnehin schon schlechte Situation noch zu verschlimmern. Hierzu gehörten die Bedrohung der Arbeitsplätze durch die Technologie, eine ungünstige demografische Entwicklung (in Bezug auf Bevölkerungsgröße und -alter sowie das Qualifikationsniveau der Arbeitnehmer), knappe Ressourcen und Umwelt- und Klimaprobleme sowie die sinkende Produktivität.
Darüber hinaus gab es zunehmende Befürchtungen, dass Geld- und Fiskalpolitik ihre Wirkungskraft eingebüßt hätten. Dies bewegte die Notenbanken in den USA, Europa und Japan dazu, die Zinsen immer weiter zu senken und sogar Negativzinsen einzuführen. Zugleich legen die Erfahrungen eines Vierteljahrhunderts aus hartnäckig wachstumsschwachen Ländern wie Japan nahe, dass die Fiskalpolitik ein zu stumpfes Instrument ist, um das Wachstum nachhaltig anzukurbeln.
Keine dieser Bedrohungen für die Weltwirtschaft ist verschwunden, und jetzt verschlimmert und verschärft COVID-19 sie alle. Es hat die großen bereits bestehenden Risiken erhöht und weitere Wachstumsbarrieren für das kommende Jahrzehnt errichtet. Leider steht die Weltwirtschaft nun vor einem langen wirtschaftlichen Abschwung, egal, wie schnell die Pandemie unter Kontrolle gebracht wird.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Dambisa Moyo hat in Oxford promoviert und mehrere Bestseller verfasst, unter anderem: „Am Rande des Chaos: Warum es in der Demokratie kein Wachstum gibt – und was man dagegen tun kann.“ Im Jahr 2009 nahm das Time Magazine die Ökonomin in seine jährlich erscheinende Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt auf.
Copyright: Project Syndicate, 2020.
www.project-syndicate.org