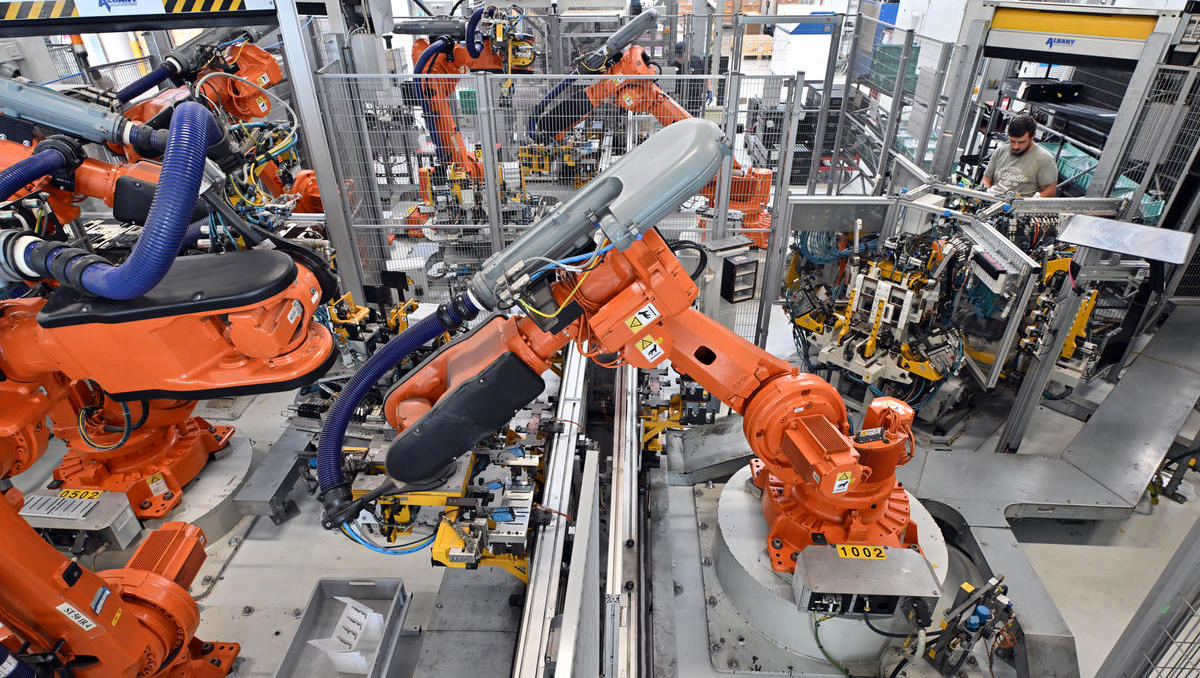Donald Trump ist ein Präsident in prominenter, aber schlechter Gesellschaft. Wie auch andere große und kleine(re) „Herrscher“ ist er von der Droge Macht abhängig. Russlands scheindemokratischer Zar Wladimir Putin hat sich durch eine neue Verfassung eine Verlängerung seiner ohnehin schon zwei Jahrzehnte dauernden Regierung gesichert. Chinas allmächtiger Potentat Xi hat sich von seinen in ständiger Angst vor dem nächsten Korruptionsprozess zitternden Parteigenossen auf Lebenszeit bestätigen lassen. Und Donald Trump hat versucht, die US-amerikanische Demokratie zu sprengen, um weiter im Weißen Haus bleiben zu können. Als sich Donnerstag zeigte, dass alle seine Versuche fehlgeschlagen waren, gab er eine Erklärung ab, die in etwa zum Ausdruck brachte: „Man wird´s doch noch versuchen dürfen!“
Trumps unmissverständliche Aufruf zur Gewalt
Trump rief vor Beginn der Parlamentssitzung, bei der die Wahl des Demokraten Joe Biden zum Präsidenten angesetzt war, seinen Anhängern zu: „Sie haben uns die Wahl gestohlen. Mit Schwäche holen wir sie uns nicht zurück, nur mit Kraft!“ Die Botschaft wurde von einer radikalen Gruppe seiner Anhänger als Aufruf zum Sturm auf den Parlaments-Sitz, das Capitol, interpretiert. Die Abgeordneten beider Häuser – Senat und Repräsentantenhaus - mussten sich im Keller verstecken, während die Putschisten in Sitzungssälen und Büros randalierten. Nach längerem Schweigen verkündete Trump in einer Video-Botschaft, er habe Verständnis für die Aktion und liebe die Tobenden, aber es sei jetzt an der Zeit, nach Hause zu gehen. Erst als die Polizei das Gebäude räumte und die draußen stehenden Demonstranten zurückdrängte, konnte das Parlament seine Sitzung fortsetzen und Bidens Wahl bestätigen.
Eine Bestimmung aus den Zeiten des Wilden Westens als juristische Waffe
Allerdings nur, nachdem ein weiterer trickreicher Versuch Trumps abgeschmettert worden war: In der Verfassung ist die Möglichkeit vorgesehen, dass die Abgeordneten das Wahlergebnis eines Staates aussetzen und überprüfen können. Diese Bestimmung stammt aus der Zeit ohne Telefon, ohne Technik, mit unsicheren Transportwegen und Wild-West-Zuständen in manchen Teilen des Landes. Mittlerweile befinden wir uns jedoch im 21. Jahrhundert, die Zeiten von Cowboys und Indianern sind lange vorbei – eigentlich bräuchte es diesen Paragrafen gar nicht mehr. Fest steht: Trump hat mit seiner Behauptung, es habe ein gigantischer Wahlbetrug stattgefunden, bereits zahlreiche Neuzählungen erzwungen und die Gerichte bis hinauf zum Höchstgericht beschäftigt – mit dem Ergebnis, dass er überall scheiterte. Die Wahl wurde somit häufiger als je zuvor geprüft, sodass die Forderung nach einer nochmaligen Kontrolle durch das Parlament eigentlich völlig überflüssig war.
Die Angst der Republikaner vor den neuen Amerikanern
Dennoch haben einige Republikaner die verfassungsrechtliche Möglichkeit genutzt, um die Bestätigung Bidens zu sabotieren. Unter dem Eindruck des Überfalls auf das Capitol gaben zwar einige diese ihre ursprüngliche Absicht auf, doch nicht alle. Allerdings wurden ihre Anträge mit überwältigender Mehrheit (also auch mit einer Vielzahl von republikanischen Stimmen) sowohl im Senat und im Repräsentantenhaus abgelehnt.
Warum der Versuch, Trump im Weißen Haus zu halten? Dies ist der Grund:
Die erfolgreichen Amerikaner zieht es seit Jahren an die West- und Ostküste, wo die Demokraten deutlich dominieren – und auch dann noch gewinnen, wenn einige oder auch viele der Neuzugezogenen republikanisch wählen. In der konservativen Mitte des Landes, wo Trump bereits 2016 stark gepunktet hat, nimmt die Bevölkerung dagegen kontinuierlich ab. Je mehr Einwohner die 50 Einzelstaaten haben, desto mehr Wahlmänner stellen sie bei den Präsidentschaftswahlen. Diese Entwicklung fand bei der 2020er Wahl erst einen beschränkten Niederschlag, da die Volkszählung nur alle zehn Jahre stattfindet. Derzeit befindet sich aber eine neue Volkszählung in der Endphase, sodass bei den kommenden Wahlen sich die Situation für die Demokraten sehr günstig darstellt: Wäre Trump im Weißen Haus geblieben, wären bei der nächsten Wahl (mehr als zwei Amtszeiten darf ein Präsident nicht regieren, weshalb Trump 2024 das Weiße Haus auf jeden Fall hätte verlassen müssen) immerhin zwei Nicht-Präsidenten gegeneinander angetreten. So aber werden entweder Joe Biden oder – wenn dieser aufgrund seines Alters oder aus gesundheitlichen Gründen schon während seiner ersten Amtszeit zurücktritt – Kamala Harris in den Ring steigen. Amtierende Präsidenten haben immer den Amtsbonus – dieser zusammen mit den die Demokraten begünstigenden demografischen Verhältnissen: Die Chancen für die Republikaner im Jahr 2024 stehen sehr schlecht.
Das konservative, angelsächsische, weiße Amerika gegen die neue bunte Vielfalt
Noch einem wachsenden Problem sehen sich die Republikaner gegenüber. Tatsache ist: Sie werden primär von Weißen gewählt, vor allem den sogenannten WASPs („white anglo-saxon protestants“). Doch der Anteil dieser Gruppe an der Gesamtbevölkerung sinkt kontinuierlich. Der Anteil der Personen mit schwarzafrikanischer oder spanischer Abstammung wächst dagegen, sodass die „Weißen“ in Kürze unter die 50-Prozent-Marke sinken werden. Auch „protestant“ ist ein heikles Thema: Man schätzt (offizielle Erhebungen gibt es nicht), dass etwas mehr als zwei Fünftel (43 Prozent) der Bevölkerung sich noch dieser Religion verbunden fühlen. An zweiter Stelle rangieren Personen ohne Bekenntnis, an dritter die Katholiken (die tendenziell eher demokratisch wählen). Summa summarum: Die demografische Entwicklung kommt durchgehend den Demokraten zugute, die Republikaner haben das Nachsehen.
Das Aufstreben der Schwarzen und der Latinos nährt einen neuen Rassenhass
Die demografische Entwicklung ist darüber hinaus der Nährboden für gefährliche Entwicklungen. Die Verlierer der harten Leistungsgesellschaft (und eine solche sind die USA viel mehr als die europäischen Länder, wo die sozialstaatlichen Leistungen viel ausgeprägter sind); diejenigen, die nicht die Qualifikation haben, um zu dem besseren Job in Los Angeles oder New York zu übersiedeln: Sie brauchen ein Selbstwertgefühl. Und da bietet sich die Idee der Überlegenheit der weißen Rasse als Lösung an, zumal ja auch die Spitzen der US-amerikanischen Gesellschaft sich gerne als WASP definieren. Auf dieser Basis ist eine neue Verachtung der Schwarzen und auch der Latinos entstanden, die aber nicht als Verhältnis zwischen Herren und Sklaven gelebt werden kann wie im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, sondern sich als beinharter Wettbewerb in allen Lebenslagen erweist. In diesem Kontext sind auch die Übergriffe weißer Polizisten gegen Schwarzen zu sehen. Bemerkenswert: Das US-Parlament wurde von Weißen gestürmt, und die Polizei drängte die Randalierer ohne Brutalität und ohne Tränengas langsam zurück, also ganz anders als dies bei schwarzen Demonstrationen zu beobachten ist (wobei man anmerken muss, dass die Aktion mit fünf Toten endete).
Der Frust der Verlierer sorgt weltweit für politischen Zündstoff
Die Szenen, die seit Mittwoch weltweit im TV zu sehen sind, dürfen allerdings nicht als rein amerikanisches Phänomen eingestuft werden. Überall droht die Unzufriedenheit großer Teile der Bevölkerung aggressive Ausschreitungen zu begünstigen. Zwar wird argumentiert, dass die soziale Absicherung in den USA geringer ist als etwa in Europa, doch trifft dieser Faktor nicht den Kern des Problems, zumal der Anteil der Armen diesseits und jenseits des Atlantiks etwa gleich groß ist. Entscheidend ist vielmehr, dass sich die Bedingungen in der modernen Wirtschaft ständig ändern und zu immer neuen Herausforderungen führen. Man kann also kaum „etwas erreichen“, eine „Situation“ erobern, die nicht morgen oder übermorgen in Frage gestellt wird. Wenn im Zentrum der amerikanischen Demokratie, im Capitol, der Vandalismus ausbricht, dann sollten weltweit alle Politiker die Botschaft verstehen: Wenn die Spannungen, wenn die Differenzen in einer Gesellschaft zu groß werden, dann werden Sündenböcke gesucht: Schwarze, Latinos, Ausländer, Juden, Muslime, Reiche, der jeweilige politische Gegner, wer auch immer. Was das bedeuten kann, das hat Frankreich mit den monatelangen Randalen der „Gelbwesten“ kennengelernt. Gelingt die Versöhnung der Gesellschaft nicht, dann droht allen ein Blutbad.
Joe Biden und Kamala Harris können die US-Gesellschaft einigen – oder?
Die Erstürmung des Capitols hat allgemein Entsetzen ausgelöst, auch unter vielen Republikanern, doch ist fraglich, ob dies genügt, um in der US-amerikanischen Gesellschaft einen Abbau der Gegensätze und Spannungen in Gang zu setzen. Das neue Präsidenten-Team hätte zwar durchaus die Voraussetzungen: Joe Biden ist weiß und irischer Abstimmung, kann also als „echter“ Amerikaner gelten, ist allerdings katholisch, und die Iren standen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in der Hierarchie weit unten (unter ihnen nur noch Italiener, Osteuropäer und Nicht-Weiße). Kamala Harris hat afrikanische und indische Wurzeln und blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Generalstaatsanwältin von Kalifornien und als Senatorin zurück, repräsentiert somit das aufstrebende neue Amerika. Harris ist darüber hinaus Baptistin, also Mitglied der größten protestantischen Gemeinde des Landes – die aber die eher nicht so gut situierten Protestanten repräsentiert (Harris stellt da natürlich eine Ausnahme dar).
Ob dieser bunte Bogen der beiden Personen genügen wird, ist allerdings fraglich. Sie stehen für strengere Waffengesetze, den Ausbau der sozialen Krankenversicherung, die Abtreibungs-Freiheit, die endgültige Abschaffung der Todesstrafe sowie für eine internationale Politik der Kooperation, befinden sich folglich im diametralen Gegensatz zur Politik der Republikaner – und zu den Werten des konservativen Teils der Bevölkerung. Konflikte sind hier vorprogrammiert – die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft könnte noch lange andauern, wird in absehbarer Zeit vielleicht überhaupt nicht aufgehoben werden können.
Auf der anderen Seite befinden sich Binden und Harris in einer glücklichen Lage: Sie haben nicht nur die Präsidentschaft gewonnen, die Demokraten haben auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus verteidigt und die Stimmengleichheit mit den Republikanern im Senat erobert. Stimmengleichheit im Senat gibt dem Vorsitzenden die Möglichkeit, mitzustimmen und für eine Mehrheit zu sorgen. Vorsitzender des Senats ist stets der Vizepräsident, folglich Kamala Harris, die künftig eine zentrale Rolle in der US-Politik innehaben wird.
Bis zur Amtseinführung am 20. Jänner ist Donald Trump noch Präsident, und die spannende Frage lautet jetzt: Was geschieht noch alles, bis der Trickreiche und seine Anhänger zur Kenntnis nehmen, dass die Ära Trump zu Ende ist?