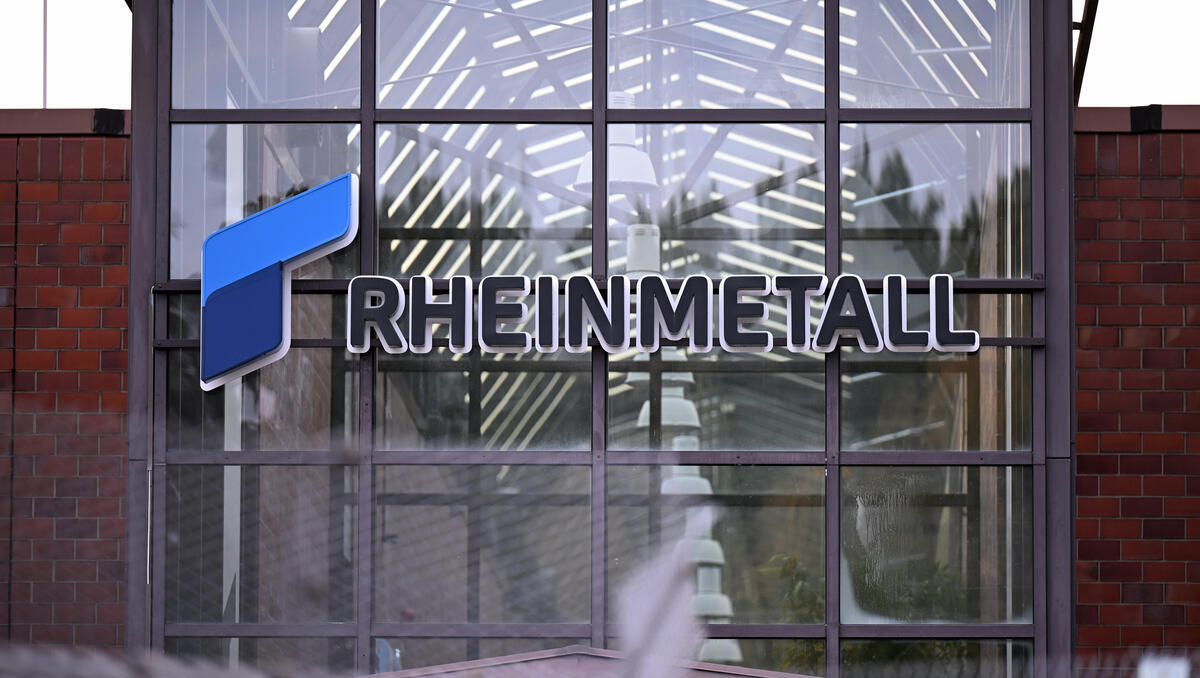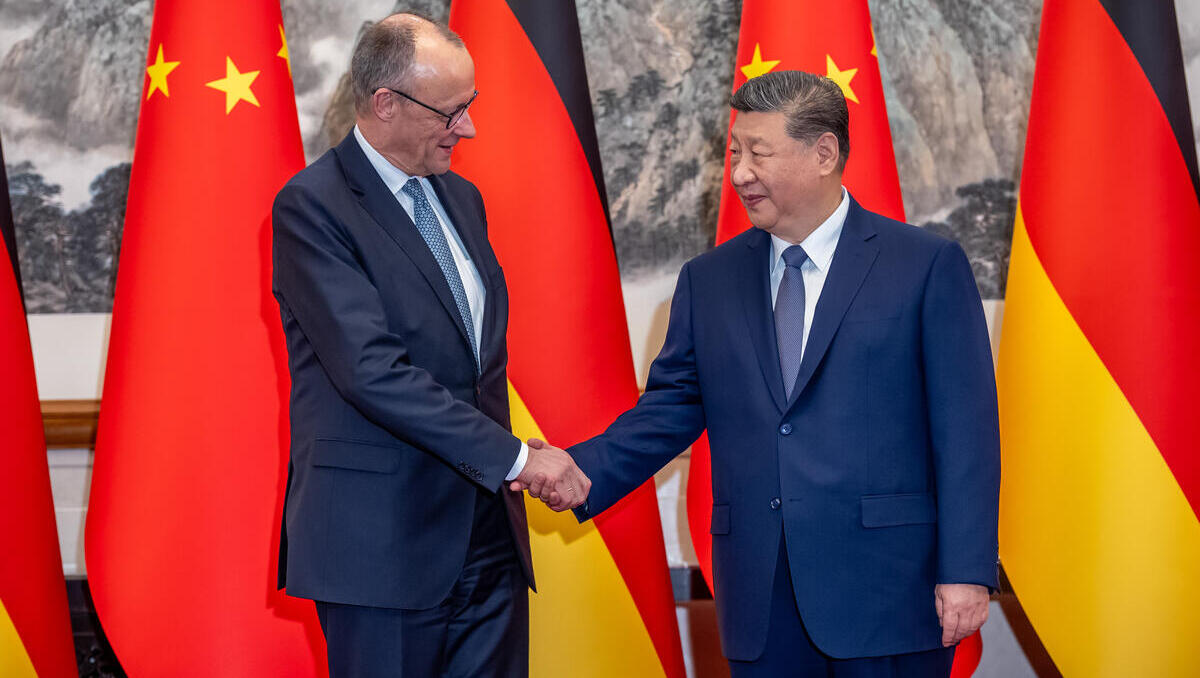Japan steckt in großen Schwierigkeiten – und zwar schon seit über dreißig Jahren: Der Inselstaat kämpft mit einer hartnäckigen Schwäche seiner Wirtschaft, einer Schwäche, die mit der Aufnahme von aberwitzig vielen Milliarden an Staatsschulden nicht zu beseitigen war, nicht zu beseitigen ist und nicht zu beseitigen sein wird. Eine erschreckende Zahl: Die Schuldenquote beträgt mittlerweile mehr als 250 Prozent des BIP.
Inwiefern ist das für Europa von Relevanz? Nicht wenige behaupten, dass Japan nicht mit Europa oder den USA vergleichbar sei, wir also aus den japanischen Erfahrungen wenig bis nichts lernen können. Mit dieser Einstellung verzichten wir allerdings darauf, von den Erfahrungen, die eine hoch entwickelte marktwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft über die Dauer von Jahrzehnten gemacht hat, zu lernen. Wir verzichten darauf, ein Verständnis von Zusammenhängen zu erlangen, das zum Verständnis der aktuellen Entwicklung im Westen in hohem Maße beitragen könnte. Fakt ist: Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, bietet geradezu einen Katalog wirtschaftspolitischer Misserfolge – wir sollten diesen Katalog genau studieren.
Die Aufnahme von Staatsschulden ist manchmal sinnvoll, ist aber kein Allheilmittel
In den vergangenen Jahrzehnten setzte Japan verstärkt auf ein vermeintlich bewährtes Mittel aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen: Der Staat ersetzte in Schwächeperioden die fehlende Nachfrage durch umfangreiche Aufträge, die so in Gang gebrachten Investitionen sorgten für Beschäftigung, verbesserten die Infrastruktur und überbrückten auf diese Weise die Zeit bis zur Erholung der privaten Nachfrage. Fast alle Grundpfeiler dieser Strategie waren stimmig und sorgten dafür, dass die öffentlichen Einrichtungen in Japan bis zum heutigen Tag bestens ausgestattet sind - nur das eine, das entscheidende Element, ist nicht stimmig. Was dieses Element ist? Die private Nachfrage, die sich einfach nicht einstellen will. Der neue, seit Oktober amtierende Premierminister Fumio Kishida will das Problem jetzt sogar mit der Verteilung von Subventionen direkt an Privatpersonen bekämpfen, obwohl erfahrungsgemäß Japaner zusätzliches Geld nicht zum Konsumieren, sondern zu immer höheren Sparleistungen nutzen.
Die Sparsamkeit ist allerdings nur ein Faktor. In einer entwickelten Volkswirtschaft ist die Gesamtheit der Nachfrage aus privatem Konsum, Investitionen der Unternehmen sowie Ausgaben der öffentlichen Stellen generell hoch. Da wirken zusätzliche staatliche Investitionen nicht so stark wie nach einem verheerenden Krieg oder während einer katastrophalen Wirtschaftskrise wie beispielsweise der Großen Depression der 30er Jahre. Auf diese Problematik stoßen gerade in diesen Tagen auch die großen Investitionsprogramme der USA und der EU.
Niedrige Zinsen fördern den wirtschaftlichen Aufschwung, aber nicht auf Dauer
Auch ein anderes theoretisch bewährtes Rezept zur Förderung der Wirtschaft wird in Japan konsequent eingesetzt – die Niedrigzinspolitik. Seit zwanzig Jahren liegt der Refinanzierungssatz der Nationalbank bei null Prozent, seit einigen Jahren sogar bei -0,1 Prozent. Das heißt, ein Geldhaus, das Geld bei der Bank of Japan hält, muss Strafzinsen zahlen.
Aufschlussreich ist der Blick in die Phase von vor 1990, also die Zeit direkt vor dem Beginn der bis heute anhaltenden Flaute. Damals, in den siebziger und achtziger Jahren, erlebte Japan einen spektakulären Aufschwung und galt einige Zeit sogar als Motor der Weltwirtschaft. Die Entwicklung und der Einsatz modernster Technologien sorgten für spektakuläre Erfolge im In- und Ausland. Gefördert wurde dieser Erfolg durch die Zinspolitik. Nachdem die Notenbank die Zinsen im Gefolge der Freigabe der Währungskurse 1972 und des ersten Ölpreisschocks 1973 stark angehoben hatte, begann Ende der siebziger Jahre eine Periode kontinuierlicher Zinssenkungen bis auf 2,5 Prozent, die den Unternehmungen die Finanzierung der Expansion erleichterte.
Der Erfolg ließ die Aktienkurse ansteigen und die Hausse zog viele Interessenten an. Aber: Es kam der Punkt, als die positiven Effekte der niedrigen Zinsen nachließen. Da begann der Kauf von Aktien auf Kredit, da setzte der Erwerb von überteuerten Immobilien ein, die mit (zu) günstigen Ausleihungen finanziert wurden.
Zur Illustration: Im Jahr 1987 lag der japanische Aktienindex bei 17.000 Punkten, Ende Dezember 1989 bei fast 39.000 Zählern. Der Index der Immobilienpreise explodierte in dieser Periode von 5.800 auf 20.600 Punkte, also um mehr als das dreieinhalbfache.
Warum dieser historische Rückblick? Weil wir von ihm lernen können. Die aktuelle Entwicklung an den westlichen Börsen, vor allem an der New Yorker Börse, sowie auf den Immobilienmärkten wirkt wie eine Wiederauflage des japanischen Rauschs von vor 35 Jahren.
1989 erhöhte die Bank of Japan schrittweise die Leitzinsen, um die ungesunde Entwicklung zu korrigieren. Im Dezember 1989 war man bei einem Wert von 4,5 Prozent angelangt; in der Folge stiegen auch die Zinsen der Kredite, die die Anleger für den Kauf von Aktien und Immobilien aufgenommen hatten. Der Nikkei-Index fiel in den ersten drei Monaten des Jahres 1990 auf 28.000 Punkte, also um knapp 30 Prozent, und erholte sich fünfzehn Jahre nicht, zeitweilig sah man sogar Kurse von unter 9.000 Zählern.
Erst in der jüngsten Vergangenheit zeigt die Tokioter Börse wieder höhere Kurse; der Nikkei bewegt sich nun bei 27.000, immer noch deutlich unter dem Höchstwert von 1989.
Auch die Immobilienpreise sanken rapide. In der Folge waren die Kredite durch den gesunkenen Wert der Aktien und Immobilien nicht mehr gedeckt, mussten aber selbstverständlich dennoch weiter zurückgezahlt werden. Die privaten wie die gewerblichen Kreditnehmer und mit ihnen die Banken gerieten in eine dramatische Krise.
Wenige Kinder, keine Zuwanderung und eine extreme Alterung der Bevölkerung
Die Zinspolitik allein hätte allerdings kaum derart langfristige Auswirkungen gehabt. Aber es kamen noch weitere Probleme hinzu: Viele Unternehmen hatten in der Wachstumsphase ihren Höhepunkt erreicht und konzentrierten sich in Folge des Abschwungs auf Rationalisierungen, die eine höhere Arbeitslosigkeit auslösten. Auch die Exportmärkte reagierten. Ein Beispiel für viele: Mitte der achtziger Jahre überraschten die japanischen Stahlunternehmen ihre US-amerikanischen Konkurrenten aufgrund neuer Techniken mit unschlagbar niedrigen Preisen. In der Folge holten die Amerikaner jedoch auf und der Weltmarkt veränderte sich zu Ungunsten Japans.
Allerdings hatte die Kreativität in Japan keineswegs nachgelassen, wie die anhaltende Erfolgsstory etwa von Toyota oder anderen Firmen beweist. Und so wurden dann die negativen Effekte der Rationalisierungswelle, sprich die Arbeitslosigkeit, schon recht bald durch die steigende Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern ausgeglichen. Es war zu dieser Zeit, als sich eine Schwäche der japanischen Wirtschaft auftat, die bis heute nicht behoben ist: Die Entwicklung vieler Betriebe wurde und wird durch den Mangel an Arbeitskräften gebremst.
Fakt ist: In Japan fehlt der Nachwuchs, die Fertilitätsrate pro Frau liegt bei 1,36 Kindern, wodurch die Gesamtbevölkerung zwangsweise geringer wird. Vor allem aber, und das ist das große Problem, sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter.
Europa weist mit ebenfalls niedrigen Fertilitätsraten von 1,5 Kindern pro Frau eine ähnliche Problematik auf. Allerdings wirkt sich dieser Umstand weniger stark aus, weil in Europa die Einwanderung für einen Ausgleich sorgt.
Das ist in Japan, wo die Zuwanderung systematisch behindert wird, nicht der Fall. Die Regierung betreibt eine restriktive Politik und will zudem nur die Immigration von hochqualifizierten Kräften zulassen. Auch wirkt die Sprache als Barriere. Der verschiedentlich für die EU geforderte und teilweise auch durchgesetzte Einwanderungsstopp erweist sich, wie man in Japan sehen kann, als Eigentor. Das Phänomen ist auch in Großbritannien zu beobachten, wo seit dem Brexit die Arbeitskräfte aus der EU fehlen.
Japaner werden im Schnitt sehr alt; 81,4 Jahre die Männer, 87,5 Jahre die Frauen. Die Belastung der Gesamtwirtschaft durch die Renten ist also besonders hoch, die Dominanz der Alten auffällig. Europa ist von einem solchen Szenario nicht weit entfernt. Auch hier ist die Lebenserwartung gestiegen, und manche Regionen weisen bereits Japan-ähnliche Verhältnisse auf. Die aktuelle Altersstruktur unserer Bevölkerung und die niedrige Geburtenrate zeigen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft mit Japan gleichziehen werden.
Die Konsequenzen des Verzichts auf Wachstum: In Japan kann man sie studieren
Nicht zu überhören ist in Europa der Ruf nach weniger Wachstum. Die Wohlstandsgesellschaft wird von vielen kritisch gesehen. Propagiert wird eine bescheidenere Lebensweise, ganz generell der Verzicht auf Konsum. Zu welchen Konsequenzen eine derartige Orientierung der Volkswirtschaft führt, zeigt die Entwicklung in Japan in den vergangenen Jahrzehnten.
Seit 1992 schwankt die japanische Wachstumsrate um die null-Prozent-Marke. Die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung liegt heute wie damals bei umgerechnet 40.000 Dollar. Die offizielle Inflationsrate ist zwar gering, wobei die Teuerung letztlich aber doch spürbar ist, sodass sich Jahr für Jahr ein Realverlust ergibt. Die Japaner werden also seit Jahren laufend ärmer. Diese Situation verstärkt die ohnehin bestehende Neigung zur Sparsamkeit, wodurch sich ein zusätzlicher Bremseffekt für die Wirtschaft ergibt.
Im Sinne der Wachstumsgegner könnte man argumentieren, dass die Situation doch nicht so kritisch zu sehen sei. Schließlich sind 40.000 Dollar allemal ein respektables Ergebnis. Wenn durch den Mangel an Arbeitskräften kaum Arbeitslosigkeit entsteht (die Arbeitslosenrate liegt bei geringen 2,8 Prozent!), ist auch die soziale Lage der Masse ganz offensichtlich nicht schlecht. Darüber hinaus gießt der Staat Milliarden über das Land, und die hohen Schulden stören offenbar niemanden. Folgt daraus etwa, dass die Gegner des Wachstums Recht haben?
Nein, das tun sie nicht. Das Teuflische an Wirtschaftsentwicklungen ist nämlich der Zeitfaktor. Man kann in einem gesunden Unternehmen jahrelang Fehler machen, und der Betrieb geht trotzdem nicht pleite, bis, ja bis eines Tages alle Schwachstellen plötzlich nicht mehr beherrschbar sind und der Betrieb wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Die Frage lautet dann in der Regel verwundert: „Wieso? Gestern war doch noch alles in Ordnung!“ So kann es auch einem Staat geschehen, und so geschieht es derzeit in Japan.
Bestes Beispiel dafür: Der Rekordhalter auf den internationalen Märkten der siebziger und achtziger Jahre muss sich jetzt mit einem bescheidenen Handelsbilanz-Überschuss begnügen, in manchen Jahren rutscht die außenwirtschaftliche Position sogar ins Minus. Das Fehlen von Innovationen und die verlorene Dynamik zeigt sich hier überdeutlich. Kombiniert mit der schwachen, durch den Spareifer zusätzlich gedrückten inländischen Nachfrage droht die Gefahr, dass die Wirtschaftsleistung weiter schrumpft, der Prozess des Niedergangs an Dynamik gewinnt und der Lebensstandard der Menschen dramatisch sinkt.
Hier wird ein zentraler Aspekt überdeutlich, der in der Wachstumsdiskussion meist untergeht, das heißt, von den Wachstumsgegnern nicht gesehen wird.
Eine Volkswirtschaft besteht stets aus drei Bereichen:
- erstens aus Firmen, die gerade ihren Höhepunkt erreicht haben,
- zweitens aus Firmen, die sich ihrem Untergang nähern,
- und drittens aus Unternehmen, die sich in der Startphase befinden.
Fehlen in einer Volkswirtschaft die neuen, jungen, dynamischen Firmen, dann kommt es zum Zusammenbruch. Denn jene Betriebe, die dem Untergang geweiht sind, scheiden in Kürze aus, und diejenigen, sich die auf ihrem Höhepunkt befinden, befinden sich, wenn sie über diesen Höhepunkt hinaus sind, ebenfalls auf dem absteigenden Ast, ohne dass neue Unternehmen nachrücken würden.
Im Ergebnis kommt es zu einer Wirtschaftskrise, einer, und das darf gar nicht stark genug betont werden, anhaltenden Krise. Es ist dieser Faktor, der immer wieder übersehen wird, der darüber hinaus in der Statistik nicht ausreichend abgebildet wird.
Japan steckt seit Jahrzehnten in einer Deflation - und kein Mittel hilft
Notenbanker weltweit wünschen sich eine Inflationsrate von rund zwei Prozent, nicht mehr und nicht weniger. Auch die Bank of Japan hat dieses Ziel, muss jedoch zur Kenntnis nehmen, dass die Preise stabil bleiben und sogar die Tendenz haben, zu sinken. Auch in Tokyo meint man, dass das Erreichen der magischen zwei Prozent die Probleme entschärfen würden.
- Dann es würde, so lautet die zumindest die Theorie, eine Konjunkturbelebung entstehen, wenn die Verbraucher erst einmal anfangen, sich nicht beim Konsum zurückzuhalten, weil sie nicht mehr auf noch niedrigere Preise bei anhaltender Deflation hoffen.
- Die Theorie besagt auch, dass, wenn der Staat und die Zentralbank Geld in den Markt pumpen, es zur Inflation kommt, weil mit dem Geld die Nachfrage nach Investitionen und Konsumgütern finanziert wird und in der Folge die Preise steigen.
Eine schöne Theorie – doch sie ist grau, das heißt, sie stimmt nicht, genau wie viele andere Überlegungen, die am Schreibtisch im stillen Kämmerlein entstehen. Die Realität, sie sieht nämlich ganz anders aus: Der Konsum ist in hoch entwickelten Volkswirtschaften nur bis zu einem gewissen Grade steigerbar, die Verbraucher stellen sich bei länger anhaltenden Stabilitäts-Perioden auf die Möglichkeiten ein, die ihnen ihr Einkommen bietet. Das heißt, man hat nicht gestern keine Wohnzimmer-Einrichtung und kauft heute eine, weil ein günstiges Kreditangebot ins Haus flattert. Ist zusätzliches Geld verfügbar, dann bemüht man sich um die Anschaffung von Werten wie Aktien, Immobilien, Gold, Uhren, Schmuck, und dafür sind viele auch bereit, sich zu verschulden. Die besonders sichtbare Konsequenz: Die Aktienkurse steigen auf Rekordhöhen.
Solch ein Spareifer und die Flucht in tatsächliche oder vermeintliche Werte sind in allen entwickelten Staaten zu beobachten. Dieses neue Phänomen haben auch die Währungspolitiker in Europa zur Kenntnis nehmen müssen. Das hat zu der skurrilen Situation geführt, dass die Europäische Zentralbank nun versucht, die Banken zu zwingen, mehr Finanzierungen in der Realwirtschaft zu platzieren und weniger Kredite für den Kauf von Wohnungen oder Aktien zu vergeben. Geschieht dies nicht, müssen die Banken Strafzinsen für Depots bei der EZB zahlen. Auch Japan betreibt diese Politik schon lange, allerdings ohne Erfolg.
Fazit: Mit noch so cleveren Tricks lässt sich ein Wirtschaftsaufschwung nicht erzwingen. Es gibt leider nur zwei Faktoren, die eine Konjunktur ankurbeln können – clevere Erfindungen sowie eine optimistische Einstellung der Konsumenten. Beides ist nicht im Versandhandel zu bestellen. Eine Währungsbehörde kann nicht dafür sorgen, dass das Smartphone erfunden wird, ein Staat kann nicht bewirken, dass die Menschen kauffreudig die Shopping-Center stürmen, schon gar nicht, wenn man die Bevölkerung, wie in Japan, in gewissem Umfang aber auch in Deutschland, jahrhundertelang zur Sparsamkeit erzogen hat.