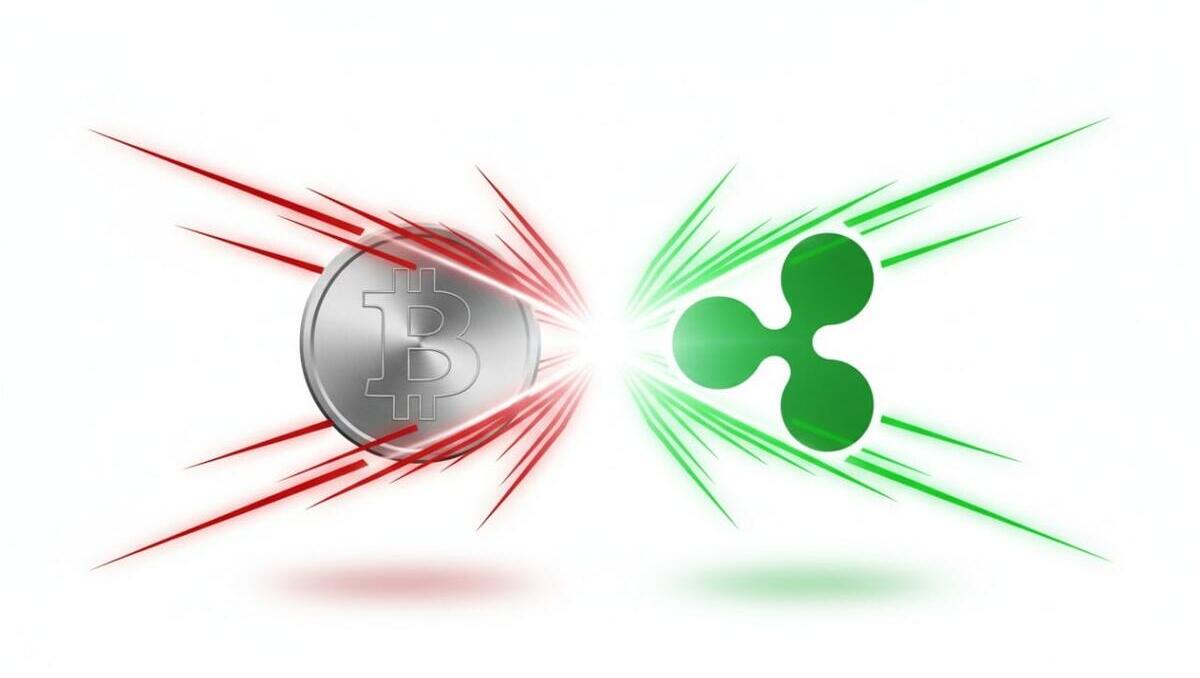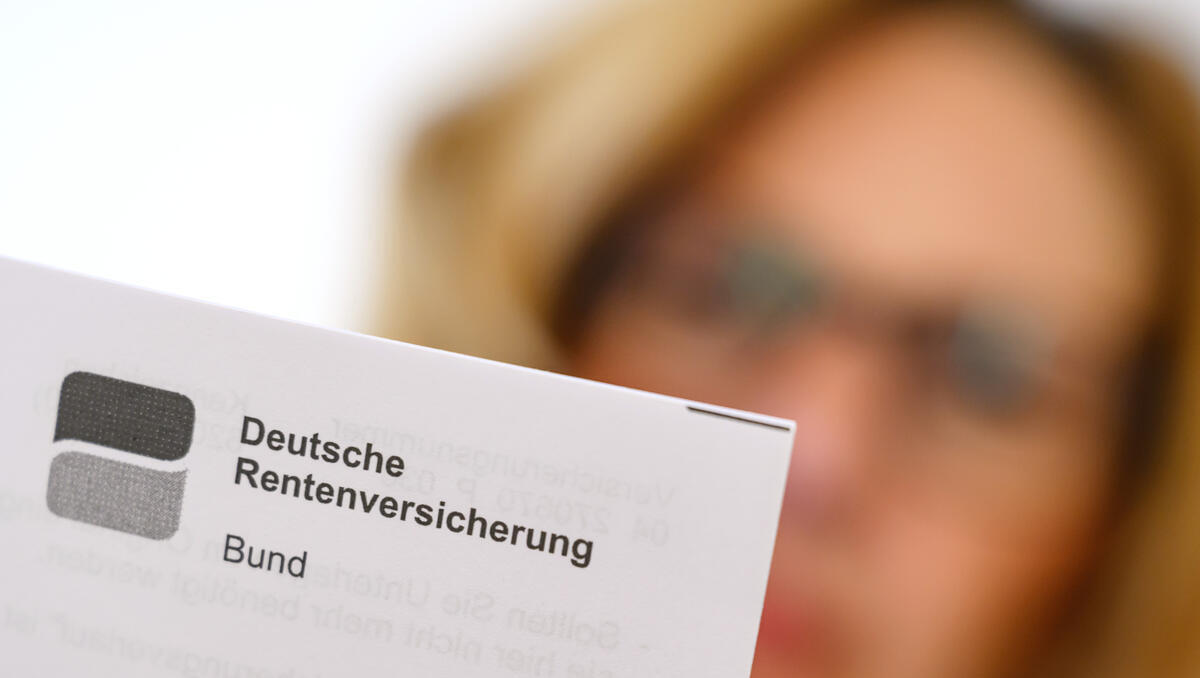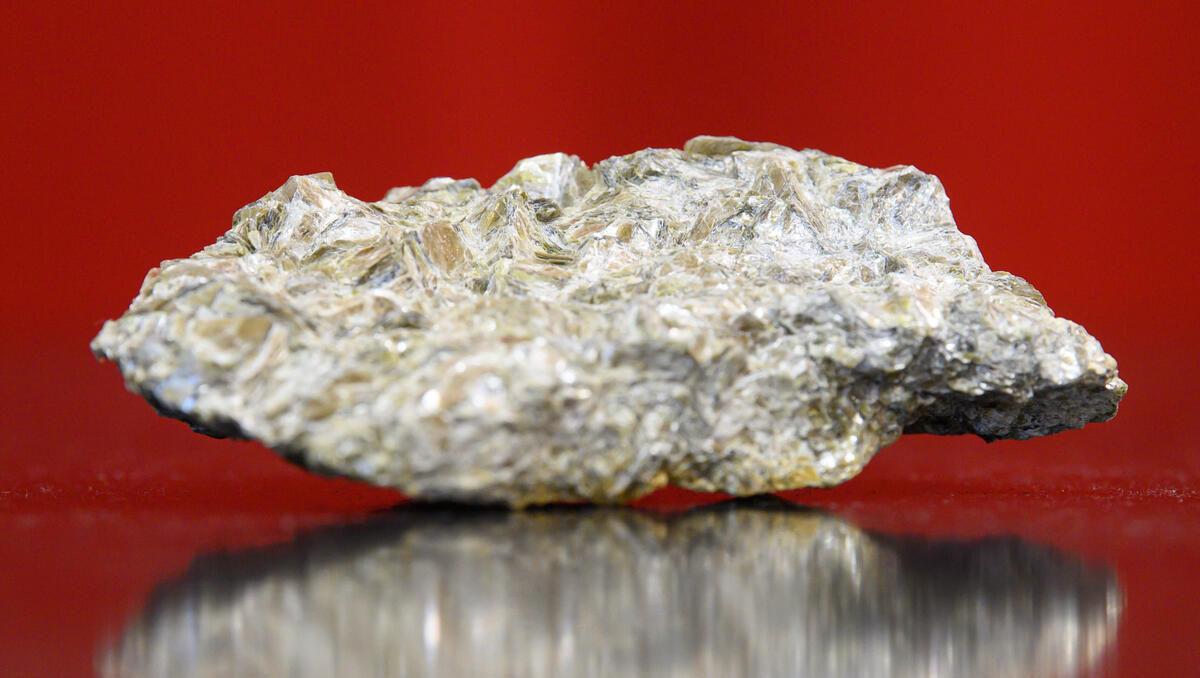Deutsche Wirtschaftsnachrichten: In Subsahara-Afrika leben rund eine Milliarde Menschen auf einer Fläche, die circa dreimal so groß ist wie Australien. Einen solchen Raum kann man natürlich nicht als homogene Einheit betrachten. Können Sie dennoch versuchen, in wenigen Worten zusammenzufassen, wofür dieser Weltteil steht, was ihn ausmacht?
Robert Kappel: Subsahara-Afrika steht heute für Aufbruch und Transformation. Für durchgreifende wirtschaftliche und politische Veränderungen. Es wird Zeit, dass Wirtschaft und Politik hierzulande das endlich begreifen. Sie müssen weg vom Schlagwort „Krisenkontinent“. Weg davon, Afrika immer nur mit Armut, Krieg, politischer Instabilität und Korruption in Zusammenhang zu bringen. Auch wenn das natürlich kaum jemand zugeben würde: Viele betrachten den Kontinent immer noch aus einer kolonialistischen Perspektive, genauer gesagt, aus der Sicht des Postkolonialismus. Das heißt, sie gehen davon aus, dass der Kontinent unserer Unterstützung in Form von Entwicklungshilfe bedarf. Doch dem ist nicht so. Was Afrika benötigt, sind Kooperationen, im wirtschaftlichen, technologischen und wissenschaftlichen Bereich. Ein Verzicht darauf bedeutet nicht nur, dass der Kontinent an der Entfaltung seines Potenzials gehindert wird, sondern auch, dass wir eine große Chance ungenutzt lassen, die sich unserer heimischen Wirtschaft bietet.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Von welcher Chance sprechen Sie? Tatsache ist doch, dass Subsahara-Afrika die ärmste Region der Welt ist und laut Statistik im Jahr 2021 lediglich rund drei Prozent des globalen Bruttosozialprodukts erwirtschaftete, obwohl es die Heimat von rund 14 Prozent der Weltbevölkerung ist.
Robert Kappel: In der Region findet derzeit eine grundlegende Transformation statt: die Verstädterung. Die Demografen erwarten, dass es in 20 Jahren in Afrika rund 100 Millionen-Städte geben wird. Allen voran steht Lagos, das heute schätzungsweise 15 Millionen Einwohner hat - in zwei Jahrzehnten werden es doppelt so viele sein. Urbane Zentren ziehen in Afrika - so wie überall auf der Welt - die Gebildeten an, die Menschen mit Unternehmergeist. In diesen Zentren besteht bereits eine Start-up-Kultur. Es entstehen Banken, Finanzdienstleistungs-Unternehmen, Beratungsgesellschaften. Den meisten Menschen im Westen ist nicht bekannt, dass Afrika schon jetzt eine Mittelschicht hat, die ein gewisses Maß an Kaufkraft ihr Eigen nennt, die über Kompetenzen verfügt, die gut ausgebildet ist. Und die neugierig ist auf die Welt; die ihren Blick also nicht nach innen, sondern nach außen richtet.
In diesen Städten besteht ein gewaltiger Bedarf an Immobilien und an Infrastruktur-Einrichtungen wie einem verlässlichen Elektrizitätsnetz sowie einer funktionierenden Wasserversorgung. Ja, die Entwicklung verläuft in afrikanischen Ländern anders als beispielsweise im südostasiatischen Tigerstaat Vietnam, wo sich eine florierende produzierende Industrie herausgebildet hat: Noch liegt der Fokus in den Metropolen auf Dienstleistungen. Aber auch im Produktionsbereich sind Fortschritte zu verzeichnen, beispielsweise in der Agroindustrie und in der Lebensmittelverarbeitung. So ist beispielsweise die Nachfrage nach afrikanischen Lebensmitteln seitens der Chinesen stark im Steigen begriffen. Auch eine Textil- und eine textilverarbeitende Industrie haben sich bereits etabliert. Insgesamt besteht der Fertigungssektor natürlich primär aus Unternehmen, die technisch wenig komplexe Produkte herstellen - aber der Ausbildungsstand wächst massiv, beispielsweise werden immer mehr Ingenieure ausgebildet.
Wir Deutschen sind immer so stolz auf den Titel Exportweltmeister. Aber wir laufen Gefahr, die Chancen, die Afrika bietet, zu verpassen. Wir müssen endlich anfangen, zu antizipieren, wo sich uns welche Chancen bieten. Besonders beim Mittelstand herrscht noch sehr viel Informationsbedarf.
Eine Branche, die ihre Fühler schon sehr gezielt ausgestreckt hat, ist die Automobil-Industrie. Die Japaner und Chinesen machen es vor, die gehen gezielt in die Märkte hinein. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurden ausrangierte Altautos nach Afrika verschifft. Doch das Umweltbewusstsein nimmt auch dort zu: Die Angehörigen der Mittelschicht wollen keine schrottreife Karre mit defektem Kat, sondern einen Neuwagen. Auch wenn der nicht ganz so groß ist und über so viel Ausstattung verfügt wie derjenige, der in Europa, den USA und teilweise auch in China üblich ist.
Peugeot hat schon angefangen, in Nigeria zu produzieren, VW plant, es den Franzosen nachzumachen. Ähnliche Ideen haben die Wolfsburger für den Senegal, Ghana sowie Ruanda, wo sie bereits 50 Millionen Euro investiert haben. Damit bauen sie nach den bereits seit längerer Zeit bestehenden Autofabriken in Südafrika und Marokko neue Standorte auf. Das schafft dann natürlich auch Chancen sowohl für lokale als auch für deutsche Zulieferer, nach dem Motto: Wir folgen der Wertschöpfungskette.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie betonen die wirtschaftlichen Chancen, die Afrika bietet, haben aber selbst die Schwierigkeiten erwähnt, Stichwort „Krisenkontinent“.
Robert Kappel: Natürlich gibt es Staaten, in denen die Entwicklung langsamer voranschreitet, beispielsweise Sierra Leone, und sogar Staaten, die eine negative Entwicklung genommen haben, wie zum Beispiel die Sahel-Staaten im Norden Subsahara-Afrikas. Es handelt sich meist um Binnenstaaten, die nicht die Möglichkeit haben, Exportwaren per Schiff zu transportieren. In der Regel verfügen diese Staaten dann auch noch über schlecht ausgebaute Straßen und ein mangelhaftes Eisenbahnnetz, so dass die Verbindung mit Häfen in den Küstenstaaten mangelhaft ist.
Und selbstverständlich sind da die Länder, in denen aktuell Krieg geführt wird, beispielsweise Somalia, sowie diejenigen Länder, die von früheren Kriegen so zerrüttet sind, dass sie weiterhin als Krisenstaaten zu bezeichnen sind, zum Beispiel Burundi. Die lassen sich mit Chancen-Staaten wie beispielsweise Ghana natürlich nicht vergleichen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Der Westen begrüßt prinzipiell das Voranschreiten von Demokratisierung und politischer Partizipation. Ist eine solche Entwicklung tatsächlich stets positiv zu sehen? Geht es afrikanischen Ländern mit einer starken, autoritären Führung nicht oftmals besser, gerade auch wirtschaftlich?
Robert Kappel: Nein, das ist nicht der Fall. Autoritär ist nämlich nicht gleich stark. Den autoritären, den diktatorischen Regimen Afrikas fehlt es an Legitimation, und sie verfügen über keinen Parteiapparat, der sie stützt. Das ist zum Beispiel anders in China: Das dortige Regime genießt die Unterstützung von großen Teilen der Bevölkerung und kann sich auf eine loyale, kompetente Bürokratie verlassen. Das heißt, seine Macht beruht nicht ausschließlich auf Repression; es muss nicht andauernd damit rechnen, dass ein Putsch erfolgen könnte. Im Übrigen ist die Korruption in den autoritär regierten afrikanischen Staaten nicht geringer als in den anderen Ländern. Macht und Reichtum verteilen sich dort auf kleine klientilistische Gruppen; Posten und Ämter werden nicht an die bestqualifizierten Kandidaten, sondern an Familienmitglieder und Freunde vergeben.
Schauen wir uns doch mal die Situation in einigen Ländern an: In Uganda befindet sich mit Yoweri Kaguta Museveni ein quasi-Diktator an der Macht, die Wahlen finden nur pro-forma statt. Was die Korruption angeht: Die ist in Uganda sehr hoch.
In Gabun regierte die Familie Bongo über 30 Jahre lang diktatorisch. Dem Land geht es vergleichsweise gut, aber auch nur aufgrund seiner großen Rohöl-Vorkommen.
Mali ist trotz seiner Militärregierung ein äußerst instabiles Land. Gerade jetzt wurde von Armeeoffizieren ein erneuter Putsch durchgeführt, das Gleiche ist in Burkina Faso geschehen. Kamerun, wo zwar Wahlen stattfinden, die jedoch regelmäßig von Manipulationen überschattet sind, ist stark von Korruption betroffen. Und in Angola, dessen Staatsform das einer autoritären präsidentiellen Republik ist, verschwanden in der Zeit von José Eduardo Dos Santos über 30 Milliarden Dollar aus dem Staatshaushalt.
Man sieht: Es hilft Afrikas Staaten und Gesellschaften nicht, autoritär regiert zu werden. Zumal die Zukunft des Kontinents, wie bereits erwähnt, seine Mittelschicht ist. Eine Mittelschicht, die nicht nur ökonomisch vorankommen, sondern auch politisch partizipieren möchte, ist natürlich der Feind eines jeden autokratischen Regimes. Das muss nämlich, um seine Macht zu sichern, verhindern, dass die Mittelschicht zu stark wird - und behindert und bekämpft dadurch den Prozess, der Afrika in eine bessere Zukunft führt.
Hinweisen möchte ich noch auf die Ausnahme, die sozusagen die Regel bestätigt: Ruanda. Das Land ist alles andere als eine Demokratie. Aber es weist mit die höchsten Wachstumsraten aller afrikanischen Länder auf. Aber wie gesagt, ich halte Ruanda für eine Ausnahme.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie sprachen von den großen Chancen, die sich deutschen Unternehmen in Subsahara-Afrika bieten. Aber können sie angesichts des großen chinesischen Engagements tatsächlich noch eine Rolle spielen?
Robert Kappel: Ja, das können sie durchaus. Tatsache ist: Ich halte die Wirtschaftspolitik der Chinesen in Afrika für wenig nachhaltig.
Ihre Präsenz beschränkt sich größtenteils auf die Ausbeutung von Rohstoffen. Die Deutschen dagegen bauen Industrien auf, was langfristig für afrikanische Verhältnisse gut bezahlte Arbeitsplätze schafft. Nicht zu vergessen die Arbeitsplätze, die indirekt durch Industrie-Ansiedlungen entstehen.
Die Chinesen verfolgen mehr oder minder ausschließlich ihre eigenen Interessen. Ja, sie bauen Straßen. Aber wo? Dort, wo diese für den Transport der abgebauten Rohstoffe notwendig sind, ein grundlegender Aufbau der Infrastruktur geschieht nicht. Ursprünglich hieß es, man werde einhundert Millionen Jobs in Afrika schaffen. Bisher sind es gerade mal eine Million.
Es hieß auch, man werde sich aus der Politik heraushalten. Tut man auch - aber nur so lange, wie nichts geschieht, das sich gegen die eigenen Interessen richtet. Bei Ereignissen, die den eigenen Interessen konträr gehen, werden die Chinesen sehr schnell aktiv. Wenn beispielsweise Proteste stattfinden, die sich gegen die mangelhafte Bezahlung und schlechte Behandlung in chinesischen Unternehmen richten, wendet sich der chinesische Staat unverzüglich an die Machthaber in dem betreffenden Land und fordert sie auf, gegen die Demonstranten vorzugehen. Oder auch der massive Druck Chinas auf afrikanische Länder, wenn Kredite nicht wie vereinbart zurückgezahlt werden können. Da interveniert Peking deutlich und dringt auf Einhaltung der Verträge.
Ich sehe das chinesische Verhalten als imperial an, beinahe imperialistisch. Die Chinesen agieren imperial, sie nehmen deutlich Einfluss, weiten ihre wirtschaftliche und militärische Macht aus, schaffen sich Stützpunkte und Abhängigkeiten. Ihre Geostrategie hat viel Ähnlichkeit mit dem Vorgehen europäischer Kolonialherren des 19. und frühen 20. Jahrhunderts – trotz aller anderslautenden Rhetorik. Wobei deren Politik ja auch nicht nachhaltig war. China wird noch früh genug erkennen, dass es eine mangelhafte Afrika-Politik betrieben hat. Und zwar spätestens, wenn es realisiert, dass es versäumt hat, die Entwicklung des Kontinents voranzutreiben, damit seine Bewohner eines Tages das Geld haben, um chinesische Waren zu kaufen. Denn wenn die Exportnation China weiter expandieren will, muss sie neue Märkte erschließen, und das tut sie in Afrika nun mal nicht.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie haben das deutsche Engagement gerade gelobt …
Robert Kappel: Was die Unternehmen machen, ist ja auch gut, wobei ich einschränkend sagen muss: nur teilweise. Es braucht noch mehr langfristiges Engagement; wer zu kurzfristig denkt, wird nicht viel Erfolg haben, muss sogar damit rechnen, über den Tisch gezogen zu werden, weil er mit den lokalen Verhältnissen nicht oder nur unzureichend vertraut ist. Man braucht einen langen Atem und muss antizipieren, wohin die Reise Afrikas geht. Wenn man sich darüber klar ist, dann lohnen sich Investitionen vor Ort.
Was mir oft nicht gefällt, sind die offiziellen Verlautbarungen der Politik. Da ist viel Geschwurbel bei, viel Phrasendrescherei. Und es werden Extreme gezeichnet, das heißt, entweder werden die Probleme des Kontinents kleingeredet oder übertrieben. Wobei man sagen muss, dass der Einfluss der Politik besonders groß nicht ist - das heißt, sie kann nicht allzu viel kaputtmachen, gleichzeitig aber auch keinen allzu großen Beitrag leisten.
Der muss, wie schon gesagt, in erster Linie von der Wirtschaft kommen, auch vom Bildungssektor. Und zwar in Form von Investitionen und Kooperationen, letzteres in den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Fachhochschul- und Berufsausbildung.
Was Afrika definitiv nicht benötigt, ist Entwicklungshilfe. Wir können Afrikas Probleme nicht lösen, das können nur die Afrikaner selbst. Von afrikanischen Kollegen höre ich immer wieder, dass sie selbst wissen, welchen Weg sie gehen müssen - sie benötigen lediglich Unterstützung dabei, die Strecke zurückzulegen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Das werden einige Afrika-Aktivisten hierzulande aber gar nicht gern hören …
Robert Kappel: Es existiert tatsächlich eine Szene von Gutmenschen, die glauben, sie müssten „den armen Menschen im Süden“ etwas Gutes tun. Nun, meinetwegen sollen sie nach Afrika gehen und dabei helfen, eine Schule zu bauen. Aber als Entwicklungshelfer und sogenannte Experten agieren? Was für eine irrige Vorstellung: 28- bis 30jährige Deutsche mit wenig Lebens- und Berufserfahrung reisen auf einen anderen Kontinent, um den dort lebenden Menschen den Weg zu weisen. Das ist reinster Paternalismus, eine neue Art imperialen Denkens. Ganz so wie früher: Am deutschen Wesen soll die Welt genesen - in diesem Fall am linken deutschen Wesen.
Im Übrigen ist ja schon lange bekannt, dass Geld für Entwicklungshilfe sehr häufig in den Taschen der Machthaber landet. Als Angela Merkel im Jahr 2016 Niger besuchte, forderte der damalige Präsident Mahamadou Issoufou Hilfszahlungen in Höhe von einer Milliarde Euro. Die Kanzlerin war klug genug, höflich, aber bestimmt, abzulehnen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was halten Sie von großangelegten Interventionen, so wie die, die derzeit in Mali stattfindet?
Robert Kappel: Interventionen sind nur dann nachhaltig, wenn sie langfristig angelegt sind. Wenn man die Verhältnisse grundlegend verbessert, beispielsweise eine neue funktionierende Verwaltung aufbaut. Doch das dauert Jahre, eher Jahrzehnte. Und ich glaube kaum, dass Deutschland 25 oder 30 Jahre in Mali bleiben möchte.
Was den dortigen Einsatz angeht, so hat mir ein malischer Kollege erzählt, dass er richtiggehend wütend ist auf die Europäer. Deren Engagement führe nämlich nicht dazu, dass der Terrorismus abnimmt, im Gegenteil: Es stärke ihn, weil die Bevölkerung die Präsenz der ausländischen Soldaten ablehne. Dadurch bekämen die Islamisten zwar keinen weiteren Zulauf, aber das Verständnis für ihr Anliegen steige, genau wir ihr Ansehen unter der Bevölkerung. Das führt dann dazu, dass die Soldaten, wenn sie in ihren gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sind, mit Steinen beworfen werden. Das erinnert an den unglückseligen Afghanistan-Feldzug, als sich die Soldaten, die ja eigentlich dort waren, um zu helfen, kaum noch aus ihren befestigten, schwer bewachten Lagern heraus trauten. Die Franzosen sind mittlerweile entnervt. Sie fragen sich: Wie können wir Mali wieder verlassen, ohne das Gesicht zu verlieren, und ohne, dass das Land eine Terror-Regierung bekommt? Aber raus aus Mali, das wollen sie auf jeden Fall.
Im Endeffekt ist es so: Wenn man interveniert, wird man entweder Teil der Lösung, was - wie bereits erläutert - schwierig ist, oder man wird Teil des Problems.
Übrigens weiß ich auch nicht, wie man das Mali-Dilemma bewältigen kann. Ich denke, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir nicht in der Lage sind, alle Probleme auf dieser Welt zu lösen. Auch - und gerade - in Afrika nicht.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was uns zu unserer letzten Frage führt: Warum hält Deutschland sich nicht einfach aus Afrika raus? Vor allem aus Subsahara-Afrika? Wir haben gerade mal nachgeguckt: Von Berlin nach Conakry, der Hauptstadt von Guinea, das verhältnismäßig weit im Norden des Kontinents liegt, sind es immerhin 7.200 Kilometer.
Robert Kappel: Wie schon gesagt: Die wirtschaftliche Kooperation, der Handel mit Afrika und vor allem die Investitionen vor Ort bieten unserer Wirtschaft große Chancen. Wenn wir die verpassen, werden andere sie wahrnehmen. Afrika hat das Potenzial, sich zu einem wichtigen Absatzmarkt zu entwickeln. Derzeit wird viel über unsere wirtschaftliche Abhängigkeit von China diskutiert, was zum einen leicht zu einer politischen Abhängigkeit führen kann und zum anderen zum Problem werden könnte, sollte dem Reich der Mitte einmal die Luft ausgehen. Natürlich wird Afrika China als Absatzmarkt nicht ersetzen können, aber es kann eine wichtige Ergänzung darstellen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Herr Professor Kappel, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
***
Zur Person: Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Robert Kappel lehrt an der Fakultät für Wirtschaft der Universität Leipzig im Kompetenzzentrum SEPT (small enterprise promotion and training). Forschungsschwerpunkte: Entwicklung von Klein- und Mittelunternehmen, Wirtschaft Afrikas.