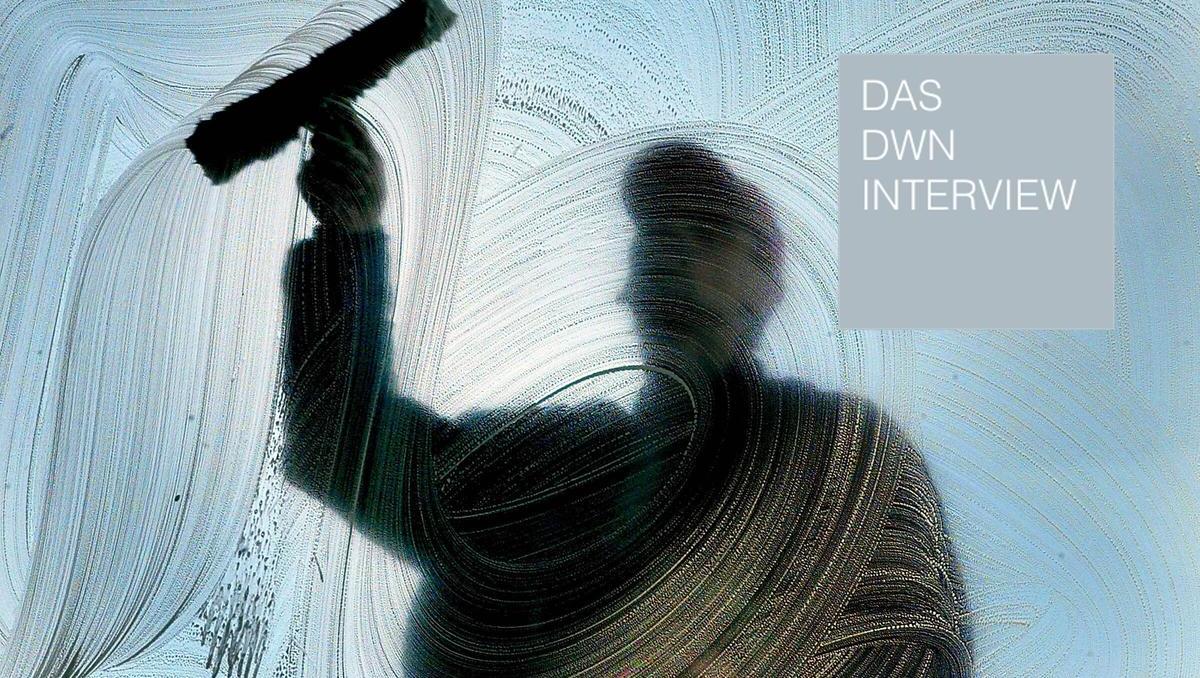Führt mehr Wettbewerb automatisch zu mehr Wachstum und Wohlstand? Nein, sagt der Ökonom Patrick Kaczmarczyk. Ein Wettbewerb, der ausschließlich über möglichst niedrige Löhne und Produktionskosten ausgetragen wird, zeitige keine positiven Effekte, im Gegenteil: Letzten Endes sei er sogar ruinös für alle Volkswirtschaften. Moritz Enders hat Kaczmarczyks neues Buch „Kampf der Nationen“ (Westend Verlag) gelesen und ihn zu der richtigen Balance zwischen staatlicher Regulierung und Laissez-faire befragt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was hat Sie zu Ihrem Buch „Kampf der Nationen“ veranlasst?
Patrick Kaczmarczyk: Ich habe lange im Ausland gelebt, und als ich nach Deutschland zurückkehrte, wurde mir schlagartig bewusst, wie weit wir in unserem ökonomischen Denken hinterherhinken. Das war für mich der Hauptgrund, das Buch zu schreiben. Wir hängen hier noch an Theorien, die im Rest der Welt lange tot sind. Ein Beispiel ist die Geldpolitik. International schauen Notenbanken und Institutionen vermehrt auf den Arbeitsmarkt und die Lohnentwicklung, um zu beurteilen, wie robust der Inflationsdruck sein mag. In Deutschland reden alle noch über die Geldmenge und die EZB. Das ist völlig verrückt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: In Ihrem Buch hinterfragen Sie das Konzept des Wettbewerbs. Können Sie das ausführen?
Patrick Kaczmarczyk: Ich hinterfrage vor allem die Art des Wettbewerbs. Es gibt in einer Marktwirtschaft zwei Möglichkeiten, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu steigern: Die erste ist, dass man das gegebene Niveau der Produktivität beibehält und einfach die Löhne senkt. Die zweite ist, dass die Löhne konstant bleiben und die Wettbewerbsfähigkeit durch eine höhere Produktivität verbessert wird.
In Europa glauben wir recht naiv und primitiv: je mehr Lohnwettbewerb wir haben, desto besser läuft die Wirtschaft. Darum müssen möglichst alle Preise „marktbestimmt“ sein. Der Staat darf nicht eingreifen. Und es braucht die maximale Freiheit für Produktionsfaktoren, Güter, Dienstleistungen und so weiter. Das ist jedoch ein Trugschluss.
In meinem Buch beziehe ich mich vor allem auf den österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter. Der stellt klar, dass, wenn wir der Welt des perfekten Wettbewerbs nahekämen, wir so effizient wären, dass Innovationen ein Ding der Unmöglichkeit werden. Bei maximaler Effizienz kann man es sich nämlich nicht leisten, in Innovationen zu investieren, bei denen man ex ante nie wissen kann, ob sie zu einem größeren wirtschaftlichen Erfolg führen. Man forciert mit diesem Wettbewerbsdogma einen destruktiven „Wettlauf nach unten“, bei dem es nur um Kostenoptimierung geht und die Löhne gesenkt werden. Für einen schumpeterianischen Wettbewerb hingegen braucht es staatliche Eingriffe, die das Zinsniveau insgesamt stabil halten, und die dafür sorgen, dass in einem Sektor alle miteinander konkurrierenden Unternehmen dieselben Lohnkosten haben. Nur dann entscheiden die Unterschiede in der Produktivität über die Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie und in welchem Maß sollte der Staat den Wettbewerb regulieren, in die Lohnpolitik eingreifen und die Wirtschaft steuern?
Patrick Kaczmarczyk: Aus Schumpeters Arbeiten lernen wir, dass es bei Entwicklung immer um eine Erneuerung der Produktionsstrukturen geht, die die Produktivität insgesamt steigert. Das muss das Ziel der Politik sein. Der brasilianische Ökonom Leonardo Burlamaqui hat in dem Zusammenhang das Bild des Staates als „Manager der schöpferischen Zerstörung“ aufgeworfen. Ich finde das sehr passend. Ein Manager weiß von den kleinen Details, die jeden Tag im Unternehmen passieren, nur einen Bruchteil. Bei großen Konzernen werden es nicht einmal 0,01 Prozent sein.
Und doch trifft der Manager weitreichende Entscheidungen, die die Ausrichtung des Unternehmens betreffen. Er koordiniert mit seinem Team die strategischen Abläufe, gibt die Marschroute vor. Ein Staat muss ähnlich strategisch denken und agieren, ohne, dass er sich im Kleinklein verliert. Kluge Industriepolitik lautet das Gebot der Stunde, wenn man technologische Transformation und Treibhausgasneutralität so gestalten möchte, dass die Gesellschaft nicht auseinanderfliegt.
Was die Wettbewerbspolitik betrifft, so müssen die Staaten – in Kooperation mit anderen Ländern – gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen, auf Basis derer ein schumpeterianischer Wettbewerb entstehen kann. Das heißt, zunächst müssen die Zentralbanken die Zinsen stabilisieren, denn laut Schumpeter gibt es Entwicklung nur, wenn das Zinsniveau vorhersehbar stabil und niedrig ist. Ohne, dass die Zentralbank hinter den Staatsanleihen steht, wird das nicht gehen, denn Staatsanleihen bilden in jedem Finanzmarkt den Referenzpunkt für die gesamte Kreditkurve. Das bedeutet, um es einfacher zu formulieren: alle Preise am Kapitalmarkt orientieren sich an den Renditen auf Staatsanleihen. Wenn diese Renditen in die Höhe schnellen, wird es auch für Unternehmen teurer, Kapital aufzunehmen, was Innovationen abwürgt. Zweitens muss man über eine hohe Tarifbindung und eine rigide Lohnpolitik dafür sorgen, dass Unternehmen nur über Investitionen und eine höhere Produktivität ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen können, nicht über Lohnsenkungen. In einer internationalen Wirtschaft braucht es deshalb eine gemeinsame Lohnkoordination der Staaten, beispielsweise bei Direktinvestitionen. Denn ansonsten könnte man sich ganz einfach mit der Auslagerung der bestehenden - aber langfristig nicht mehr wettbewerbsfähigen - Produktionsmethoden in Niedriglohnländer über Wasser halten, jedenfalls kurzfristig.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Mehr staatliche Regulierung per se schließt aber den „Kampf der Nationen“ nicht aus. Vielmehr könnte dieser Kampf das Gegenteil dessen bewirken, was Sie anstreben - oder?
Patrick Kaczmarczyk: Leider scheint es oft so, dass die Politik erst handelt, wenn sie kaum noch eine andere Wahl hat, oder wenn es darum geht, sich gegen ein anderes Land aufzuraffen. Wir sehen das in den USA, die plötzlich gemerkt haben, dass es mittlerweile Länder gibt, die ihnen auf internationaler Bühne Widerstand leisten können. Jetzt versucht man, so schnell es geht, gegenzusteuern, um auf der einen Seite die technologische Spitzenposition nicht zu verlieren und auf der anderen Seite eine völlig verkommene Infrastruktur zu rehabilitieren. Auch in Europa finden zarte Töne des Umdenkens nur deshalb statt, weil wir Angst haben, dass uns die Amerikaner und Chinesen endgültig davonziehen. Denken wir mal an das von Peter Altmaier vorgestellte Papier zur Industriepolitik. Das war vor einigen Jahren noch undenkbar. 2017 wurde beispielsweise Peter Bofinger in den Medien zerrissen, weil er in einem Artikel in der FAZ dafür plädierte, „mehr Zentralismus zu wagen“. 2019 stellte Altmaier eine Industriepolitik vor. Da hat sich in kurzer Zeit vieles sehr verändert – und die Coronakrise hat diese Tendenzen noch verstärkt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Staatliche Planung war in der Vergangenheit allerdings selten erfolgreich, wie die Entwicklung der ehemals sozialistischen Staaten zeigt.
Patrick Kaczmarczyk: Was heißt hier selten erfolgreich? Jedes Industrieland der Welt ist nur deshalb zu dem Wohlstand gekommen, den seine Bürger heute genießen, weil es einen starken Staat gab, der Industriepolitik betrieb. Oftmals waren leider machtpolitische und militärische Überlegungen zentral, weniger das Wohlergehen der Bevölkerung. Doch ohne Industriepolitik geht nichts. Noch deutlicher sehen wir das an der Entwicklung im globalen Süden und in den nicht-westlichen Staaten. Nur die Länder, die politisch dazu in der Lage waren, eine solide Industriepolitik zu fahren, haben ihren materiellen Lebensstandard signifikant erhöhen können. Dazu zählen vor allem die asiatischen Staaten. Japan und Korea sind dabei sicherlich die Vorzeigekinder des 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert war es vor allem der Aufschwung Chinas, der die Welt ins Staunen brachte – und wieder beruhte der Erfolg auf einer klugen Industriepolitik.
Betrachtet man die letzten 40 Jahre dort, muss man feststellen, dass es schon eine gewisse Ironie hat, dass eine kommunistische Partei den Kapitalismus viel besser versteht als die westlichen Politiker. Es geht immer um eine Erneuerung der Produktionsstrukturen und eine Steigerung der Masseneinkommen, damit die Produkte, die die Menschen produzieren, auch konsumiert werden können. Den Unternehmen wiederum bietet die steigende Nachfrage, die sich aus den steigenden Masseneinkommen ergibt, erhebliche Investitionsanreize. Das hat China begriffen, und deswegen war die Lohnpolitik dort auch ein zentraler Bestandteil der Fünfjahrespläne. Vor allem der Mindestlohn wurde dabei als Produktivitätspeitsche für die Unternehmen benutzt und war gleichzeitig auch der Anker für eine stetig steigende Binnennachfrage. Ohne den ökonomischen Erfolg Chinas hätte die Weltwirtschaft fast sämtliche Millenniumsentwicklungsziele der Vereinten Nationen, die im Jahr 2000 festgelegt und für das Jahr 2015 angestrebt worden waren, verfehlt. Auch die Bilanz der Globalisierung sähe deutlich düsterer aus, denn wenn man vom Entwicklungserfolg der letzten 30 Jahre spricht, meint man beinahe ausschließlich China. Dort, wo westliche Institutionen wie der IWF und die Weltbank die Politik bestimmten und die Länder zwangen, „dem Markt“ möglichst freien Lauf zu lassen, Staatsausgaben zu begrenzen und so weiter, hat sich ökonomisch extrem wenig getan.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Aber kann sich freies Unternehmertum - der Treiber von Innovation und Fortschritt, wie es gemeinhin heißt -, in derartig kontrollierten Systemen überhaupt entfalten?
Patrick Kaczmarczyk: Man muss sich von der Idee lösen, dass es so etwas wie ein „freies Unternehmertum“ gibt. Das existiert nicht. Ebenso wenig gibt es eine Trennung zwischen „Markt“ und „Staat“. Diese Konzeptualisierungen sind sehr fest in unseren Köpfen verankert, doch sie haben absolut keinen Realitätsbezug. Ohne Staat gibt es schlichtweg keinen Markt. Das hat es auch noch nie gegeben, von ganz primitiven Formen des Austausches mal abgesehen. Wir sollten uns auch von der Idee verabschieden, dass alles, was der Staat anfasst, schlicht in die Hose geht. Die britische Ökonomin Mariana Mazzucato hat diese Mär mit vielen Fallbeispielen eindrucksvoll widerlegt. Innovationen kommen oftmals vom Staat, und Schumpeter sah das genauso, als er beispielsweise das amerikanische Landwirtschaftsministerium für den Einsatz neuer Organisations- und Produktionsformen in der Landwirtschaft pries und ihm die Rolle des Pioniers zuschrieb.
Markt und Staat gehen somit immer Hand in Hand, doch man muss sich vor allem die Frage stellen: „Was für einen Markt wollen wir?“ Das ist entscheidend. Und da müssen wir schauen, welche Hebel wir in der Politik und Wirtschaft nutzen können und müssen, um gesamtwirtschaftlich eine gute Nachfrage- und Investitionsdynamik zu generieren. Nur so funktioniert Entwicklung.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was ist mit den sogenannten „hidden champions“, von denen es so viele in Deutschland gibt?
Patrick Kaczmarczyk: Das ist immer eine schöne Geschichte, die gerne als Beispiel für Innovationen vorgeschoben wird. Es hat auch etwas von einem gallischen Dorf, das inmitten des globalen Kapitalismus´ der Großkonzerne den eigentlichen Innovationsmotor spielt. Aber die Zahlen lassen uns da ein wenig nüchterner werden. Der Mittelstand ist zweifellos zentral für die Produktion und Beschäftigung in Deutschland. Mehr als 99 Prozent der Unternehmen zählen dazu. Allerdings erwirtschaftet diese Masse an Unternehmen gerade einmal ein Drittel des Gesamtumsatzes in Deutschland und stellt 55 Prozent aller Arbeitsplätze. Das heißt, dass insgesamt 45 Prozent der Beschäftigten und zwei Drittel aller Umsätze von den 0,7 Prozent der Unternehmen abhängen, die nicht dem Mittelstand angehören. Das sind enorme Proportionen.
Auch im Hinblick auf Innovationen sind kleine und mittelständische Unternehmen, also Firmen mit weniger als 500 Mitarbeitern und weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz, eher zweitrangig in ihrer Bedeutung. 2016, für das Jahr habe ich die letzten Zahlen im Kopf, kam diese Gruppe auf zehn Prozent der gesamten deutschen Ausgaben für Forschung und Entwicklung und 15 Prozent der Innovationsausgaben. Das Groß der Investitionsausgaben entfällt somit auf einen winzigen Anteil von weit weniger als einem Prozent der Firmen. Schumpeter zufolge ist dies auch nicht weiter verwunderlich, denn größere Firmen haben mehr Raum für Synergien, Skaleneffekte und die nötige Luft, Projekte und Ressourcen auch mal in den Sand zu setzen. Bei Innovationen haben wir es immer mit etwas zu tun, das es in der Form noch nicht gegeben hat. Dass dabei Sachen schiefgehen, ist völlig normal.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wird der „Kampf der Nationen“ auf globaler Ebene immer weitergehen, oder sehen Sie hierzu Alternativen?
Patrick Kaczmarczyk: Ich bin, was Alternativen auf globaler Ebene in naher Zukunft anbelangt, eher skeptisch. Ökonomisch wäre es allerdings schon ein Segen, wenn wir es schaffen würden, uns in Europa zusammenzuraffen. Das ist das primäre Anliegen des Buchs: zu zeigen, dass der „Race to the bottom“, der Unterbietungswettlauf, dieser wirtschaftspolitische Darwinismus, den wir in der Eurozone installiert haben, auf lange Sicht ins Verderben führt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Herr Kaczmarczyk, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Info zur Person: Dr. Patrick Kaczmarczyk ist Entwicklungsökonom und arbeitet mit verschiedenen internationalen Entwicklungsorganisationen zusammen. Zuletzt war er als Berater für die UNO-Organisation für Welthandel und Entwicklung (UNCTAD) in Genf tätig. Er promovierte als Stipendiat des Economic and Social Research Council (ESRC) der britischen Regierung am Institut für politische Ökonomie der Universität Sheffield (SPERI). Einen Teil seines Doktorats absolvierte er an der berühmten Pariser „Sciences Po“.