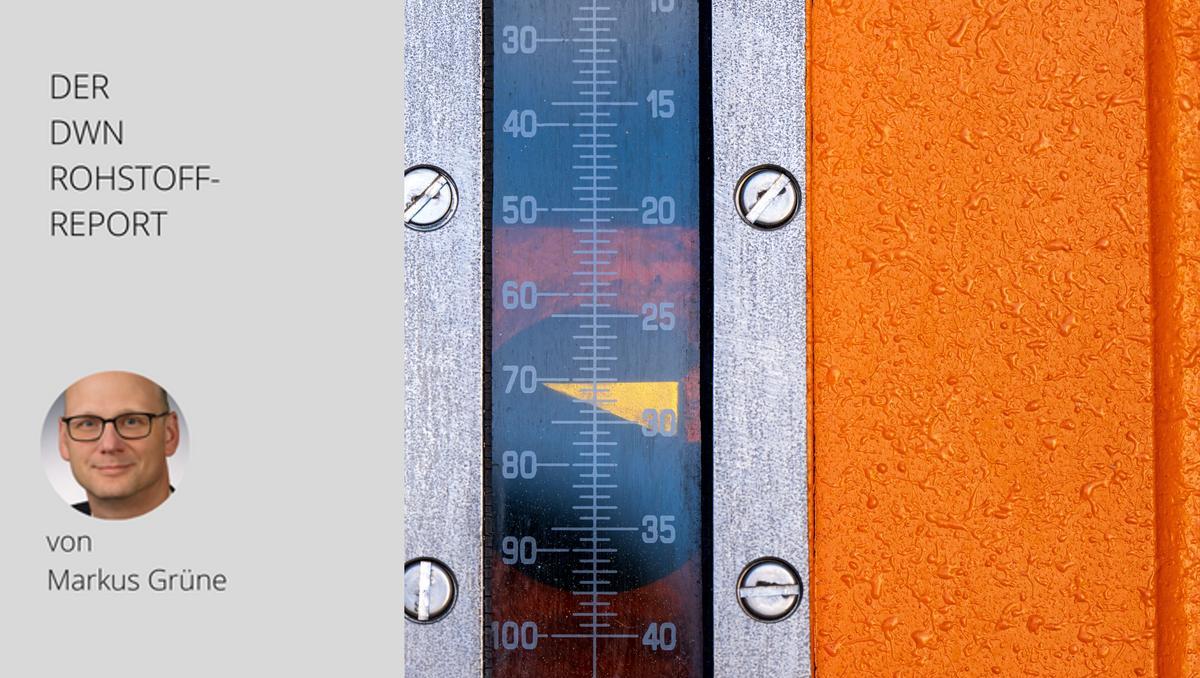Mit der aktuellen Energiekrise rückt auch das Rückgrat der europäischen Versorgungssicherheit, die Erdgasspeicher, zum ersten Mal verstärkt in den medialen Fokus. Regelmäßig erfahren wir nun das Neueste zu Füllständen, Speicherkapazitäten, Einspeichergeschwindigkeiten, Verbrauchsprognosen und dergleichen mehr. Dabei werden die Speicher als solche jedoch nur selten näher beleuchtet. Mit diesem Hintergrundbeitrag soll sich der Fokus daher einmal auf eine der wesentlichen Säulen unserer Energieversorgung richten.
Nimmt man einmal alle ober- und unterirdisch genutzten Erdgasspeicher zusammen, so liegt Deutschland, hinter den USA, Russland und der Ukraine weltweit auf Platz vier und europaweit mit mehr als 240 Milliarden kWh auf Platz eins, was deren Speicherkapazitäten betrifft. Zwar gibt es in Deutschland, anders als zum Beispiel im benachbarten Österreich, bislang keine sogenannte „strategische Gasreserve“ - die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit zwingen jedoch auch hierzulande zum Umdenken.
Noch bis Anfang diesen Jahres war das Ziel, auch ohne eine solche zu jeder Zeit 25 Prozent des inländischen Jahresbedarfs an Erdgas vorrätig zu halten. Diese Menge reichte nach den bisherigen Erfahrungen aus, um die Versorgung auch in Extremsituationen - gemäß der bis zum Ausbruch des Ukraine-Krieges vorstellbaren Szenarien - zu sichern und zudem die Schwankungen in der Stromversorgung mit alternativen Energiequellen, wie Wind– und Solarenergie, auszugleichen. Die Befüllung der Erdgasspeicher erfolgt sinnvollerweise in den verbrauchsärmeren Sommermonaten, geleert werden sie dann während der darauf folgenden Heizperiode. Dabei nutzt man die kleineren überirdischen Speicher, das sind Gasometer und Hochdruckspeicher, um untertägige Nachfrageänderungen abzufedern, während die großen Untertagespeicher zum Ausgleich der jahreszeitlichen Schwankungen dienen und auch bei Lieferengpässen zum Einsatz kommen.
Poren- und Kavernenspeicher sind natürliche Reservoire
Im Örtchen Rehden in Niedersachsen, etwa 100 Kilometer nordwestlich von Hannover, befindet sich der mit einer Kapazität von fast vier Milliarden Kubikmetern größte Erdgasspeicher Westeuropas. Hier lagert in zwei Kilometern Tiefe der Jahresverbrauch von rund zwei Millionen Einfamilienhäusern.
Rehden ist ein Beispiel für einen sogenannten Porenspeicher. In früheren Zeiten waren solche Speicher oft einmal Lagerstätten für Erdöl und Erdgas, und nachdem diese Vorkommen gefördert waren, konnte die ehemalige Lagerstätte als Speicher „recycled“ werden. Sie sind also natürlichen Ursprungs und nutzen die winzigen Klüfte und Hohlräume unterirdischer Kalk– und Sandsteinschichten. In diese wird das Erdgas mit hohem Druck eingepresst und dann darin, wie in einem Schwamm, eingeschlossen. Auch die Abdichtung ist natürlich: weitere, sie umgebende undurchlässige Gesteinsschichten sowie wasserführende Bereiche verhindern das Entweichen des eingespeicherten Gases. Es handelt sich dabei allerdings um relative langsame Speicher, das heißt, Ein– und Ausspeichervorgänge sind verhältnismäßig zeitintensiv, weshalb sie sich besonders für die gut planbare saisonale Grundlastversorgung eignen.
Kavernenspeicher hingegen verfügen über ein kleineres Speichervolumen als ihr oben beschriebenes Pendant. Bei ihnen handelt es sich zudem um künstlich angelegte Hohlräume in ehemaligen Salzstöcken. Durch die Aushöhlung des Salzstocks mittels Wasserzufuhr, dieser Vorgang wird als Aussolung bezeichnet, entstehen Hohlräume von bis zu 500 Metern Höhe. Hier liefert die die Kaverne umgebende Salzschicht eine natürliche Barriere für das eingeschlossene Gas und verhindert sein Ausströmen. Kavernenspeicher haben gegenüber Porenspeichern den Vorteil, dass sie eine höhere Ein– und Ausspeicherleistung haben. Dadurch, dass das Erdgas nicht erst durch die Poren des Gesteins zur, bzw. von der Bohrung weg strömen muss, sondern durch einen direkten Anschluss unmittelbar ein– und abgelassen werden kann, werden die höheren Geschwindigkeiten erreicht. Deshalb werden diese Art Speicher, ähnlich den kleineren überirdischen, auch vorwiegend zum Ausgleich kurzfristiger Bedarfsschwankungen genutzt und können somit spontane Engpässe in der Gasversorgung ausgleichen.
Physikalische Regeln setzen Grenzen
Um in den Speichern den zum Betrieb notwenigen Druck und auch deren Stabilität aufrecht erhalten zu können, muss immer eine gewisse Menge Gas vorgehalten werden. Dieses sogenannte Kissengas steht zum Verbrauch also nicht zur Verfügung, sondern verbleibt permanent im Speicher. Je nach Füllstand des Speichers ändert sich naturgemäß dessen maximale Ein- beziehungsweise Ausspeicherleistung, da diese vom im Inneren herrschenden Druck abhängen. Je voller ein Gasspeicher ist, desto höher sein Innendruck, was zu einer niedrigeren Einspeicherleistung führt. Umgekehrt kann die Ausspeichermenge im Falle von Versorgungsstörungen leider nicht unbegrenzt erhöht werden, da sie ihrerseits mit Abnahme des Speicherfüllstands zurückgeht.
Der nutzbare Teil, das Arbeitsgas, macht dabei zwischen 35 und 75 Prozent des Gesamtspeichervolumens aus, je nach Speichertyp und geologischer Beschaffenheit der Umgebung, wobei der Arbeitsgasanteil eines Kavernenspeichers erheblich höher ist als der eines Porenspeichers. In Deutschland sind momentan 51 unterirdische Erdgasspeicher in Betrieb, die sich auf Grund der geologischen Gegebenheiten auf Regionen im Nordwesten, in Mitteldeutschland und im Südosten konzentrieren. Beim weitaus größten Teil davon handelt es sich um Kavernenspeicher.
Strategische Bedeutung und Systemrelevanz lange nicht erkannt
Die Missachtung des alten, auch auf andere Lebensbereiche übertragbaren, Investmentgrundsatzes „Man lege nicht alle Eier in einen Korb“ zählt zu einem der schwerwiegendsten energiepolitischen Fehler der letzten Jahre. Nicht nur, dass man einen einzelnen Lieferanten eines insbesondere für Deutschland wirtschaftlich überlebenswichtigen Gutes massiv übergewichtet hat, man überließ darüber hinaus auch ebenjenem die Kontrolle über enorme Speicherkapazitäten, groteskerweise noch dazu auf eigenem Boden.
Das niemandem aufgefallen ist, dass Gazprom im vergangenen Jahr massiv vom üblichen Speicherfahrplan abwich und den Speicher in Rehden im Sommer eben nicht befüllte, ist im Rückspiegel betrachtet ebenso unverständlich. Wenn man den folgenden, damit zusammenhängenden Ereignissen etwas positives abringen will, dann zumindest, dass die enorme strategische Bedeutung auch der Speicherinfrastruktur - sowie deren Besitzverhältnisse - nun erkannt worden ist.
Immerhin sieht es so aus, dass die Kraftanstrengung hinsichtlich des Befüllungsplans zum Winter hin aufgeht. Laut Gas Infrastructure Europe (GIE) sind die deutschen Erdgasspeicher mittlerweile zu mehr als 80 Prozent gefüllt (Stand 23.08.2022). Dies übertrifft das per September angepeilte Ziel schon jetzt und deutet darauf hin, dass auch der für Anfang November vorgesehene Füllstand von 95 Prozent eher erreicht werden wird. Unter der Voraussetzung ausbleibender neuer gasspezifischen Hiobsbotschaften aus östlicher Richtung und in der expliziten Hoffnung auf auch diesmal keine weiße Weihnacht, könnte Deutschland in dieser Hinsicht doch noch mit einem blauen Auge davonkommen, ohne drastische Maßnahmen für Wirtschaft und Gesellschaft in den Wintermonaten.