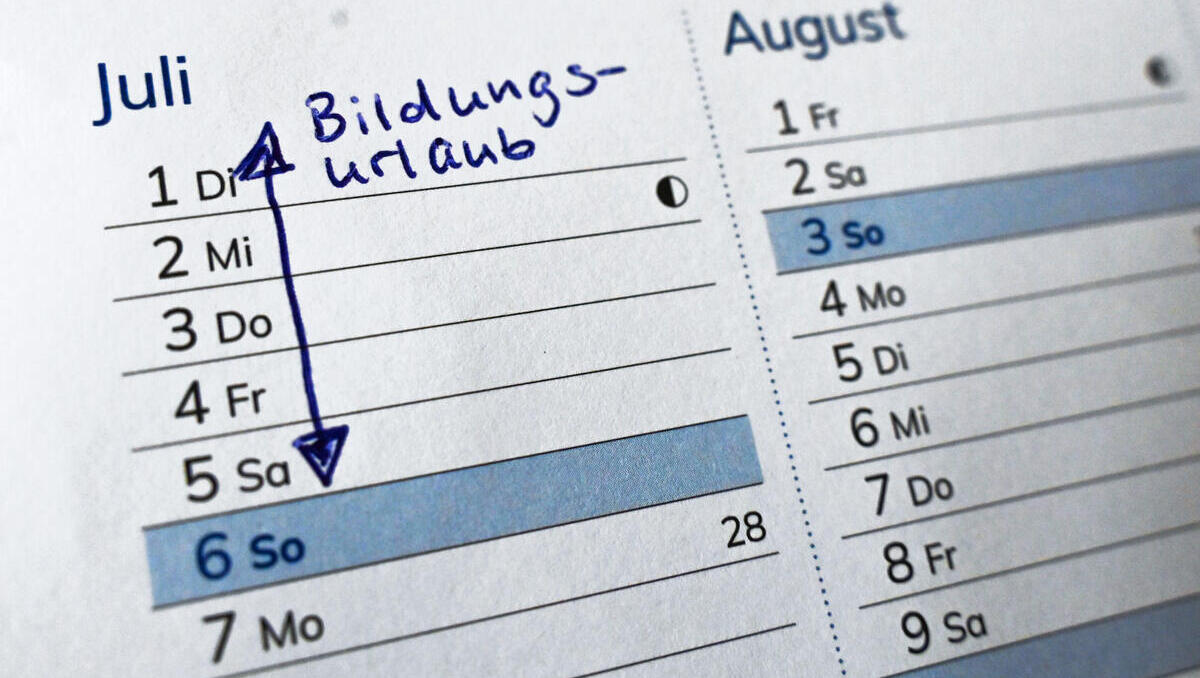Derivate sind aus dem globalen Finanzmarkt nicht mehr wegzudenken. Komplexe Finanzinstrumente wie Zertifikate, Futures, Optionen, Differenzkontrakte (CFDs) und Swaps dienten ursprünglich nicht der Spekulation auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und Rohstoffen, sondern vor allem der Absicherung von Zahlungsströmungen und bilanziellen Wertveränderungen. Genaueres über ihre Funktionsweise, Gefahren und Praxistipps für Privatanleger können Sie in unserem ausführlichen Ratgeber über Derivate lesen.
Mit der Zeit rückte beim Einsatz von Derivaten die Realwirtschaft in den Hintergrund, sodass sie seit Jahrzehnten heftig umstritten sind. In den Augen der Skeptiker ist der Derivatemarkt eine tickende Zeitbombe, dessen Gefahren die Vorteile weit überwiegen. Im Zentrum der Diskussion stehen die systemischen Derivate-Risiken.
Mediale Spekulationen um das Derivate-Volumen der Deutschen Bank
Vor allem englischsprachige Finanzmedien weisen in diesem Kontext gerne auf das Derivate-Volumen der Deutschen Bank hin. Dieses wurde in der Vergangenheit teilweise als großes Risiko für die Bank selbst und das gesamte Finanzsystem dargestellt. Vor rund 20 Jahren sorgte der britische „Economist“ für Aufsehen, als man die Deutsche Bank in diesem Kontext als „gigantischen Hedgefonds“ bezeichnete. Auch der bekannte Finanzblog „Zerohedge“ griff das Thema mehrmals auf und wies auf den riesigen Wert des Derivatebuchs hin. Zurecht?
Teilweise wurden sogar Parallelen zur 2008 infolge der Finanzkrise kollabierten US-Investmentbank Lehman Brothers gezogen. Wirklich seriös ist das nicht, denn Lehman ging nicht an Kapital-, sondern Liquiditätsproblemen zugrunde.
Die medialen Spekulationen rund um das Derivategeschäft wurden 2019 neu angefacht, als die Deutsche Bank eine interne Bad Bank („Capital Release Unit“, kurz CRU) gründete, in die Kredite, Hypotheken-Anleihen und Derivate-Positionen mit einem Marktwert von über 50 Milliarden Euro ausgelagert wurden. Diese Positionen wurden teilweise am Markt mit Verlust veräußert, was das Jahresergebnis von 2019 bis 2022 schmälerte, allerdings auch Kapital freisetzte und somit die Kapitalbasis stärkte. Laut Angaben des Finanzinstituts hat die CRU-Einheit ihren Zweck - die Fokussierung auf das Kerngeschäft - nun erfüllt und wird seit 2023 nicht mehr als eigenes Segment ausgewiesen.
Ein Blick in die Bankbilanz
Betrachten wir einmal genauer das aktuelle Derivatevolumen der Deutschen Bank, über dessen vermeintlich gigantische systemische Risiken seit vielen Jahren gemunkelt wird. Wie aus dem Jahresbericht (Seite 170) hervorgeht, hält die Deutsche Bank in ihrem Derivatebuch Positionen mit einem Nominalwert von 52,45 Billionen (Tausend Milliarden) Euro, 10 Billionen mehr als im Vorjahr. Dieses Derivate-Portfolio entspricht dem 13-fachen von Deutschlands Bruttoinlandsprodukt und rund 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung – bei nur einer einzigen Großbank! Relativ zur Bilanzsumme der Bank (1.300 Milliarden Euro) ist das Brutto-Derivatevolumen 40-mal so hoch und die Kapitalbasis mit einem Eigenkapital von 74,8 Milliarden Euro wirkt im Vergleich geradezu verschwindend gering.
Aus dem Bericht geht auch hervor, dass nur ein Anteil von 5 Prozent des gesamten Derivate-Handels des deutschen Branchenprimus an einer Börse abgewickelt wird, der restliche Handel kam außerbörslich (OTC) zustande. Von den außerbörslichen OTC-Geschäften kamen 28 Prozent, also circa 14 Billionen Euro aus dem direkten bilateralen Handel. 72 Prozent der OTC-Geschäfte liefen über eine Clearingstelle, wodurch das Gegenpartei-Risiko zumindest in der Theorie abgesichert wird.
Derivatebuch netto nur 16 Milliarden Euro wert
Auf den ersten Blick lesen sich die Zahlen abstrus. Aber man müsse genauer hinschauen, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bank auf unsere Anfrage hin. Die eigentliche relevante Zahl sei nicht der Nominalwert, sondern der wirtschaftlich relevante Marktwert des Derivate-Exposures. Das tatsächliche ökonomische Risiko liegt demnach lediglich bei rund 16 Milliarden Euro.
Diese Zahl wird in mehreren Schritten errechnet. Aus der konsolidierten Bilanz (Jahresbericht, Seite 213) geht hervor, dass die gehaltenen Derivate-Forderungen (Aktiva) einen Brutto-Marktwert von rund 252 Milliarden Euro aufweisen. Die Derivate-Verbindlichkeiten (Passiva) betragen demnach etwa 238 Milliarden Euro. Diese Zahlen lesen sich schon weitaus weniger bedrohlich als der Nominalwert von über 50.000 Milliarden Euro.
Im nächsten Schritt werden entgegengesetzte Derivate-Positionen auf der Aktiv- und Passivseite gegeneinander aufgerechnet („netting“), wodurch 195 Milliarden Euro verschwinden. Abzüglich Sicherheits-Hinterlegungen bei den Clearingstellen im Wert von 40 Milliarden Euro bleibt wirklich nur noch ein Marktwert von 16 Milliarden Euro übrig.
Der Wert von 16 Milliarden Euro findet sich auch leicht verklausuliert in der gesonderten Derivate-Auflistung, wo ein positiver Marktwert von 23 Milliarden Euro (nach Aufrechnung und Berücksichtigung von Cash-Sicherheiten im Wert von 33 Milliarden Euro, aber ohne Abzug von hinterlegten Wertpapieren mit einem Gegenwert von 7 Milliarden) ausgewiesen wird. Durch zusätzliche Hedging-Maßnahmen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen werden, sinke dieser Wert noch weiter, wie der Banksprecher betonte.
Das tatsächliche ökonomische Risiko des Derivatebuchs beträgt demnach weniger als ein Tausendstel des Nominalwerts. Der Nominalwert gibt eine falsche Vorstellung vom praktischen Risiko, weil hiermit nicht der Preis des Derivats, sondern der unterliegende Basiswert festgehalten wird. Bei den allermeisten Derivatekontrakten wird der Nennwert aber nicht ausgetauscht. Es ist lediglich ein Referenzbetrag, also beispielsweise der Aktienkurs bei einer Aktien-Option oder das gesamte Kreditvolumen bei einem Zins-Swap.
Absicherung von Zinsrisiken
Stichwort Kredite: Durch das hohe Exposure im klassischen Kreditgeschäft muss Deutschlands größtes Geldhaus auf die Absicherung von Zinsänderungsrisiken achten und somit dient vermutlich mehr als die Hälfte des Derivatevolumens diesem Zweck. Zinsderivate machen rund 80 Prozent des gesamten Derivatebuchs aus. Wer kein vernünftiges (Zins-)Risikomanagement betreibt, riskiert ein Schicksal wie das der kollabierten amerikanischen SVB-Bank.
„Es geht bei diesen Derivate-Geschäften vor allem um Absicherung“, bestätigt ein Risikomanager, der für eine kleinere Bank arbeitet, im Gespräch mit den DWN. „Die meisten Positionen gleichen sich gegenseitig aus.“
Außerdem platziert die Deutsche Bank Derivate-Orders für Großkunden und nimmt diese aufs eigene Buch, bis eine Gegenpartei gefunden ist. Die Kunden sind zum Beispiel Unternehmen, die ihre Exporteinnahmen in Schweizer Franken gegen Wechselkursschwankungen absichern wollen. Der riskante Eigenhandel ist hingegen nach der Finanzkrise 2008 nicht zuletzt wegen schärferer Kapitalvorschriften der Regulatoren quasi in der Versenkung verschwunden. Auf Anfrage teilte uns die Deutsche Bank mit, dass man sich schon vor rund 15 Jahren komplett aus dem Eigenhandelsgeschäft mit Aktien und Rohstoffen zurückgezogen habe.
Vergleich mit der Konkurrenz zeigt: Kein Grund zur Panik
Es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Aufregung senken sollte, auf den die Deutsche Bank in unserem Gespräch gar nicht hinwies: Auf der Gegenseite der Positionen dürften in erster Linie andere Großbanken wie der US-Platzhirsch JP Morgan und die Schweizer UBS stehen, die ähnlich stark im Derivategeschäft engagiert sind und allesamt „too big too fail“ sind. In einer hypothetischen neuen systemischen Krise würde keines der Institute fallen gelassen, weil die Folgeschäden viel zu verheerend wären.
Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten haben zu Vergleichszwecken auch die Bilanzen der beiden oben genannten Banken-Schwergewichte durchforstet. JP Morgan weist den tastächlichen Wert der Derivate nur gesondert aus (Jahresbericht, Seite 180). Nach Aufrechnung und Abzug der Verbindlichkeiten (41 Milliarden Dollar) von den Forderungen (55 Milliarden) steht ein Marktwert von 14 Milliarden Dollar, ergo knapp 13 Milliarden Euro. Der Nominalwert ist nur auf Seite 206 gelistet und beträgt knapp 50 Billionen Dollar – umgerechnet entspricht dies aktuell 45,7 Billionen Euro, was etwas niedriger als die 52,45 Billionen Euro der Deutschen Bank ist.
Die UBS liefert dagegen alles in einer einzelnen Übersicht (Jahresbericht, Seite 335). Demnach verwaltet die Schweizer Großbank umgerechnet circa 30 Milliarden Euro an derivativen Wertpapieren, wobei ein Viertel davon auf die übernommene Credit Suisse entfällt. Der ökonomisch relevante Marktwert ist negativ mit minus 15 Milliarden Euro.
Diese Zahlen unterscheiden sich kaum von denen der Deutschen Bank. Der Netto-Marktwert der Derivatebücher ist in derselben Größenordnung, was auch auf enge gegenseitige Verflechtungen hindeuten könnte. Zudem zeigt sich bei allen drei Geldhäusern ein starker Fokus auf Zinsderivate und ein sehr überschaubarer Anteil von Aktien- und Rohstoff-Derivaten.
Derivate-Risiken müssen differenziert betrachtet werden
Die Deutsche Bank führt ihr Derivate-Portfolio nicht, um das globale Finanzsystem zu gefährden. Sie sichert damit in erster Linie unsichere Zahlungsströme, Zins- und Wertänderungs-Risiken in ihrer Bilanz ab. Die systemischen Risiken am Derivatemarkt haben weniger mit einzelnen Akteuren als vielmehr mit dem Verhalten der Zentralbanken zu tun. Und ironischerweise können Derivate dabei helfen, sich gegen solche Risiken und viel banalere Eventualitäten wie unliebsame Preisschwankungen abzusichern. Man muss eben nur darauf achten, bei wem genau man sich absichert.
Der Kollaps von Lehman-Brothers hat damals am Derivatemarkt schwere Schäden hinterlassen und machte sowohl in den USA als auch in Europa gigantische Hilfspakete für diverse Groß- und Landesbanken notwendig. In der Finanzkrise gab es nicht nur unter den Großbanken Turbulenzen. Totalverluste bei Zins-Zertifikaten von Lehman, die massenweise an deutsche Kleinanleger verkauft worden waren, sorgten für gewaltige Furore. Ähnliche Derivate-Geschäfte mit einem extrem hohen Hebel oder falsche/manipulierte Ratings von Finanzprodukten könnten auch heutzutage verheerende Abwärtsspiralen in Gang setzen. Zugleich haben die Regulatoren aus der Vergangenheit gelernt und sorgen dafür, dass ein Großteil der Derivate-Transaktionen heute über zentrale Clearinghäuser abgewickelt und rückversichert wird.
Das Szenario eines Systemcrashs am Derivatemarkt, der durch das Fehlverhalten einer einzelnen Großbank ausgelöst wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Sofern die zuständigen Banker ein gutes Riskomanagement betreiben, achten sie ohnehin darauf, nicht zu viel Exposure bei einem einzelnen Institut zu haben und handeln so, dass sich die Derivate-Positionen auf Aktiv- und Passivseite halbwegs ausgleichen. Der in Relation sehr geringe Marktwert des Derivatevolumens der Deutschen Bank ist tatsächlich eher ein gutes Zeichen. Wäre der Wert ein Vielfaches höher, wäre dies ein Indiz dafür, dass die Bank zu hohe Risiken eingeht.
Das bedeutet nicht, dass die obigen Zahlen völlig unbedenklich sind. Allerdings ist es unangebracht, hier die Deutsche Bank hervorzuheben. Deutschlands größtes Finanzinstitut leidet medial noch immer unter der Ära von Ex-Vorstandsboss Josef Ackermann, der riesige Stücke auf das Investmentbanking hielt und den Konzern letztlich in Misskredit brachte. Bis heute berüchtigt ist seine wahnwitzig anmutende Zielvorgabe einer Eigenkapitalrendite von 25 Prozent. Zum Vergleich: Der 2023 erwirtschaftete Nettogewinn von 4,9 Milliarden Euro entsprach 6,7 Prozent des Eigenkapitals. Heute hat die Deutsche Bank die Investmentbanking-Sparte deutlich zurückgefahren und den riskanten Eigenhandel eingestellt. Stattdessen wurde der Fokus in den letzten Jahren sukzessive auf das Kreditgeschäft gelegt.
Fazit: Wir empfehlen unseren Lesern, immer wachsam zu bleiben, was die Entwicklungen am Derivatemarkt angeht. Die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Aber glauben Sie nicht jeder reißerischen Überschrift, die Sie zu diesem Thema in den Medien lesen. Man muss sehr genau hinschauen, um die abnormal wirkenden Zahlen vernünftig interpretieren zu können.