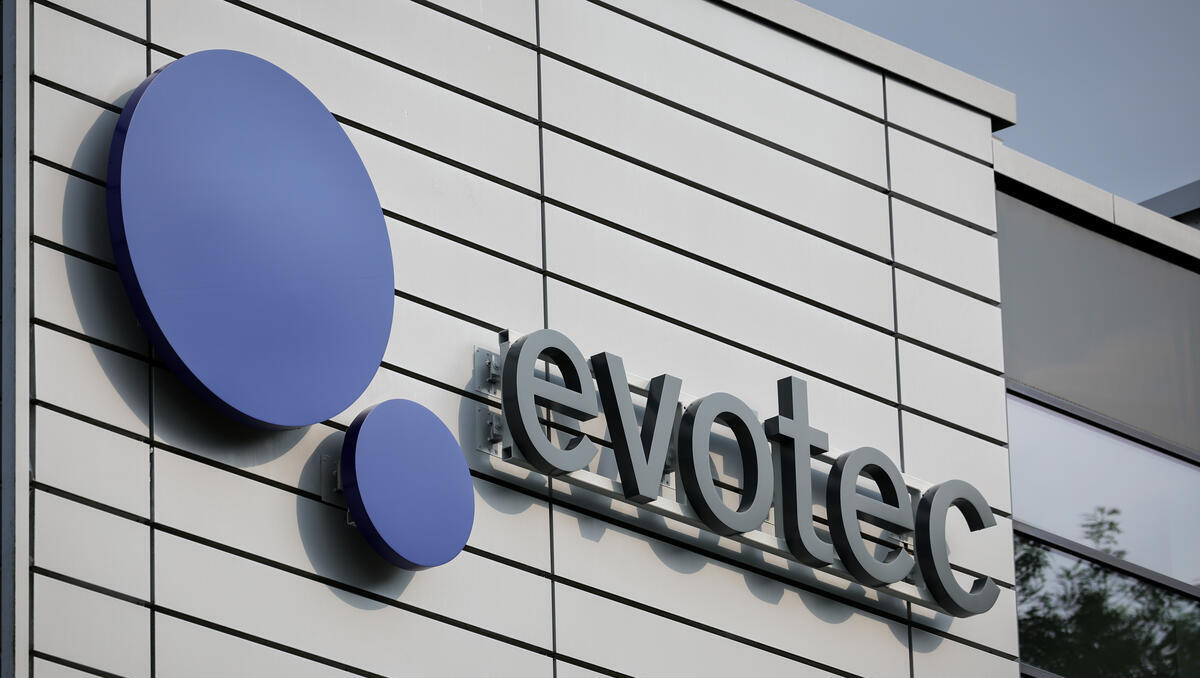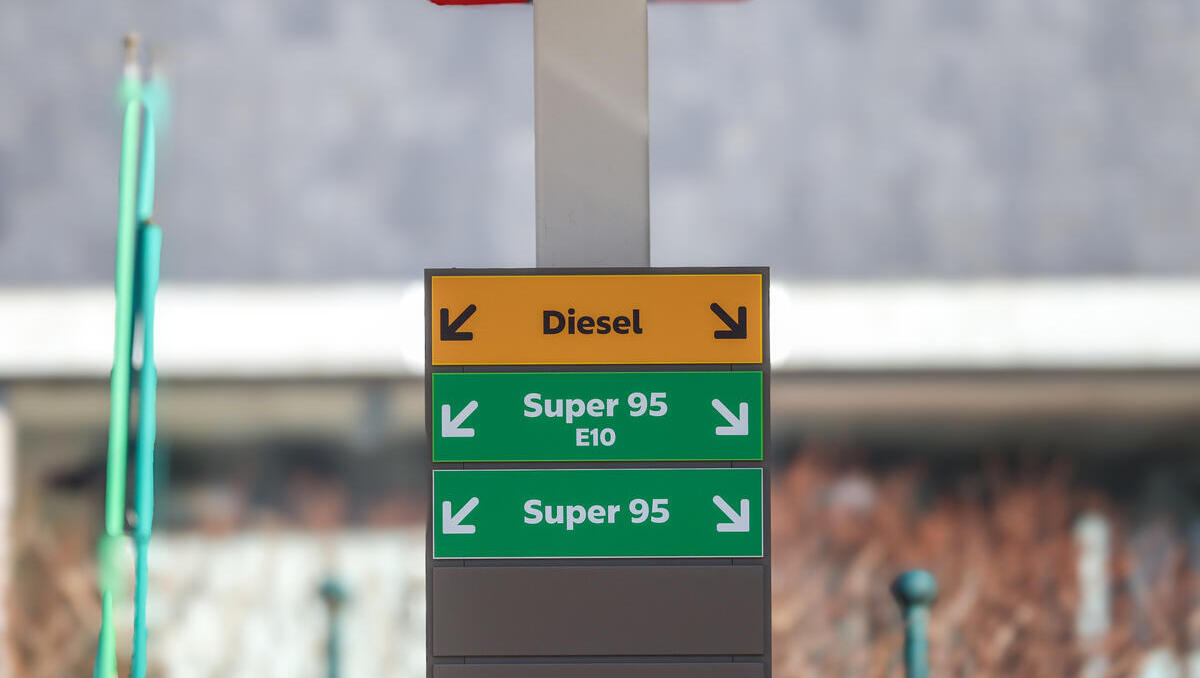Kurz entwickelte eine klare Grundlage für die Kritik an der Hypothese rationaler Erwartungen von John Muth und Robert Lucas und wies dabei stringent nach, dass man eine beliebige Anzahl von Modellen auf die historischen statistischen Daten anwenden kann, um ein Spektrum alternativer „rationaler Überzeugungen“ aufzuzeigen. Und jetzt geht er in seinem Buch The Market Power of Technology: Understanding the Second Gilded Age mit gleicher Stringenz der Frage nach, was das Einkommenswachstum und die Verteilung des Wohlstands in einer durch in privatem Eigentum stehende technologische Innovationen angetriebenen Wirtschaft bestimmt.
Kurz’ Theorie „technologischer Marktmacht“ unterscheidet zwischen auf Innovationen beruhenden rechtlich sanktionierten Monopolen und den Handel einschränkenden illegalen Absprachen. Er führt das Beispiel von General Electric an, das, beginnend in den 1890er Jahren, ein Jahrhundert lang ein Beispiel für fortdauernde technologische Marktmacht war. Eine erste Innovation, die die Wettbewerbsposition des Innovators stärkt, schafft Marktmacht, die wiederum Monopolgewinne generiert, welche in die Verfestigung und Ausweitung der Marktmacht investiert werden. Darüber hinaus lassen sich diese Monopolgewinne nutzen, um das Ausmaß, in dem der politische Prozess der akkumulierten Marktmacht entgegenwirken kann, zu beeinflussen, und dies ist auch zu beobachten.
Kurz stellt die Ansicht in Frage, dass jedes technologiebasierte Monopol zwangsläufig vergänglich ist und dem Schumpeterschen Prozess der „schöpferischen Zerstörung“ unterliegt. Sobald sich die Marktmacht verfestigt hat, so argumentiert er, seien gezielte staatliche Eingriffe das einzige Mittel zur Wiederherstellung eines sinnvollen Wettbewerbs. Dementsprechend schlägt Kurz ein radikales Reformprogramm vor, um Marktmacht dort zu beseitigen, wo sie besteht, und das Risiko ihres Wiederauftretens zu minimieren.
Die Umsetzbarkeit dieser Maßnahmen scheint angesichts der immensen politischen Macht der Monopolisten in den USA freilich begrenzt. Deren Reichweite geht noch über die Wahl- und Gesetzgebungspolitik hinaus und erstreckt sich auch auf die Justiz; man denke nur an den Erfolg der Federalist Society bei der Entwicklung einer ideologischen Basis für eine wirtschaftsfreundliche, regulierungsfeindliche Rechtsprechung. Wie auch Kurz bewusst ist, wird die Bekämpfung technologischer Marktmacht einen grundlegenden Wandel in der amerikanischen Politik erfordern.
Kurz’ Buch ist ein enorm wichtiger Beitrag zum wachsenden Korpus politisch-ökonomischer Veröffentlichungen (einschließlich einiger meiner eigenen Arbeiten), die versuchen, die komplexen, potenziell widersprüchlichen Dynamiken des demokratischen Kapitalismus bzw. der kapitalistischen Demokratie (entscheiden Sie die Reihenfolge gern selbst) zu verstehen. Seine Arbeit ragt dabei gleich in mehrfacher Hinsicht heraus.
Erstens bietet er formale mathematische Modelle an, um die Logik seiner Argumentation zu veranschaulichen und historische Daten zu befragen. Zweitens erlaubt es ihm seine Analyse, deterministische Schlussfolgerungen zu ziehen, wie z. B. sein Hauptargument, dass die historisch beobachtbare „Permanenz“ der Marktmacht aus dem Zusammenspiel von Technologie und Kapitalismus resultiert. Und drittens kommt er zu recht radikalen Schlussfolgerungen darüber, was notwendig ist, um der Marktmacht entgegenzuwirken.
Es ist nicht nötig, im Detail nachzuerzählen, wie Kurz seine These entwickelt. Er selbst hat die Argumente in einer Reihe von Project Syndicate-Kommentaren für ein fachfremdes Publikum übersetzt. Letztlich spricht er beobachtbare Fakten des wirtschaftlichen, technologischen und politischen Lebens an. Dennoch verdienen vier Bereiche seiner Analyse eine genauere Betrachtung.
Erstens stimmt sein quantifiziertes Profil der Entwicklung der Monopolgewinne gelegentlich nicht genau mit der politischen Geschichte überein, auf die er sich beruft. Zweitens schenkt er den finanziellen Dimensionen des Verhaltens etablierter Monopolisten nur wenig Aufmerksamkeit. Drittens zeichnet er in seiner Analyse und seinen Reformvorschlägen ein vereinfachtes Bild des Spannungsverhältnisses zwischen den erwarteten Gewinnen, die Anreize für Investitionen in Innovationen schaffen, und der Macht, die erfolgreiche Innovatoren durch die erzielten Gewinne erlangen, und behandelt Forschung und Entwicklung und die daraus resultierenden Innovationen zugleich als homogenes Amalgam. Und viertens zielt sein Angriff auf die Schumpetersche Wachstumstheorie auf einen Strohmann, den sowohl Joseph Schumpeter als auch spätere Wissenschaftler schon vor langer Zeit aufgegeben haben.
Die lange Sicht
Kurz gibt uns einen Abriss über die Geschichte technologisch bedingter Marktmacht ab dem Ende des 19. Jahrhunderts. Er nutzt dabei formale Modelle, um Monopolgewinne – die Erträge der Marktmacht – von den Erträgen aus physischem Kapital und Arbeit abzugrenzen. In dieser Berechnung werden alle Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung – Patente, Software, immaterielle Vermögenswerte – sowohl als Quelle als auch als Folge von Marktmacht betrachtet. Über die Kapitalisierung am Aktienmarkt werden Monopolgewinne (erweitert um die aktienbasierte Vergütung von Führungskräften) zu quantifizierbarem Monopolvermögen.
Anhand des Anstiegs und Rückgangs von Monopolgewinnen und Vermögen zeichnet Kurz dann den Anstieg und Rückgang der sich aus der technologischen Innovation ergebenden Marktmacht nach. Aber was ist mit dem anomalen Anstieg des errechneten Wertes während der Großen Depression? Die ausgewiesenen Unternehmensgewinne fielen 1931-33 deutlich ins Minus, bevor sie sich 1934-37 erholten, nur um dann 1938 erneut einzubrechen. Als Erklärung hierfür führt Kurz die von Präsident Franklin D. Roosevelt 1933 eingerichtete National Recovery Administration an, die einen fehlgeleiteten, unternehmensfreundlichen Weg zur Erholung durch Kartellbildung bot. Die NRA kam jedoch nie voll zum Einsatz, und der Oberste Gerichtshof erklärte sie 1935 für unwirksam (eine Entscheidung, die den New Deal vor einer erheblichen Blamage bewahrte).
Kurz bietet noch eine zweite Erllärung an, die mehr Biss hat. Er vermutet, dass angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Umstände nur die effizientesten Unternehmen überlebten und an dem Produktivitätsschub teilhaben konnten, den die Elektrifizierung der Industrie mit sich brachte. Dies ist jedoch nur ein Beispiel für das Problem, das sich ergibt, wenn man versucht, formale Modelle auf gelebte Geschichte anzuwenden.
Ein weiteres Problem ergibt sich, wenn Kurz das Ende des ersten Gilded Age mit dem Amtsantritt von Präsident Theodore Roosevelt im Jahr 1901 gleichsetzt. Die 20 Jahre der Progressiven Ära brachten zwar das „Trust-Busting“ und Verfassungsänderungen zur Einführung der Einkommenssteuer und der Direktwahl von Senatoren hervor, aber auch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs – Lochner gegen New York (1905) –, die die „Vertragsfreiheit“ über die Befugnis der Bundesregierung oder der Regierungen der Einzelstaaten zur Regulierung der Wirtschaft stellte. Außerdem folgten bald darauf die extrem wirtschaftsfreundlichen Regierungen von Warren Harding, Calvin Coolidge und Herbert Hoover.
Nichtsdestotrotz ist Kurz’ Analyse der Monopolgewinne provozierend in ihrem Versuch, eine quantitativ gestützte Geschichte der amerikanischen politischen Ökonomie zu konstruieren. Kurz stellt dabei die Existenz von Erträgen aus Marktmacht den Erträgen aus den Produktionsfaktoren der neoklassischen Produktionsfunktion gegenüber: Kapital und Arbeit. Hierbei entspricht der Kapitalertrag den Kosten für die Beschaffung der für die Produktion erforderlichen Anlagen und Ausrüstungen, während der Arbeitsertrag dem Lohn entspricht.
Am Ende des 19. Jahrhunderts (das erste Gilded Age) schöpften die Monopolgewinne nach Kurz’ Berechnung Erträge aus beiden Kategorien ab. Allerdings kommt Kurz aufgrund der späteren New-Deal-Reformen, die den Arbeitnehmern einen gewissen Schutz boten, zu dem Schluss, dass die Kapitaleigner unter dem neuerlichen Anstieg der Monopolgewinne seit 1980 relativ gesehen stärker gelitten haben als die Arbeitnehmer. Angesichts der Stagnation der realen (inflationsbereinigten) Medianlöhne im selben Zeitraum ist diese Feststellung überraschend.
Kurz weist auf einen weiteren Faktor hin, den man berücksichtigen muss: den Aufstieg und Niedergang der Gewerkschaften im privaten Sektor als potenzielle Quelle der Gegenmacht gegenüber technologisch mächtigen Monopolisten. Er beginnt jedoch mit einer irreführenden Aussage, wenn er behauptet, dass „die progressive Politik ... die wachsende Macht der Gewerkschaften unterstützte“. Obwohl es in den Jahren des extremen Arbeitskräftemangels während des Ersten Weltkriegs Bestrebungen gab, Industriearbeiter gewerkschaftlich zu organisieren, wurden diese Errungenschaften nicht gefestigt. Der große Stahlstreik von 1919 war im letzten Jahr der vermeintlich fortschrittlichen Regierung von Woodrow Wilson komplett gescheitert. Ab dem New Deal bestand dann allerdings eine inverse Korrelation zwischen der Einkommensungleichheit und dem Anteil der US-Haushalte mit mindestens einem Gewerkschaftsmitglied.
Der jedoch ist von fast 50 % zwischen dem Zweiten Weltkrieg und den 1950er Jahren auf nicht mehr als 15 % im letzten Jahrzehnt gesunken. Jüngste gewerkschaftliche Erfolge von General Motors bis Starbucks geben Anlass zur Hoffnung auf eine Wiederbelebung dieser strategisch wichtigen Institutionen. Die Tatsache, dass sie im Kontext einer ausdrücklich gewerkschaftsfreundlichen Regierung stattfanden, stützt Kurz’ Argument, dass nur die Macht des Staates der Marktmacht der Technologie entgegenwirken kann.
Entscheidungsmöglichkeiten
Die Führungskräfte an der Spitze von technologisch ermächtigten Monopolen haben immer die Wahl, wie sie den Cashflow einsetzen, unabhängig von seiner Quelle. Indem er sich darauf konzentriert, wie diese Gewinne in die Festigung und Ausweitung der Marktmacht investiert werden, vernachlässigt Kurz zwei gegenläufige Alternativen. Erstens konkurrieren die Geschäftsbereiche, die die etablierte Marktmacht ausnutzen, mit Investitionen zur Erforschung des Potenzials neuer Technologien um zusätzliche Ressourcen.
Im Rahmen meiner Beziehung zum Palo Alto Research Center (PARC) beobachtete ich seit Anfang der 1980er Jahre, wie Xerox, die Muttergesellschaft von PARC, wiederholt Geschäftspläne ablehnte, mit denen die phänomenalen Erfindungen des Labors auf den Markt gebracht werden sollten. Damit vernachlässigte das Unternehmen ungewollt eine einzigartige Gelegenheit, die Revolution der Personal Computer anzuführen. Das Problem bestand darin, dass PARC, ein risikoreiches Unternehmen, mit den nahezu sicheren Erträgen konkurrieren musste, die sich aus der Investition gleicher Summen in die Ausweitung des patentgeschützten Kopierergeschäfts von Xerox ergaben (z. B. durch Einstellung zusätzlicher Vertriebsmitarbeiter oder Außendiensttechniker).
Etwas Ähnliches geschah mit IBM. Ende der 1980er Jahre war das Unternehmen bereits seit einer Generation die dominierende Kraft im Bereich der digitalen Datenverarbeitung und baute seine frühere Monopolstellung bei Rechenmaschinen weiter aus. Doch das Unternehmen und auch seine weniger erfolgreichen Wettbewerber nutzten sämtlich vertikal integrierte, geschlossene, proprietäre Systeme, die untereinander völlig inkompatibel waren. Von der Software, die den physischen Computer verwaltete, bis hin zur Software, die die Anwendungen an die Kunden lieferte, war alles im eigenen Format und in der eigenen Sprache des jeweiligen Unternehmens kodiert.
Dieser Ansatz sicherte ihnen eine Zeit lang einen stetigen Fluss von Monopolgewinnen, da die Kunden an die Umgebung ihrer Lieferanten gebunden waren. Anfang der 1980er Jahre begann sich jedoch eine radikal andere Architekturvision durchzusetzen. Standardsprachen und -protokolle begannen sich von den wissenschaftlichen Forschungslabors zu den neuen, mit Wagniskapital finanzierten Start-ups zu verlagern, von denen viele vom US-Verteidigungsministerium finanziell unterstützt wurden. Anfänglich waren diese vernetzten „Client/Server“-Systeme für wissenschaftliche und technische Nischenmärkte bestimmt. Aber für jeden, der aufmerksam war, zeichnete sich ihr Potenzial, auf den weitaus größeren, von IBM beherrschten kommerziellen Märkten zu konkurrieren, bereits 1990 deutlich ab.
Die Verantwortlichen von IBM gehörten nicht zu denen, die aufpassten. Im August 1988 stellte das Unternehmen die Apotheose seiner proprietären Technologie, die AS/400, vor. Bis Ende 1990 hatte es 110.000 Systeme ausgeliefert und mindestens 14 Milliarden Dollar Umsatz und 10 Milliarden Dollar freien Cashflow erwirtschaftet. Kein risikoreicher Ausflug in die neue Welt des verteilten Rechnens konnte innerhalb des Unternehmens hoffen, von der Geschäftsleitung substanziell unterstützt zu werden.
Damit war der Weg frei für von Wagniskapitalgebern finanzierte Start-ups, die sich die Tatsache zunutze machen wollten, dass sich lokale Netze zu Weitverkehrsnetzen wandelten – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Internet selbst. Beim Wagniskapitalunternehmen Warburg Pincus verfolgte ich in den 1990er Jahren eine breite Palette von Investitionsgelegenheiten, die darauf zielten, den Kontrollverlust von IBM über die kommerzielle Datenverarbeitung zu beschleunigen. Diese Art von endogener negativer Rückkopplungsschleife, bei der ein etablierter Marktteilnehmer davon abgehalten wird, in Innovationen zu investieren, die seine Marktmacht in Frage stellen könnten, liegt außerhalb des Rahmens von Kurz’ Arbeit.
Das Gleiche gilt für die andere alternative Verwendung von überschüssigem Kapital: den Rückkauf eigener Aktien des Unternehmens. Vor 1982 untersagte die US-Börsenaufsicht SEC Aktienrückkäufe, da sie diese Praxis als eine mögliche Form der Marktmanipulation ansah. Durch eine Regeländerung in jenem Jahr wurde die Praxis jedoch legalisiert und hat sich seitdem weit verbreitet. Im Jahr 2022, dem letzten vollständigen Jahr, für das Daten verfügbar sind, kauften die S&P 500-Unternehmen Aktien im Wert von 923 Milliarden Dollar zurück. Das war deutlich mehr als die Ausgaben der Unternehmen für Forschung und Entwicklung jenes Jahres, die sich nach Schätzungen der National Science Foundation auf 673 Milliarden Dollar beliefen.
Die Finanzialisierung der unternehmerischen Entscheidungsfindung war nicht der einzige Faktor, der beim Niedergang der großen industriellen Forschungslabors (AT&Ts Bell Labs, IBMs Yorktown Heights, RCAs Sarnoff Labs und DuPont Central Research) eine Rolle spielte. Wie Kurz feststellt, wurde dieser Prozess durch die zunehmende Vergütung der Führungskräfte mit Aktien und die Erhebung des Shareholder Value zum einzigen Kriterium für die Bewertung der Unternehmenspolitik noch verstärkt.
Die Ironie besteht darin, dass Kurz’ Paradebeispiel GE von dem diese Doktrin personifizierenden Jack Welch faktisch kaputtgemacht wurde. Walshs Konzentration auf Finanzdienstleistungen ermöglichte nicht nur die Manipulation der ausgewiesenen Gewinne, sondern setzte GE auch der globalen Finanzkrise von 2008 aus. In jüngerer Zeit zeigt der Niedergang und fortdauernde Absturz von Boeing die Folgen der Finanzialisierung für einen ehemaligen technologischen Vorreiter.
Warum innovativ sein?
In Innovation zu investieren bedeutet ins Unbekannte zu investieren. Es besteht dabei nicht nur ein technologisches Risiko („Leuchtet es auf, wenn man es einsteckt?“), sondern auch ein Marktrisiko („Wenn es aufleuchtet, wird das jemanden interessieren?“). Was also sollte ein Unternehmen dazu veranlassen, derartige Investitionen zu tätigen? Natürlich die Aussicht auf Monopolgewinne. Diese können zumindest für eine gewisse Zeit durch gesetzliche Patente, die wirksame Durchsetzung von Geschäftsgeheimnissen oder monopolistische Marktmacht gestützt werden.
In der Analyse von Kurz geht das Fortbestehen der Marktmacht über die Lebensdauer eines einzelnen Monopolisten hinaus, so lang diese auch sein mag. Die entscheidende Erkenntnis ist, dass Innovation von der ständigen Verfügbarkeit von Marktmacht als notwendigem Anreiz für Investitionen in Forschung und Entwicklung abhängt.
Kurz erkennt an, dass das Aufkommen einer neuen „Universaltechnologie“ wie der Elektrifizierung, des Verbrennungsmotors oder der Computertechnik das Spielfeld neu ebnen und neuen Marktteilnehmern Wettbewerbsmöglichkeiten eröffnen kann. Aber die etablierten Unternehmen können sich in solchen Momenten erneuern, vorausgesetzt, sie widerstehen den negativen Fehlanreizen, die IBM und Xerox als Technologieführer zerstört haben. In einem Kommentar für Project Syndicate vom Dezember 2023 weist Kurz nach, dass 25 % des gesamten 2019 auf dem US-Aktienmarkt kapitalisierten Monopolvermögens von Unternehmen geschaffen wurde, die älter als 100 Jahre sind.
Es gibt jedoch gegenläufige Belege für Fluktuationen an der Spitze der Unternehmenshierarchie. Vor sechs Jahren berichtete McKinsey & Company, dass „1935 die Lebenserwartung eines S&P 500-Unternehmens 90 Jahre betrug. Im Jahr 2010 lag sie bei 14 Jahren.“ Derzeit sind von den 30 Unternehmen des Dow Jones Industrial Average 22 nach 1990 hinzugekommen. Großen Einfluss hatte in den letzten Jahrzehnten der Aufstieg professioneller Wagniskapitalgeber: Von den 300 größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung wurden 88, die alle nach 1980 gegründet wurden, wurden von US-Wagniskapitalfonds unterstützt. Im Jahr 2020 entfielen auf durch Wagniskapitalgeber finanzierte US-Unternehmen 244 Milliarden Dollar an Forschungs- und Entwicklungsausgaben; das sind 46 % der nationalen Gesamtausgaben im öffentlichen, privaten und wissenschaftlichen Sektor.
Darüber hinaus sind die Möglichkeiten der Unternehmen, die Erträge aus ihren riskanten Investitionen zu vereinnahmen, begrenzt. Vor mehr als 60 Jahren stellten Arrow und ein anderer renommierter Wirtschaftswissenschaftler, Richard Nelson, ergänzende theoretische Überlegungen an, wonach durch Forschung generierte Informationen als nichtrivalisierendes Gut unweigerlich nach außen dringen und von Konkurrenten genutzt werden. Neuere Forschungen zeigen, dass der gesellschaftliche Nutzen von Spillover-Effekten im Bereich der Forschung und Entwicklung den vom investierenden Unternehmen erzielten privaten Nutzen um mehr als das Vierfache übersteigt. Mit anderen Worten: Es besteht ein (in mancher Hinsicht positives) Spannungsverhältnis zwischen dem Anreiz zur Innovation und den Folgen.
In seinem Buch führt Kurz modellbasierte Simulationen durch, um die Dynamik von Investitionen in Forschung und Entwicklung, Produktivität und Monopolisierung zu untersuchen. Er zeigt, dass hohe Produktivität eine Funktion des Forschungs- und Entwicklungsbestands ist, der es (ohne staatliche Eingriffe) ermöglicht, dass inkrementelle private Investitionen in Innovationen den Grad der Monopolisierung unbegrenzt erhöhen können.
Daraus folgt, dass der Staat den Anteil eines einzelnen Unternehmens am nationalen Forschungs- und Entwicklungsbestand streng begrenzen sollte; bei Erreichen dieser Grenze sind zusätzliche Investitionen des Unternehmens in Forschung und Entwicklung verboten. Dies ist die radikalste der Reformen, die sich aus Kurz’ Modellierung ergeben, auch wenn sie in seinen Kapiteln über konkrete politische Reformen gar nicht erwähnt wird.
Zu seinen weiteren Vorschlägen gehören Änderungen des Patent- bzw. Kartellrechts, um wettbewerbszerstörende „Patentdickichte“ und Übernahmen potenzieller Wettbewerber durch Marktführer zu bekämpfen. Allerdings könnten derartige Reformen unbeabsichtigte Folgen haben. Ein wirksames Verbot von Übernahmen durch die Tech-Giganten würde sich beispielsweise auf die Welt der Wagniskapitalgeber und Start-up-Unternehmer auswirken. Kurz äußert völlig zu Recht, dass die vier Jahrzehnte währende Aussetzung der Durchsetzung des Kartellrechts seit Beginn der Reagan-Regierung es Technologieführern ermöglichte, Hunderte von Unternehmen, darunter auch potenzielle Konkurrenten, zu übernehmen, was zu Festigung ihrer marktführenden Stellung beigetragen hat. Doch hat diese Medaille auch eine Kehrseite.
Schließlich müssen willige Käufer auch willige Verkäufer finden. Etwa 80-90 % der erfolgreichen Ausstiege von Wagniskapitalgebern werden durch den Verkauf des Unternehmens an andere, größere Firmen realisiert. Die Aussicht auf eine Übernahme ist daher ein entscheidender Anreiz für die Finanzierung von Start-ups, einschließlich solcher, die fortschrittliche wissenschaftliche Erkenntnisse aus Universitätslabors vermarkten. Wird dieser Renditekanal für Unternehmer und ihre Kapitalgeber geschlossen, wird dies die Innovation zwangsläufig behindern.
Kurz schlägt außerdem Steuerreformen vor, die zwischen den Erträgen aus physischem Kapital und den durch die Marktmacht entstehenden Monopolrenten unterscheiden würden. Dabei ist er sich der negativen Auswirkungen, die eine derartige Steuer auf die Belohnung erfolgreicher Innovationen auf künftige Investitionen in Forschung und Entwicklung haben kann, durchaus bewusst.
Zu guter Letzt schlägt Kurz als direkten Angriff auf die extreme Vermögensungleichheit in den USA vor, das zweite Wohlfahrtstheorem zu operationalisieren. Dieses fundamentale Theorem der Wohlfahrtsökonomie besagt, dass die sozial effizienteste Lösung in einer wettbewerbsorientierten Wirtschaft darin besteht, dass die Gewinner die Verlierer entschädigen können (auch wenn sie dies historisch gesehen selten tun). Zu diesem Zweck würde er eine vorübergehende Vermögenssteuer erheben, um einen Nationalen Fonds für Gerechtigkeit und Demokratie zu finanzieren. Dies käme einem riesigen Staatsfonds gleich, dessen Erträge in Gesundheits- und Bildungsprogramme sowie in staatlich finanzierte Forschung und Entwicklung fließen würden.
Welcher Schumpeter?
Das bringt uns zu Kurz’ Angriff auf das Schumpetersche Denken. Hier richtet er seine Kritik auf einen Slogan – schöpferische Zerstörung – und nicht auf die Schumpetersche Wachstumstheorie in ihrer ausgereiften und weiterentwickelten Form. Er greift Schumpeters ursprüngliche Formulierung seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung an, wie sie 1912 erschien, als Schumpeter den Unternehmer als Motor der schöpferischen Zerstörung identifizierte:
„Der grundlegende Impuls, der den Motor des kapitalistischen Prozesses in Gang setzt und in Gang hält, kommt von den neuen Konsumgütern, den neuen Produktions- und Transportmethoden, den neuen Märkten, den neuen Formen der industriellen Organisation, die das kapitalistische Unternehmen schafft ... Dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist die wesentliche Tatsache des Kapitalismus ... Wir werden davon ausgehen, dass Innovationen immer mit dem Aufstieg neuer Männer an die Spitze verbunden sind.“
Diese Version wird allgemein als „Schumpeter Mark I“ bezeichnet. Doch 1942 schlug Schumpeter ein ganz anderes Modell vor, das Kurz sogar vorwegnimmt. Bei „Schumpeter Mark II“ heißt es:
„Der technologische Fortschritt wird immer mehr zu einer Angelegenheit von Teams ausgebildeter Spezialisten, die das, was benötigt wird, auf vorhersehbare Weise herstellen und zum Laufen bringen ... Der perfekt bürokratisierte Industriegigant verdrängt nicht nur den Klein- oder Mittelbetrieb und ‚enteignet‘ seine Eigentümer, sondern verdrängt letztlich auch den Unternehmer ...“ (meine Hervorhebung).
Darüber hinaus könnte Kurz erfreut sein, zu erfahren, dass Philippe Aghion von der London School of Economics und Peter Howitt von der Brown University, die führenden Schumpeterianer der letzten 30 Jahre, vor kurzem den Zustand der US-Wirtschaft bewertet haben und zu dem Schluss gekommen sind, dass die Marktführer in der Tat so weit voraus sein könnten, dass sie alle Herausforderer abschrecken. Aghion und Howitt bekräftigen zwar, dass Marktführer unter den Bedingungen eines „Kopf-an-Kopf“-Wettbewerbs ihren Anreizen folgen werden, um energisch zu konkurrieren, weisen aber ebenso wie Kurz auf Fälle hin, „in denen ein erfolgreicher etablierter Marktteilnehmer dem Wettbewerb mit potenziellen Konkurrenten entgeht, indem er seinen Reichtum und seine Macht dazu nutzt, Innovationen dieser Konkurrenten mit verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Mitteln zu blockieren oder zunichtezumachen“.
Sie erläutern dann sowohl die Mittel, mit denen Marktführer den Wettbewerb unterdrücken –Taktiken, die denen, die Kurz beschreibt, verblüffend ähnlich sind – und verweisen auf die wachsende Zahl empirischer Untersuchungen, die diese Dynamik in der US-Wirtschaft identifiziert haben.
Die Entwicklung des Schumpeterschen Modells ist auch hier nicht stehen geblieben. Ein neuer Rahmen – „Schumpeter Mark III“ – konzentriert sich auf die „innovative Arbeitsteilung“ (wie sie von Wissenschaftlern der Duke University dokumentiert wurde), die zu einem zentralen Motor der US-Innovationswirtschaft geworden ist. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Forschung und Entwicklung nicht immer gleich ablaufen und dass nicht alle Innovationen einem homogenen Typ angehören. Es gibt eine umfangreiche wissenschaftliche Literatur über die Unterscheidung zwischen „explorativer“ und „verwertender“ Forschung und Entwicklung. Erstere ist der typische Schwerpunkt kleiner, wachsender Unternehmen, während Letztere die Domäne etablierter Unternehmen ist.
Laut einem Arbeitspapier aus dem Jahr 2022 ist die Wahrscheinlichkeit bei Patenten, die von Start-ups angemeldet werden, „um etwa 40 % höher, dass es sich um ‚Outlier-Erfindungen‘ in den obersten 5 % der Zitierverteilung handelt“. Darüber hinaus wird in einem Aufsatz aus dem Jahr 2023 festgestellt, dass die Produktivität von Erfindern, die von etablierten Unternehmen aus jungen Firmen abgeworben werden, mit steigender Vergütung abnimmt:
„Zusammengenommen deuten diese Schätzungen darauf hin, dass Erfinder, die bei etablierten Unternehmen angestellt sind oder von ihnen eingestellt werden, im Vergleich zu Erfindern in jungen Unternehmen ein höheres Einkommen und eine geringere Erfindungsleistung, weniger Anmeldungen, weniger Zitierungen und Zitierungen pro Anmeldung, Patente mit begrenzterem Anwendungsbereich und eine höhere Selbstzitierungsrate aufweisen.“
Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass der Begriff „Wagniskapital“ im Stichwortverzeichnis von Kurz’ Buch nicht auftaucht.
Seid realistisch, verlangt das Unmögliche
Kurz’ Arbeit über die Marktmacht der Technologie ist gründlich recherchiert und stringent ausgearbeitet. Seine Methoden, Theorie und Daten zusammenzubringen, sind aussagekräftig und oft überzeugend, und Gleiches gilt für sein Argument, dass ein wirtschaftlich engagierter Staat die einzige Quelle von Gegenmacht gegen technologisch verankerte Monopolisten bleibt. Die schiere Radikalität seiner vorgeschlagenen Reformagenda folgt unmittelbar aus dieser Schlussfolgerung.
Unter der Regierung von Präsident Joe Biden könnten einige seiner Vorschläge, nicht zuletzt eine stärkere Durchsetzung der bestehenden Kartellgesetze, sogar umsetzbar sein. Darüber hinaus wird seine Analyse dazu beitragen, die Doktrin von der „ökonomischen Analyse des Rechts“ in Frage zu stellen, die Jurastudenten (mit starker Unterstützung der Federalist Society) ständig eingetrichtert wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Agenda negative Rückkopplungen auf die Innovation in der Start-up-Branche auslöst, verdient jedoch eine genauere Betrachtung.
In jedem Fall liegen die meisten seiner Vorschläge jenseits des derzeitigen „Overton-Fensters“ politischer Akzeptanz. Selbst relativ bescheidene Reformen des Patentrechts zur Begrenzung der Laufzeit von „sekundären“ und erworbenen Patenten auf die Hälfte der derzeitigen 20-jährigen Laufzeit scheinen keinen Erfolg zu versprechen.
Es gibt zwar einige Präzedenzfälle für die von Kurz vorgeschlagenen Steuererhöhungen, aber sie reichen bis zu den extremen Bedingungen der Großen Depression und des Zweiten Weltkriegs zurück, obwohl die Grenzsteuersätze für die höchste Einkommensgruppe bis weit in die 1980er Jahre hinein bei über 50 % lagen. Bidens Vorschlag, Unternehmen und wohlhabende Amerikaner „ihren gerechten Anteil“ zahlen zu lassen, würde den Spitzensteuersatz lediglich von 37 % auf 39,6 % anheben, wo er vor den Steuersenkungen der Trump-Regierung aus dem Jahr 2017 lag.
Die Umsetzung selbst dieser Änderungen (sowie das Schließen von Schlupflöchern) würde nicht nur Bidens Wiederwahl, sondern auch solide demokratische Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses erfordern. Unabhängig von den sozial nützlichen Ausgaben, die durch Kurz’ Nationalen Fonds finanziert werden sollen, ist die zur Finanzierung vorgeschlagene Vermögenssteuer in den heutigen USA politisch unvorstellbar.
Aber zu sagen, dass Kurz’ Vorschläge derzeit unrealistisch sind, geht wohl am Thema vorbei. Ein solcher Radikalismus unterstreicht die Macht der technisch-wirtschaftlichen Maschine, die er analysiert und angreift. Diese Macht zu einem Thema der öffentlichen Debatte zu machen ist der erste Schritt, um das Overton-Fenster akzeptabler Regierungspolitik zu verschieben und etwas frische Luft hereinzulassen.
Copyright: Project Syndicate, 2024.
www.project-syndicate.org