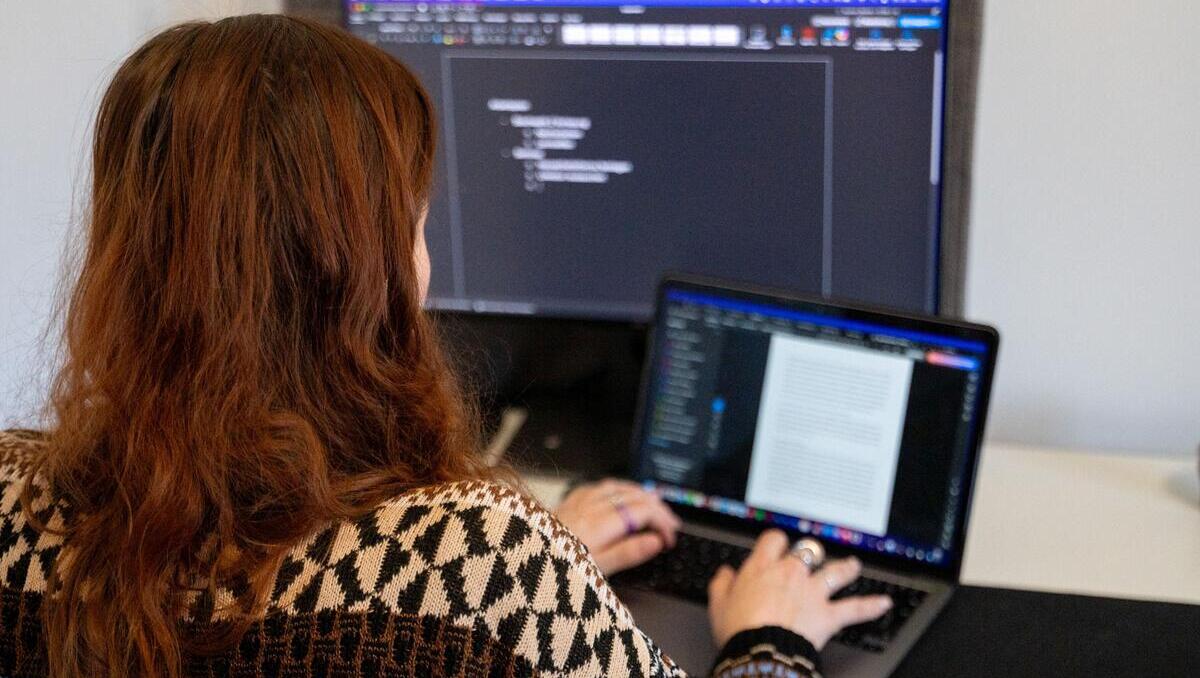Zwei Pfennig entsprachen einst nur einem Cent. Doch selbst kleine Beträge summieren sich. Ab dem 1. Januar 1950 musste auf nahezu allen Briefen und Postkarten zusätzlich zum Porto die blaue Steuermarke „Notopfer Berlin“ für zwei Pfennig angebracht werden. Da Post damals ähnlich alltäglich war wie heute WhatsApp oder SMS, kamen beträchtliche Summen zusammen. Die Marke erreichte laut der Museumsstiftung Post und Telekommunikation eine beeindruckende Auflage von mindestens 170 Milliarden Stück.
75 Jahre später ist das „Notopfer Berlin“ fast in Vergessenheit geraten. Damals jedoch war diese Sondersteuer eine entscheidende Stütze für Westberlin. Rückblickend könnte sie als Vorläufer späterer Abgaben im Nachkriegsdeutschland gesehen werden – darunter die „Ergänzungsabgabe“ der 1950er-Jahre, der „Konjunkturzuschlag“ oder die „Stabilitätsabgabe“ der 1970er-Jahre. Nicht zu vergessen: der Solidaritätszuschlag. Ähnlich wie dieser blieb das „Notopfer Berlin“ länger bestehen, als ursprünglich geplant.
Ursprung in der Berlin-Blockade
Die Einführung der Abgabe begann 1948 zur Finanzierung der Berliner Luftbrücke während der Blockade durch die Sowjetunion. „Die Stadt war zerstört, die Einwohner hungerten und waren vom Umland abgeschnitten“, erklärt Hermann Wentker vom Institut für Zeitgeschichte in Berlin. „Für die notwendigen Importe nach Berlin war diese Finanzierung essenziell.“
Das „Notopfer Berlin“ bestand aus zwei Teilen: einem Einkommensteuerzuschlag und der sichtbaren blauen Marke für Postsendungen. Letztere wurde Ende 1948 in der britischen und amerikanischen Zone eingeführt und teilweise auch in der französischen Zone genutzt. Ab Januar 1950 galt das Gesetz deutschlandweit, obwohl die Blockade 1949 beendet worden war.
Finanzielle Hilfe für den Bund
Für die neue Bundesrepublik stellte das „Notopfer Berlin“ eine äußerst lukrative Einnahmequelle dar. „Die Notlage Berlins bestand weiterhin“, erklärt Wentker. Zudem verfügte der Bund über begrenzte eigene Mittel, da die Aufteilung von Einkommen- und Körperschaftssteuern zwischen Bund und Ländern erst 1955 geregelt wurde. Daher griff man gern auf diese Einnahmequelle zurück.
Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums stiegen die Einnahmen von 29 Millionen Mark (etwa 15 Millionen Euro) im Jahr 1948 auf mehr als eine Milliarde Mark in den Jahren 1954 bis 1956. Bis zur Abschaffung Ende 1957 erzielte das „Notopfer Berlin“ knapp 7,3 Milliarden Mark (etwa 3,7 Milliarden Euro). Selbst danach flossen durch Prüfungen und Verfahren weitere Beträge in die Kasse.
Geplante Befristung von drei Monaten
Bereits damals wurde Kritik laut, wie man sie heute vom Solidaritätszuschlag kennt: zu hoch und zu lang. „Als das Notopfer im November 1948 eingeführt wurde, war es zunächst auf drei Monate beschränkt“, schrieb der Wirtschaftswissenschaftler Willi Albers. „Inzwischen sind sechs Jahre vergangen, und die Abgabe existiert noch immer.“
Trotzdem gab es wenig politischen Widerstand in der Ära Adenauer. Die westdeutschen Parteien waren sich einig, Westberlin inmitten der DDR zu halten.
Belastung für Arbeitnehmer
Die Kommunistische Partei Deutschlands kritisierte die Zwangsabgabe vehement. „Die Lohn- und Gehaltsempfänger werden stark belastet, um den Kalten Krieg zu finanzieren“, sagte KPD-Abgeordneter Friedrich Rische 1949 im Parlament. Ostberlin missfiel die Abgabe ebenfalls. Briefe mit der Steuermarke wurden zurückgesandt, versehen mit dem Vermerk „Steuermarke unzulässig“.
Heute erfreut sich die Marke bei Sammlern großer Beliebtheit. Laut den Jungen Briefmarkenfreunden Berlin und Brandenburg sind Rücksendevermerke besonders gefragt. Seltene Exemplare der 2-Pfennig-Marke erzielen online Preise von über 1.000 Euro.