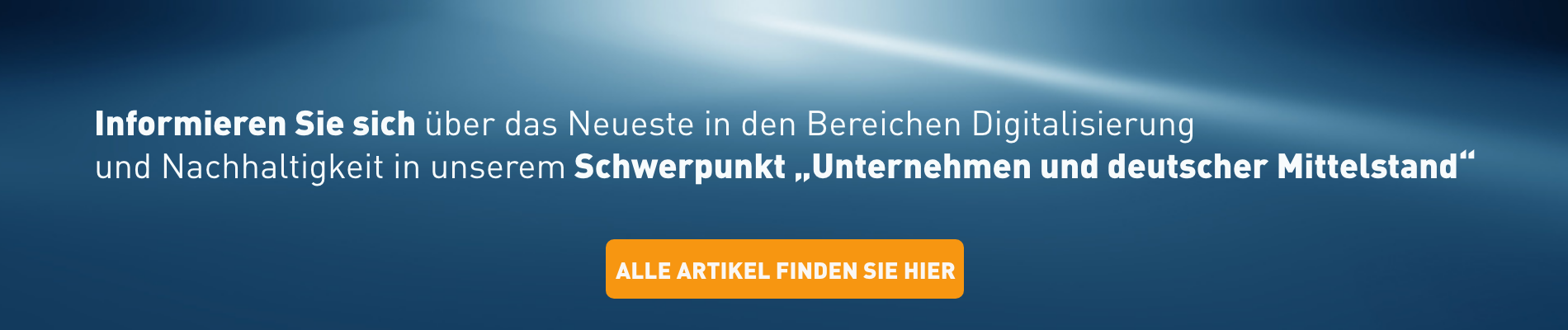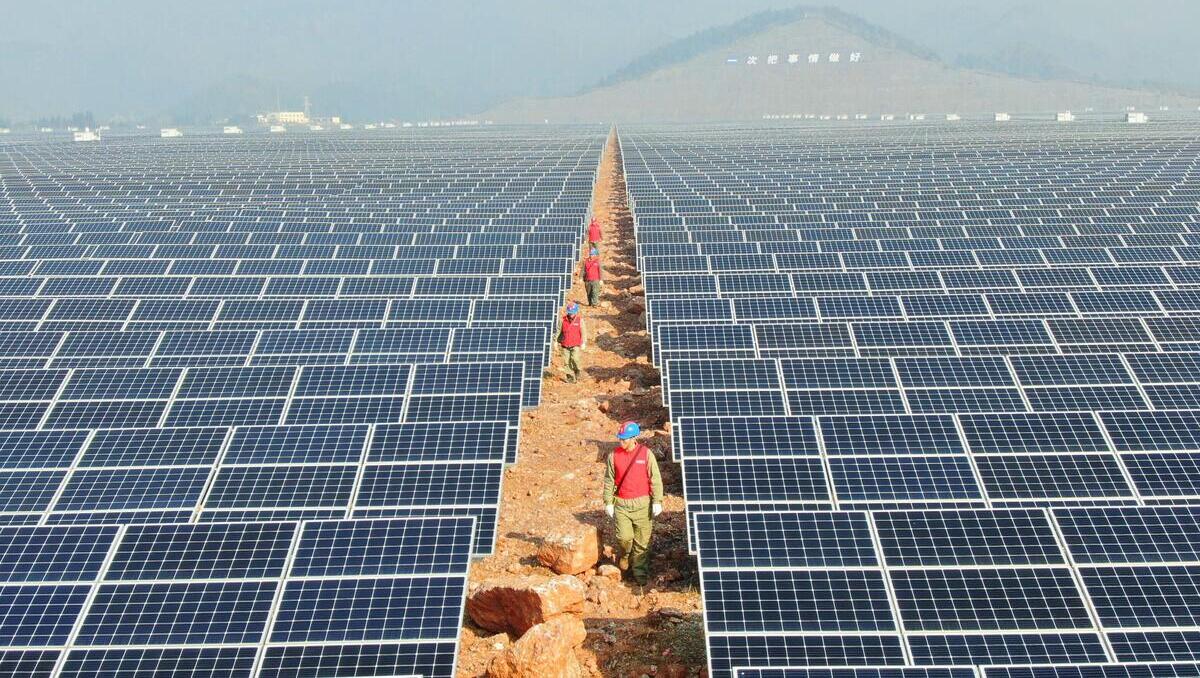Möglichkeiten zur Revitalisierung
Wie kann sich Deutschland aus seiner derzeitigen misslichen Lage befreien? Ein offensichtlicher Ansatzpunkt ist die Überwindung der Produktivitätslücke gegenüber den Vereinigten Staaten. Diese Lücke ist keine neue Entwicklung: In den letzten 20 Jahren hat das Produktivitätswachstum in den USA das deutsche durchschnittlich einen Prozentpunkt pro Jahr überholt.
Die Produktivitätslücke hat sich in den letzten Jahren vergrößert, da die USA in Bereichen wie KI, digitale Infrastruktur und hochwertige Dienstleistungen große Fortschritte gemacht haben. Im Jahr 2024 setzten nur 20 % der deutschen Unternehmen KI ein, verglichen mit mehr als 35 % in den USA Kleine und mittlere Unternehmen (der Mittelstand) - die lange Zeit als Rückgrat der deutschen Wirtschaft galten - fallen aufgrund finanzieller und technischer Hindernisse noch weiter zurück.
Obwohl Regierungsinitiativen versucht haben, den technologischen Wandel in Deutschland zu beschleunigen, liegt das Land bei den meisten Indikatoren des Digital Economy and Society Index für die digitale Infrastruktur immer noch hinter dem EU-Durchschnitt zurück. Die Breitbandabdeckung ist nach wie vor begrenzt, insbesondere in ländlichen Gebieten, und die Investitionen in die Digitalisierung und Ausbildung sind unzureichend.
Diese Lücke zu schließen, stellt eine große Chance für Deutschland dar, da KI und digitale Infrastruktur dazu beitragen könnten, die Produktivität zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Um künftiges Wachstum zu fördern, müssen deutsche Unternehmen und politische Entscheidungsträger ihren Fokus von traditionellen Industrien wie Chemie und Automobilbau auf aufstrebende Sektoren wie die Biowissenschaften verlagern. Neben dem Ausbau des Breitbandzugangs wird eine gezielte Unterstützung - insbesondere für KMU - entscheidend sein, um die Einführung von KI und anderen fortschrittlichen Technologien zu erleichtern.
Auch die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes sollte höchste Priorität haben. Die Einrichtung standardisierter Behördenplattformen, wie z.B. ein einheitliches Gewerbemeldesystem in den 16 Bundesländern, könnte bürokratische Prozesse verschlanken, wovon sowohl Haushalte als auch Unternehmen profitieren und Investitionsanreize verstärkt werden. Dies gilt auch für die Digitalisierung von Anträgen und Planungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte. Ohne diese Maßnahmen läuft Deutschland Gefahr, im weltweiten Wettlauf um die technologische und wirtschaftliche Führung an Boden zu verlieren.
Letztlich werden technologische Innovation und Wirtschaftswachstum eher von jüngeren Unternehmen vorangetrieben. Und dies unterstreicht ein grundlegendes deutsches Manko: Während das Land sein Ökosystem für Start-ups deutlich verbessert hat und Unternehmen in ihren Anfängen effektiv fördert, kann es sie nicht halten, wenn sie wachsen.
Um sich zu einem global wettbewerbsfähigen Unternehmen zu entwickeln, benötigen Start-ups erhebliche finanzielle Mittel, Zugang zu internationalen Märkten und ein günstiges Geschäftsumfeld. Während die Frühphasenfinanzierung seit 2007 zugenommen hat, bleibt die Finanzierung in der Spätphase eine große Hürde. Nur 4 % der deutschen Start-ups schaffen es, sich zu vergrößern, im Vergleich zu 9 % in den USA. Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche Transaktionsgröße in Europa bei etwa 8 Millionen Euro, während sie in den USA bei fast 14 Millionen Euro lag, und im Jahr 2019 waren an mehr als 40 % der Finanzierungsrunden europäischer Unternehmen mindestens ein ausländischer Investor beteiligt. Während Kapitalzuflüsse - insbesondere für die Finanzierung in der Spätphase - unerlässlich sind, erhöht ein übermäßiger Rückgriff auf ausländische Risikokapitalgeber das Risiko, dass Unternehmen ihre Gewinne im Ausland behalten oder in andere Märkte verlagern und ihre Innovationen, Arbeitsplätze und ihr wirtschaftliches Potenzial mitnehmen.
Die Vorteile der europäischen Integration
Um zu gewährleisten, dass Startups wachsen können, ohne auf ausländische Investoren angewiesen zu sein, muss Deutschland einen inländischen Risikokapitalmarkt für die Wachstumsfinanzierung fördern, Anreize für private Investitionen schaffen und gezielte Maßnahmen ergreifen, um Startups mit hohem Potenzial zu halten. Wenn wir nicht handeln, riskieren wir, diese Unternehmen zu verlieren und Deutschlands Position als Innovationsstandort in einem zunehmend wettbewerbsorientierten globalen Markt zu untergraben.
Der Aufbau eines EU-weiten Risikokapitalmarktes ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung und erfordert konzertierte Anstrengungen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene, insbesondere wenn es um die Finanzierung in der Spätphase geht. Der Prozess sollte die Mobilisierung von Ressourcen durch Institutionen wie den Europäischen Investitionsfonds (EIF) und die European Tech Champions Initiative (ETCI) beinhalten. Öffentliche Investitionen können zwar dazu beitragen, die Finanzierung in der Spätphase zu unterstützen, sollten aber eine größere Flexibilität und ein besseres Risikomanagement ermöglichen, indem sie sich auf indirekte Investitionen durch Risikokapitalfonds konzentrieren. Dies würde sicherstellen, dass die Investitionen durch das Fachwissen und die Marktkenntnisse erfahrener Fondsmanager gelenkt werden.
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten ist unerlässlich. Derzeit beschränkt die Fragmentierung der europäischen Kapitalmärkte die Investitionsströme und schränkt die Möglichkeiten der Regierungen ein, Start-ups und Scale-ups zu unterstützen. Ein Haupthindernis ist die Uneinheitlichkeit der nationalen Insolvenzregelungen, die es schwierig macht, den Liquidationswert von grenzüberschreitenden Investitionen zu ermitteln. Diese Unterschiede führen zu erheblichen Schwankungen bei den Rückgewinnungsquoten und schrecken Investoren ab. Eine Verbesserung und Harmonisierung der nationalen Insolvenzregelungen in Europa würde die Kosten senken, mehr Ressourcen für innovative und effiziente Unternehmen bereitstellen, grenzüberschreitende Investitionen fördern und die Finanzstabilität stärken.
Eine stärkere europäische Integration bietet der deutschen Wirtschaft über den Kapitalzufluss hinaus erhebliche Vorteile. Der Zugang zu einem Binnenmarkt mit mehr als 500 Millionen Verbrauchern ermöglicht es deutschen Unternehmen, ohne Handelshemmnisse zu expandieren - ein enormer Wettbewerbsvorteil für eine exportorientierte Wirtschaft und für aufstrebende Unternehmen, die sich entscheiden müssen, ob sie in den USA oder in der EU expandieren wollen.
Darüber hinaus würde eine stärkere europäische Integration es der Industrie - selbst traditionellen Sektoren wie Automobilbau, Maschinenbau und Chemie – besser ermöglichen, Skaleneffekte zu realisieren, Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Ein nahtloser grenzüberschreitender Handel würde auch die hochgradig integrierten Lieferketten in Deutschland stärken, die Effizienz der Produktion steigern und regulatorische Unstimmigkeiten beseitigen, die grenzüberschreitende Aktivitäten behindern. Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, um die vollständige wirtschaftliche Integration des Binnenmarktes voranzutreiben, dann ist es jetzt.
Investitionen in langfristiges Wachstum
Da Deutschland seine Wirtschaft für zukunftsorientierte Investitionen öffnet, muss es sich zu öffentlichen Ausgaben verpflichten, die das langfristige Wachstum fördern. Zu oft haben die politischen Entscheidungsträger Projekte vernachlässigt, deren Erträge sich erst nach dem nächsten Wahlzyklus einstellen würden - mit dauerhaften wirtschaftlichen Folgen.
Die chronisch unzureichenden Investitionen Deutschlands in Bildung und Infrastruktur sind ein Paradebeispiel. Die öffentlichen Bildungsausgaben liegen mit 4,5 % des BIP unter dem europäischen Durchschnitt von 4,8 % . Die jüngsten Ergebnisse der OECD-Studien Program for International Student Assessment (PISA) und Program for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) verdeutlichen die Defizite des Landes bei Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und Problemlösen. Solche Defizite untergraben die Fähigkeit der Erwerbsbevölkerung, sich an die Anforderungen einer sich schnell verändernden globalen Wirtschaft anzupassen.
Auch die veraltete Verkehrs-, Energie- und digitale Infrastruktur in Deutschland behindert die Konnektivität und bremst das Produktivitätswachstum. Fast die Hälfte der Brücken auf Bundesstraßen sind nur in einem “ausreichenden“ oder „schlechteren“ Zustand, während das Schienennetz umfangreich modernisiert werden muss. Infolgedessen sind die Straßen in Deutschland überlastet und die Eisenbahnen unzuverlässig, was den Güterverkehr und die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigt.
Um stabile, zukunftsorientierte Ausgaben zu fördern, müssen die politischen Entscheidungsträger drei wichtige Schritte unternehmen. Erstens sollten sie systematische Kosten-Nutzen-Analysen durchführen, um öffentliche Planungsprozesse zu verbessern.
Zweitens muss Deutschland seine Schuldenbremse reformieren, die die Defizitausgaben auf 0,35 % des BIP begrenzt. Sie soll zwar die Haushaltsdisziplin erzwingen, birgt aber die Gefahr, dass ihre Inflexibilität die Investitionen erstickt. Eine pragmatische Reform könnte die fiskalische Flexibilität erhöhen, ohne den langfristigen Schuldenabbau zu gefährden. Dazu sollte eine Übergangsphase gehören, in der die Schuldenbremse für Notlagen wie Naturkatastrophen und andere Krisen, die sich der Kontrolle der Regierung entziehen, aufgehoben wird. Ein schrittweises Auslaufen der Schuldenbremse könnte dazu beitragen, dass kurzfristige Erleichterungen nicht auf Kosten der langfristigen Stabilität gehen, und sie könnte die Auswirkungen externer wirtschaftlicher Schocks abmildern.
Außerdem sollte die strukturelle Defizitgrenze auf der Grundlage der Schuldenquote angepasst werden. Liegt die Schuldenquote unter 90 %, könnte die Defizitgrenze auf 0,5 % des BIP angehoben werden. Fällt die Quote unter 60 %, könnte die Grenze auf 1 % angehoben werden. Die derzeitige 0,35 %-Grenze würde weiterhin gelten, wenn die Schuldenquote 90 % des BIP übersteigt. Nach den Simulationen des Sachverständigenrates würde ein solcher Ansatz die Schuldenquote Deutschlands auf einem Abwärtspfad halten.
Schließlich, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, braucht Deutschland neue institutionelle Regelungen, um sicherzustellen, dass die öffentlichen Mittel in die Bildung und die Infrastruktur fließen. Eine Lösung wäre ein gesetzliches Mandat, das ein Mindestinvestitionsniveau im Bildungsbereich festlegt - z. B. eine Benchmark für die Ausgaben pro Schüler - um eine stabile und ausreichende Finanzierung zu gewährleisten. Da die meisten bildungsbezogenen Ausgaben von den Kommunen getragen werden, müsste eine solche Maßnahme auf Landesebene umgesetzt werden.
Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur könnte ein permanenter Investitionsfonds die Ausgaben für Straßen- und Schienennetze stabilisieren, indem er spezielle Einnahmequellen sichert. Die Erfahrungen der Schweiz zeigen, dass verlässliche Finanzierungsströme, wie z.B. die LKW- und PKW-Maut, eine langfristige finanzielle Unterstützung für die Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur bieten können.
Die Umleitung von Einnahmen aus der Energie- und Kfz-Steuer in den Verkehrsfonds könnte eine stabile finanzielle Grundlage schaffen. Wenn er auf Verkehrsprojekte des Bundes beschränkt ist, könnte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr ihn beaufsichtigen und die Verwaltungskosten niedrig halten, indem der Fonds in bestehende Strukturen integriert wird, anstatt eine neue juristische Person zu schaffen. Um die Ausgaben mit den übergeordneten Zielen der Regierung in Einklang zu bringen, sollte der Fonds einen intermodalen Ansatz verfolgen und strategische Investitionen in den Straßen-, Schienen- und Wasserverkehr koordinieren.
Die Aussichten Deutschland sind keineswegs hoffnungslos. Es gibt reichlich Möglichkeiten für das Land, seine Wachstumsdynamik wiederherzustellen, indem es seine Wirtschaft diversifiziert und neue Wachstumsmotoren entwickelt, entschlossen auf die negativen demografischen Trends reagiert und die Investitionslücke schließt, die sein Bildungssystem und seine Infrastruktur plagt. Das Festhalten an dem, was in der Vergangenheit funktioniert hat, ist ein todsicheres Rezept für anhaltende wirtschaftliche Stagnation.
Copyright: Project Syndicate, 2025.
www.project-syndicate.org