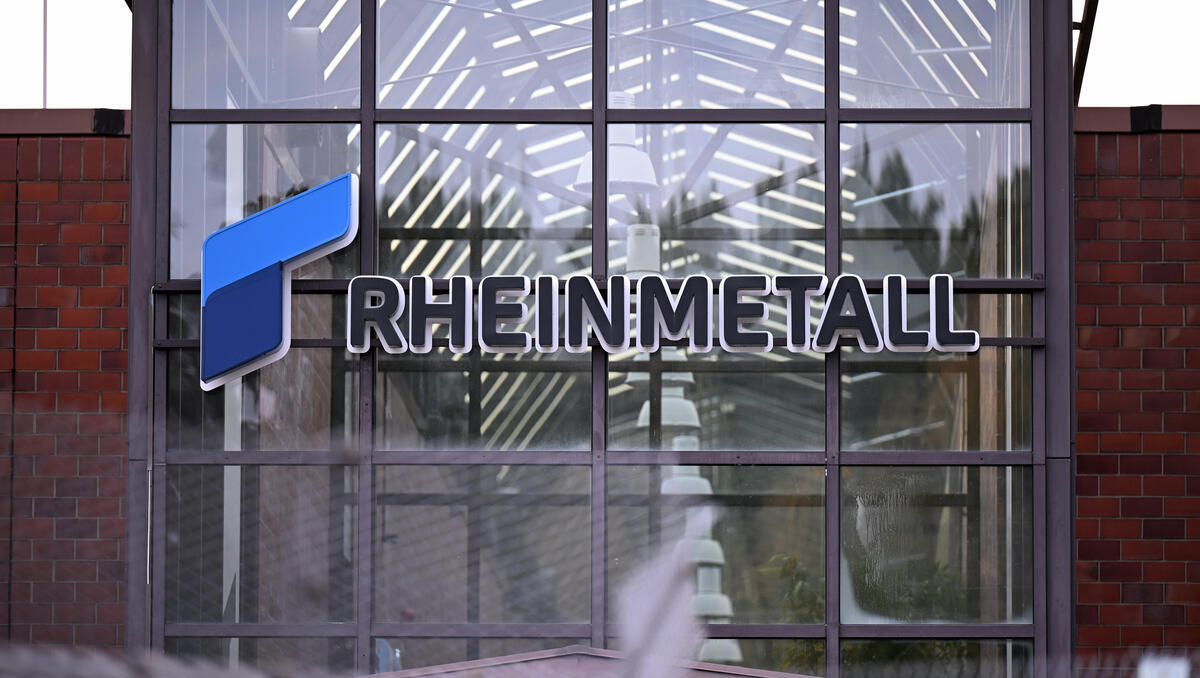Inmitten der wirtschaftlichen Talfahrt Deutschlands steckt der Maschinenbau in seiner schwersten Krise seit 2009 und vielleicht vor den größten Herausforderungen seit Ende des zweiten Weltkriegs. 2024 ist die Produktion um alarmierende sieben Prozent eingebrochen und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) rechnet für das laufende Jahr mit einem weiteren Rückgang des Outputs um zwei Prozent.
Maschinenbau-Krise: Auftragsmangel und Insolvenzwelle
Was sind die Gründe für die Misere? Gemäß Erhebungen des Ifo-Instituts litten 2024 41,5 Prozent aller deutschen Firmen an Auftragsmangel. Aber in kaum einem Sektor ist es derart prekär wie im Maschinenbau (54,7 Prozent). Laut VDMA fiel im Gesamtjahr der preisbereinigte Wert der Bestellungen um 8 Prozent; aus dem Inland kamen sogar 13 Prozent weniger Aufträge. Der Auftragsüberhang aus der Zeit nach Corona ist mittlerweile aufgebraucht und das Neugeschäft lässt sich nur noch als desolat einzustufen.
Die dünne Auftragslage beginnt, die deutsche Traditionsbranche zu erodieren. Das zyklische Geschäft mit niedrigen Margen ist auf heißer Nadel gestrickt und auf organisches Wachstum angewiesen. In unserer rezessiven Wirtschaft kämpfen die Maschinenbauer somit ums nackte Überleben. Zudem belasten die hohen Strompreise, der allgegenwärtige Fachkräftemangel, hohe Personalkosten sowie die Inflation, die nur in geringem Umfang an die Kunden weitergegeben werden kann. Im Maschinenbau und dem gesamten verarbeitenden Gewerbe versucht man, sich mit Kostensenkungen, Personalabbau und Kurzarbeit über Wasser zu halten. Aber wenn man Brancheninsidern glaubt, sind hier mittlerweile auch die letzten Prozentpunkte an Einsparungen nahezu ausgereizt.
Konsequenterweise und im Einklang mit der Pleitewelle in der Gesamtwirtschaft häufen sich jetzt die Insolvenzen. Letztes Jahr stiegen die Insolvenzen bei Maschinenbau-Unternehmen mit einem Umsatz über 10 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent an, berichtet das Fachportal "Maschinenmarkt" unter Berufung auf Auswertungen der Unternehmensberatung Falkenberg. Branchenexperten rechneten damit, dass der Insolvenztrend auch 2025 so weitergehen wird und bislang ist diese Prognose leider eingetreten. In den vergangenen Monaten überschlugen sich die Pleitemeldungen geradewegs, insbesondere bei Automobilzulieferern wie die jüngst betroffenen Firmen DTS Maschinenbau und SK Hydroautomation sowie die inzwischen von Tesla übernommene Manz AG.
Besonders schockierend war letztes Jahr die Insolvenz-Meldung von Illig, dem Weltmarktführer für Thermoform- und Verpackungssysteme. Kurze Zeit später traf es mit dem Buchbindemaschinen-Hersteller Kolbus einen weiteren mittelständischen Weltmarktführer. Das familiengeführte Unternehmen blickt auf eine 250-jährige Historie zurück, aber dem katastrophalen wirtschaftlichen Umfeld konnte man dennoch nicht entrinnen. Beide Traditionsfirmen wurden an zwei verschiedene Münchner Investoren verkauft, im Zuge dessen jeweils mehr als ein Drittel der Arbeitsplätze verloren gingen.
Innerhalb der Branche erwartet man keine Trendwende, eher das Gegenteil. Umfragen der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ergeben, dass 61 Prozent der Entscheider pessimistisch in die Zukunft blicken – so viel wie nur selten zuvor seit Start der Erhebungen vor zehn Jahren. Für 2025 wird ein durchschnittlicher Umsatzrückgang von 3,7 Prozent erwartet.
Rezession, Autokrise und Trump-Zölle
Früher war zumindest das konjunkturelle Umfeld deutlich vielversprechender. Deutschland war vor Corona nicht in einer Rezession, Chinas Wirtschaft lief gut, die heimischen Autobauer steckten noch nicht tief in der Krise und auch das Zinsumfeld war expansiv.
Nun straucheln das Inlands- und Exportgeschäft gleichermaßen, die Finanzierung ist deutlich schwieriger geworden und der erhoffte Boom von Elektroautos blieb aus. Außerdem sind die rasant an Marktanteilen gewinnenden chinesischen Maschinenbauer, die erheblich geringere Herstellungskosten haben, zu einer existenzgefährdenden Konkurrenz geworden. Analysen des Ifo-Instituts zufolge ist die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Maschinenbauer so schlecht wie seit 30 Jahren nicht mehr. Diese katastrophalen Zahlen stammen noch aus einer Zeit vor der Ankündigung der US-Zölle.
Nach der Wahl Donald Trumps drohen nun die USA als Abnehmer fast komplett wegzubrechen – der wichtigste Exportmarkt und kleiner Hoffnungsschimmer der letzten zwei Jahre. "Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten pauschalen Strafzölle von 20 Prozent auf alle Produkte aus der EU richten auf beiden Seiten des Atlantiks Schaden an [...] Denn die EU wird wohl mit Gegenzöllen auf die US-Zölle reagieren", kommentiert VDMA-Chef Bertram Kawlath.
Zölle auf Exporte in die USA treffen den Maschinenbau besonders schwer, denn 2024 gingen 12,6% aller Maschinen-Exporte (im Wert von 31,8 Mrd. EUR) in die USA. Zwei Drittel der VDMA-Mitglieder wären nach eigener Aussagen stark oder sehr stark von den US-Strafzöllen betroffen.
Firmen, die es sich leisten können, werden sich perspektivisch womöglich dazu gezwungen sehen, ein Standbein in den Vereinigten Staaten aufzubauen oder gleich die gesamte Produktion dorthin zu verlagern. Der Abwanderungstrend hat bereits begonnen, und zwar nicht nur im Maschinenbau, sondern in allen Industriezweigen. Das kommt zulasten der heimischen Wertschöpfungskette, die ohnehin durch den Abstieg der Autoindustrie vor einer ungewissen Zukunft steht.
Maschinenbau in Deutschland: Bald ein Relikt aus der Kaiserzeit?
Der Maschinenbau-Sektor mit einem Anteil von rund 5 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP), satten 15 Prozent am Export und 1,1 Millionen Beschäftigten ist ein Rückgrat der deutschen Wirtschaft und der wichtigste industrielle Arbeitgeber.
Die Traditionsbranche ist stark von den sogenannten „Hidden Champions“ durchsetzt, womit meist mittelständische Weltmarktführer in Nischenbereichen bezeichnet werden. Die Hidden Champions und viele weitere Industriefirmen sind häufig im ländlichen Raum angesiedelt und bilden dadurch im Zusammenspiel mit ihren Zulieferern und Großkunden ein feingliedriges Wirtschaftscluster. Dieses mittelständisch geprägte Wirtschaftscluster ist im weltweiten Vergleich einzigartig. In den meisten Ländern konzentriert sich fast die komplette Industrie um die Metropolen herum und Großunternehmen prägen das Bild – nicht so in Deutschland.
Diese Strukturen gehen bis ins Kaiserreich und teilweise sogar noch weiter bis in die Frühphase der Industrialisierung zurück. Neben dem Maschinenbau kristallisierten sich in dieser Zeit mit der Elektrotechnik und Chemieindustrie weitere Schlüsselbranchen heraus, die damals noch die Weltmärkte dominierten und heute ebenfalls um ihre Existenz bangen müssen. Die zweite prägende Periode war das Wirtschaftswunder von grob 1950 bis 1970, als sich die Maschinenbauer zunehmend auf komplexe Nischenprodukte spezialisierten und Maschinen "made in germany" zum Exportschlager wurden.
Nun jedoch beginnen sich die Strukturen aufzulösen. Und negative Folgeeffekte werden nicht auf die feingliedrigen lokalen Industriecluster beschränkt sein, sondern auch in erheblichem Maße und den städtisch geprägten Dienstleistungssektor betreffen, welcher letztlich von Erfolg und Wachstum der Industrie abhängig ist. In diesem Kontext wird der relativ hohe Industrieanteil in Deutschland (circa ein Viertel der Wirtschaftsleistung) zu einem gewaltigen Risikofaktor.
Verband warnt vor Deindustrialisierung und Abwanderung ins Ausland
Die Maschinenbauer warnen vor einer Abwanderungswelle. Noch seien wir nicht deindustrialisiert, aber ohne Gegenmaßnahmen werde genau das passieren. „Die Politik hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel Zeit vergeudet. Nun zeigt sich jeden Tag immer deutlicher, wie stark der Standort Deutschland dadurch zurückgefallen ist“, monierte VDMA-Präsident Kawlath schon Ende 2024. Die Stimmung in der Branche sei sehr schlecht und bei den Maschinenbauern inzwischen eine „große Ungeduld“ und „Wut im Bauch“ zu beobachten.
Deutschland benötige ein „echtes Standort-Upgrade“, um dem Kapitalabfluss-Trend entgegenzuwirken und wieder mehr Investitionstätigkeit im Land zu halten, forderte der Verbandschef neulich auf der der Hannover Industriemesse. Teilweise gibt sich Kawlath aber schon resigniert. „Leider weisen die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD derzeit in die falsche Richtung. Der Reformeifer verblasst schon wieder, bevor er so richtig begonnen hat.“
Positive Faktoren? Aktuell quasi nicht existent, vielleicht abgesehen von den überall kursierenden Effizienzsteigerungs-Fantasien durch KI. Gewisse Hoffnungen für eine Kehrtwende dürften manche Unternehmer nun auf das kontroverse neue Schuldenpaket legen. Die eine Billion Euro, die in den nächsten Jahren für Infrastruktur und Aufrüstung ausgegeben werden sollen, sollten über Sekundäreffekte auch dem Maschinenbau positiv zugute kommen.
Vergebliches Hoffen auf Merz-Regierung?
Der VDMA sieht die kommenden Bundesregierung jedenfalls in der Pflicht, bessere Bedingungen für den Mittelstand zu schaffen, damit dieser wieder in neue Maschinen und Anlagen investiert. Der angestrebte Koalitionsvertrag zwischen CDU/SPD verspricht bessere Rahmenbedingungen für mehr industrielles Wachstum wie die Abschaffung des deutschen Lieferkettengesetzes und eine Senkung der Bürokratiekosten um 25 Prozent. Besonders wichtig ist aus Sicht der Industrie die geplante beschleunigte Abschreibung für Ausrüstungsinvestitionen.
Allerdings ist anzuzweifeln, dass es zu mehr als einem lauen Lüftchen reicht. "Die von der Wirtschaft dringend geforderte Unternehmenssteuerentlastung soll dagegen erst ab 2028 in kleinen Schritten stattfinden. Das ist gerade vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise in Deutschland spät und zu langsam", kritisiert etwa VDMA-Hauptgeschäftsführer Brodtmann. Zudem hat die Vergangenheit gelehrt, dass am Ende meist doch keine signifikanten Reformen umgesetzt werden - vor allem in Bezug auf fundamentale Herausforderungen wie Energiekosten und Steuerlast.
Die politische Historie spricht nicht dafür, dass die Standortkosten bald niedriger werden. Der Abstieg der deutschen Industrieproduktion, die sich von der Finanzkrise noch gut erholt hatte, begann bereits 2018 in der langen Ära der letzten Großen Koalition aus CDU/SPD (2013 bis 2021). Damals nahmen (Klima-)Regulierung und Dokumentationspflichten massiv zu. Es wäre außerordentlich naiv, von einer erneuten Groko mit einem Kanzler Friedrich Merz, der seine Wahlversprechen bereits im Rekordtempo über den Haufen geworfen hat, irgendwelche Heilseffekte zu erwarten.