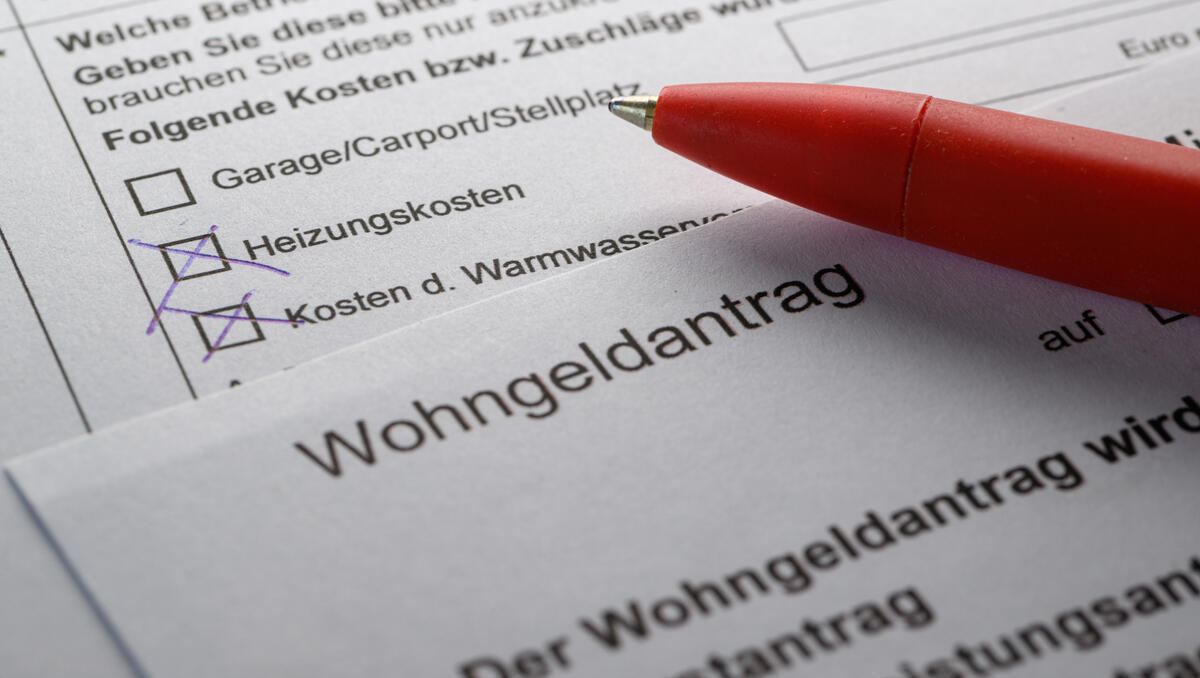DWN: Bundeskanzler Friedrich Merz hat angekündigt, die Bundeswehr zur stärksten Armee Europas machen zu wollen. Ist das ein realistisches Ziel?
Thomas Meuter: Diese politische Äußerung ist einem reinen Wunschdenken entsprungen und selbst unter optimalen Rahmenbedingungen auf Jahrzehnte kaum zu schaffen. Die Bundeswehr war in ihrer Struktur zu Beginn der neunziger Jahre ein starker Pfeiler im NATO-Bündnis und in der Lage, eine Landes- und Bündnisverteidigung zu über einen längeren Zeitraum zu gewährleisten. Diese militärische Fähigkeit Deutschlands wurde von den Regierungen nach der Wiedervereinigung Stück für Stück zurückgefahren. Die Armee schrumpfte immer mehr und damit deren militärischen Fähigkeiten, überhaupt eine Landesverteidigung zu bewerkstelligen. Besonders deutlich wird dies einem Betrachter am Bestand der deutschen Panzertruppe. Diese hatte Anfang der neunziger Jahre rund 2.200 Kampfpanzer. Und der wurde im Laufe der Jahre auf rund 350 Panzerfahrzeuge abgeschmolzen. Das sind 15,91 Prozent der ursprünglichen Größe. Dies passierte auch bei den Schützenpanzern, Kampfflugzeugen, U-Booten und vielen anderen Waffensystemen. Es wurde massiv in der Bundeswehr abgerüstet, denn die Konfrontation zwischen Ost und West war so nicht mehr existent und man wollte dem politisch Rechnung tragen.
Der Bundeswehreinsatz auf dem Balkan oder in Afghanistan trug zwar dazu bei, neue Waffensysteme einzuführen und andere verteidigungspolitische Schwerpunkte zu setzen, aber dies stärkte die Streitkräfte nicht. Dennoch wurde die Gesamtstärke der Bundeswehr von 495.000 auf rund 185.000 Mann zurückgefahren. Das Reservistenkonzept wurde ebenso drastisch reduziert, sodass die Bundeswehr in einem Verteidigungsfalle nicht mehr ausreichend auf menschliche Ressourcen zurückgreifen kann, um Verluste durch Tod, Verwundung oder Gefangennahme auszugleichen. Die militärische Führung der Bundeswehr stellte sich dieser politischen Entwicklung nicht entgegen. Im Gegenteil, man befürwortete sie sogar. Hierbei wurde der Standpunkt vertreten, die Politik entscheidet und die militärische Führung der Bundeswehr setzt es um. Kein Wunder, denn die Truppe wurde reduziert und die Anzahl der Generäle blieb immer gleich und die wollten ihre Positionen auch zukünftig erhalten wissen. Kurzum, niemand aus der Führungsetage der Bundeswehr trat dieser sicherheitspolitischen Entwicklung entgegen und versuchte ein Umdenken herbeizuführen. Der Grund: Die Sicherheits- und Wehrpolitik ist in Deutschland ein politisches sowie gesellschaftliches Stiefkind, was nicht geliebt wird. Nun verschärft sich die sicherheitspolitische Lage zunehmend und damit die Fragestellung, was wir militärisch wirklich in einem Kriegsfall können? Und das ist nicht eben viel. Um die stärkste Armee in Europa zu werden, müsste die Bundeswehr mindestens 300.000 Soldaten haben, die aber auch über die besten Waffensysteme verfügen müssten. Zum Vergleich: Derzeit ist die mannstärkste Armee in Europa die der Türkei mit rund 500.000 Soldaten. Davon sind wir personell weit entfernt, denn die Türkei hat eine Wehrpflicht und Deutschland hat diese ausgesetzt. Mit moderner Waffentechnik können sie schon eine Menge an Personal einsparen, aber dies ist nicht allein der Schlüssel zu einer stärksten Armee in Europa. Es müssen genügend Reserven bei den Waffensystemen und zum personellen Aufwuchs einer Armee vorhanden sein. Beides zu haben, bedeutet ein konsequentes Aufrüsten der Streitkräfte und ein schnelles Heranbilden von wehrfähigen Soldaten. Das ist ohne eine wieder aktivierte und überarbeitete Wehrpflicht kaum möglich. Aber genau das wirft weitere Probleme auf, die zu lösen nicht einfach sind.
DWD: Welche Probleme sind das?
Thomas Meuter: Wenn die Wehrpflicht wieder reaktiviert wird, müssen sie ein Erfassungssystem haben, um zu wissen, wer in das wehrpflichtige Alter von 18 Jahren kommt. Diese Menschen müssen datentechnisch erfasst werden. Angesichts des neuen Datenschutzgesetzes ist das nicht einfach. Dann müssen wieder in den meisten deutschen Städten die Kreiswehrersatzämter aufgebaut werden, um die Wehrtauglichkeit von Wehrpflichtigen festzustellen. Allein der Aufbau der Ämter und das Bestücken mit Personal dauert Jahre und kostet erhebliche Summen an Investitionen. Hinzu kommt eine entsprechende Infrastruktur, bundesweit moderne Kasernen sowie Anlagen zu schaffen und neue militärische Übungsplätze einzurichten, damit die Soldaten für neue Waffensysteme ausgebildet werden können. Dies ein Vorgang, der fünf bis zehn Jahre in Anspruch nimmt und Milliarden Euro an Investitionen kostet. Der Bund hat vor Jahren völlig intakte Kasernen aufgegeben und verkauft, die teilweise abgerissen worden sind. Dies Gebäude und Grundstücke sind verloren. Neue Liegenschaften für Kasernen zu erschließen ist ebenfalls eine langwierige Angelegenheit, die mit vielen Problemen verknüpft sein könnten. Sicherlich gibt es zahlreiche Kommunen, die sich über einen Bundeswehrstandort freuen, wenn dieser neu bei diesen entsteht und Geld in die Kassen spült. Aber es gibt auch immer viel politischen und gesellschaftlichen Gegenwind, damit keine neuen Bundeswehrliegenschaften entstehen. Politisch ist das also nicht ganz so einfach. Hinzu kommt, dass bei vielen der bestehenden Liegenschaften der Bundeswehr seit Jahrzehnten ein massiver Renovierungsstau besteht. Dies kostet Geld und vor allem Zeit, denn während der Renovierungsarbeiten muss die Truppe irgendwo hin ausquartiert werden, damit der Dienst weitergeht. Bisher hat sich auf diesem Gebiet bei der Bundeswehr im Rahmen der Zeitenwende nichts getan. Es liegen heute zwar Zahlen vor, die eine Bundeswehrstärke von vielleicht knapp 200.000 Mann vorschlagen, aber auch diese Zahl an Soldaten reicht nicht aus, um die stärkste Armee in Europa zu sein. Dazu müssen rund 300.000 oder gar mehr Soldaten unter Waffen stehen und mindestens die gleiche Anzahl an ausgebildeten Reservisten zur Verfügung stehen. Die dazu benötigte militärische Infrastruktur ist in der Bundeswehr nicht mehr vorhanden und wird auch nicht in den kommenden Jahren entstehen. Hierzu fehlen die elementarsten Planungen und Voraussetzungen.
DWN: Um die stärkste Armee in Europa zu werden, benötigt die Bundeswehr auch modernste Waffensysteme. Was wird hierzu gebraucht?
Thomas Meuter: Die Wunschliste hierzu ist sehr lang. Die Bundeswehr hat unendlich viele Defizite im Bereich der Ausrüstung, die in den kommenden Jahren aufgearbeitet werden müssen und diese reichen von neuen Funkgeräten bis zu aufzufüllenden Munitionsbeständen. Doch hier steht der gültige und sehr langwierige Beschaffungsgang für neue Ausrüstung aller Art der Truppe im Weg. Der ist aufwendig, kompliziert und rechtlich umständlich organisiert. Neues Wehrmaterial muss international ausgeschrieben werden, um das beste Angebot zu erhalten. Derartige militärische Ausschreibungen dauern insbesondere für komplexe Waffensysteme, wie zum Beispiel Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Kriegsschiffe, Panzer oder Luftverteidigungssysteme oft mehr als zehn Jahre. Darauf bewirbt sich die Industrie und gibt das Angebot ab. Dann wird von amtlicher Seite entschieden, welches Angebot von wem aus der Industrie angenommen wird. Noch komplizierter wird es, wenn das Beschaffungsvorhaben über 25 Mio. Euro kostet. Dann entscheidet der Deutsche Bundestag über diese Vorlage, was ebenfalls sehr lange dauern kann, wenn man sich dabei nicht einig ist. Nun sollte man annehmen, dass der Beschaffungsgang von Wehrmaterial vor dem Hintergrund der neuen sicherheitspolitischen Lage deutlich vom Bedarfsdecker und Bedarfsträger beschleunigt werden sollte, um eine schnelle Aufrüstung der Truppe zu garantieren. Doch dies trifft in Deutschland nicht zu. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Wehrmaterial sind eng und lassen sehr wenig Platz für einen beschleunigten Kauf oder Beschaffung. Dies kann dazu führen, dass die Beschaffung eines neuen Kampfrucksacks für die Streitkräfte 17 Jahre dauert und dann abgebrochen wird, weil keine entsprechende Lösung gefunden wird. Das ist auch bei anderen Projekten der Bundeswehr keine Seltenheit gewesen. Aber es gibt noch andere Stilblühten in Sachen Beschaffung von Waffensystemen. Deutschland hat Drohnen des Typs HERON 2 TP aus Israel gekauft und beschafft gerade noch vier weitere nach. Diese Drohne ist doppelt so teuer, wie das amerikanische Gegenstück Predator B, verfügt nur über die Hälfte von dessen Leistungsparametern und kann noch nicht einmal bewaffnet werden. Dies kam der Bundesregierung entgehen, die keine bewaffnungsfähige Drohne wollte. Das war eine politische Entscheidung, obwohl niemand in Europa die HERON 2 TP nutzt, da diese zu teuer und nicht leistungsfähig genug ist. Trotzdem werden weitere gekauft, wegen der besonderen politischen Beziehungen zu Israel. Auf der Wunschliste ganz oben der Bundeswehr sind neue Luftverteidigungssysteme zu sehen. Die Bundeswehr hatte einmal in den neunziger Jahren 36 Staffeln des Luftverteidigungssystem PATRIOT beschafft. Heute ist ein Bruchteil davon im Einsatz. Viele Systeme sind als Hilfe an andere Länder abgegeben worden. Eine bodengestützte Luftraumverteidigung ist nicht mehr möglich. Neue Luftverteidigungssysteme, darunter IRIS-T SL, PATRIOT und die israelische Arrow 3 zur Abwehr ballistischer Lenkwaffen sind bestellt und im Zulauf, nur reichen diese nicht aus, um einen großflächigen Schutz in Deutschland zu gewährleisten. Aber ein Anfang ist gemacht, wenn auch dieser bei weitem nicht ausreicht, da zu wenige Waffensysteme bestellt werden. Bleiben wir beim Verteidigen des Luftraums.
Die Heeresflugabwehrtruppe wurde im Jahre 2012 als Teil der Kampfunterstützungstruppen außer Dienst gestellt und vollständig aufgelöst, obwohl es hierzu viele warnende Stimmen aus der NATO gab, die aber alle verhallten. In sehr kurzer Zeit war diese Truppengattung des Heeres, die als eine der besten der Welt galt aufgelöst und abgerüstet. Mit der Refokussierung auf den bestehenden Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung der Bundeswehr, wird diese wieder benötigt und nun neu in Lüneburg aufgestellt, was enorme Summen Geld kostet. Nach Aussage der Bundeswehr sollen „die Fähigkeiten der zukünftigen Heeresflugabwehrtruppe für das Überleben auf dem Gefechtsfeld essenziell sein“. Die sogenannte Erstbefähigung der Flugabwehrtruppe sieht für die Bundeswehr wie folgt aus: Das Gepanzerte Transport-Kraftfahrzeug Boxer (GTK) wird mit dem Flugabwehrsystem Skyranger 30 ausgestattet. Die ersten 19 dieser Systeme werden dafür nun von Rheinmetall beschafft. Ein Anfang, aber viel zu wenig, um Heeresverbände gegen Angriffe von Drohnen oder Hubschraubern wirkungsvoll zu schützen. Es ist noch nicht einmal das Minimum an Waffen, die man braucht. Der aktuelle Bedarf liegt bei vielleicht 450 Fahrzeugen oder gar deutlich mehr, um einen effektiven Luftraumschutz für Heeresverbände oder kritische Infrastrukturen abbilden zu können. Im Bereich neue Panzerfahrzeuge für das Heer sieht die erste Bestelllage etwas besser aus. Über hundert neue Kampfpanzer Leopard 2 und ein zweites Baulos des Schützenpanzers PUMA sind schon beauftragt worden. Nun muss die Industrie sehen, wie schnell diese Aufträge abgearbeitet werden können, denn die Bundeswehr ist nicht alleiniger Auftraggeber, sondern auch zahlreiche andere europäische Nationen bestellen in Deutschland Waffensysteme, um ihre Streitkräfte zu modernisieren. Damit verzögern sich weiter die Zeiträume, um die Bundeswehr schnell auf einen besseren technischen Stand zu bringen. Darüber muss die Verteidigungsindustrie produktionstechnisch wieder anwachsen, was Jahre dauern wird. Zum Zeitpunkt des Kalten Kriegs arbeiteten rund 250.000 Menschen in der deutschen Wehrindustrie. Mit dem Verkleinern von Streitkräften schrumpfte auch die entsprechende deutsche Industrie sehr stark. Vor wenigen Jahren waren noch ca. 40.000 Mitarbeiter dort tätig. Die Tendenz ist heute aufsteigend. Um es zusammenfassend zu sagen, benötigt die Bundeswehr deutlich mehr Personal sowie Waffensysteme aller Art und dies alles sehr schnell, um in die Lage zurückversetzt zu werden, eine Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten zu können. Dies wird nach meiner persönlichen Einschätzung und der von Experten rund zehn Jahre dauern, bis dies politisch gesehen, überhaupt umgesetzt werden kann. Noch ist der Ukrainekrieg der Motor für den politischen Willen, die Bundeswehr kriegsfähig werden zu lassen, doch was ist, wenn der Krieg irgendwann einmal zu Ende ist? Wird dann Deutschland seinen neuen sicherheitspolitischen Kurs zur Vergrößerung seiner Streitkräfte weiter verfolgen? Das sind dann die entscheidenden Fragestellungen, die auch in der NATO mit Spannung erwartet werden.
DWN: Um die benötigten Waffensysteme für die Bundeswehr schneller zu beschaffen, könnte man sie auch in Europa und den USA einkaufen. Wäre dies ein schnellerer Weg?
Thomas Meuter: Dieser Lösungsvorschlag kommt immer wieder auf den Tisch und hat leider zwei verschiedene Seiten. Die USA bieten Deutschland derzeit zahlreiche Waffensysteme zum Kauf an, die nicht in Deutschland, sondern in den USA produziert werden. Wenn nun ein Waffensystem schnell gebraucht wird, um ein Defizit in der Verteidigungsfähigkeit bei der Bundeswehr zu schließen, ist ein Kauf im Ausland möglich. Dies wird auch in bestimmten Fällen gemacht. Hinzu kommt aber oft die Tatsache, dass der Kauf eines Waffensystems nicht ganz in die Rüstungsplanung der Bundeswehr passt. Dann muss es, wenn technisch möglich und gewünscht, an die Erfordernisse der Bundeswehr angepasst werden. Im Falle des Stealthfighters F-35 ging das sehr schnell. Der damaliger Bundeskanzler Scholz hatte zu seiner Rede im Deutschen Bundestag verkündet, dass Deutschland 35 F-35 aus den USA beschaffen würde. Diese Beschaffung wurde unmittelbar eingeleitet, um die nukleare Teilhabe in Deutschland durch ein moderneres fliegendes Waffensystem als mit dem veralteten Tornado abbilden zu können. Die Beschaffungsentscheidung, wozu auch Luft-Boden-Waffensysteme gehörten, ist innerhalb weniger Jahre realisiert worden und war ein guter Schritt, obwohl die heimische Industrie davon nur wenig profitierte. Ebenso gab es keine europäische Alternative, die man als Tornado-Ersatz hätte nehmen können. Im Gegenzug wurden aber auch 38 neue Eurofighter für die Luftwaffe in Auftrag gegeben, um die nationale Luftfahrtindustrie zu unterstützen. Die Bundeswehr ist also in der Lage, auf eine gute deutsche wehrtechnische Industrie zurückgreifen zu können, die die meisten schweren Waffensysteme angefangen von Panzern über U-Boote bis hin zu Artillerie- oder Panzermunition selbst herstellen kann. Alles geht aber nicht. Vielfach wird europäisch kooperiert, um insbesondere große Waffensysteme gemeinsam zu finanzieren, wie beispielsweise die Eurodrohne, das Euro-Leichtsgewichtstorpedo, Eurofighter, Airbus A400M den NH-90 Helikopter, den Leopard-Nachfolger oder das zukünftige Kampfflugzeug der 6. Generation FCAS. Alles europäische Programme, die verfügbar, also in der Produktion oder in der Planung sind. Bei alle diesen Vorhaben ist eine lange Vorlaufzeit geboten, die mit der Abstimmung der europäischen Partner zusammenhängt und meist industriepolitisch geregelt wird. Ein nicht immer einfacher Prozess, der auch öfter einmal nach 10 Jahren scheitern kann. Scheitert ein EU-Rüstungsprogramm, so entstehen Doppelkapazitäten, die sich eigentlich Europa nicht mehr leisten sollte. Doch zurzeit entscheiden nationale Interessen über die Beschaffung von Wehrmaterial und nicht Brüssel. Also Wehrtechnik im Ausland kaufen ist möglich und einfach. Problematischer sowie zeitaufwendiger ist es, europäisch zu planen und zu beschaffen, was aber Geld sparen kann. Aber die Bundeswehr muss schnell aufwachsen und muss dabei genauso schnell ausgerüstet werden. Lange Wartezeiten sind daher kontraproduktiv und keinesfalls hinzunehmen, wenn das Ziel schnell erreicht werden sollte.
DWN: Was ist aktuell in der Beschaffung der Bundeswehr und wird in 2025 beschafft?
Thomas Meuter: Im Rahmen umfassender sicherheitspolitischer Anpassungen rüstet die Bundeswehr derzeit ihre Truppe so gut es geht aus: Der neue „Kampfbekleidungssatz Streitkräfte“ ist fast eingeführt, inklusive ballistischer Schutzwesten und weiterer Ausrüstung. Gleichzeitig wird ab der zweiten Jahreshälfte 2025 ein Referenzfahrzeug für den schweren Waffenträger von der Truppe erprobt und weiterentwickelt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat zudem die Beschaffung von Prototypen für ein neues modernes 120mm Mörsersystem bewilligt, während das „Infanterist der Zukunft“‑System (IdZ) unter dem Namen GLADIUS sukzessive technisch verbessert und erweitert wird. Die digitale Anbindung im Einsatz wird durch das neue TaWAN-Richtfunknetz für Auslandseinsätze gestärkt, was Jahrzehnte dauerte. Bewährte und ältere Waffensysteme bleiben ebenfalls im Fokus der Bundeswehr. So die Lieferung von DM22‑Panzerabwehrrichtminen (PARM) wird fortgesetzt und neue 120mm Munition für Kampfpanzer wird beschafft. Doch auch hier gilt es die Zeitachse genau zu beachten. Wehrtechnische Beschaffungen für eine größer werdende Armee sind nicht von heute auf morgen zu bekommen. Auch wenn die Bundeswehr früher einmal rund 12 Divisionen umfasste, lässt sich eine Truppenstärke von 200.000 oder mehr Soldaten nicht ohne Weiteres und schnell wieder erreichen. Dazu ist in den letzten Jahrzehnten viel zu viel der angeblichen Friedensdividende zum Opfer gefallen und erst seit dem Ukrainekrieg interessieren sich mehr Politiker für den Bereich Sicherheits- und Wehrpolitik, der vorher nicht im Fokus der Politik lag. Wie schon gesagt, eine größere Armee ist nicht realisierbar innerhalb weniger Jahre. Dies kann nur mit einer entsprechenden politischen Willensbildung, konsequenter Umsetzung dieser und einer entsprechenden Infrastruktur geschehen. Bricht nur einer dieser Pfeiler weg, dann wird es schwierig.
DWN: Wie könnte ein Fazit für die Bestrebungen zur Vergrößerung der Bundeswehr heute lauten?
Thomas Meuter: Die deutsche Öffentlichkeit ist an Sicherheitspolitik oder an militärischen Fragen aller Art nicht besonders Interessiert. Das sieht in anderen europäischen Staaten anders aus. Unsere Streitkräfte sind im öffentlichen Leben nicht so verankert, wie in anderen europäischen Staaten. Bedenken sie die Demonstrationen bei öffentlichen Gelöbnissen, die Tatsache, dass Soldaten immer noch angeraten wird, sich die Uniform erst in der Kasernen anzuziehen und damit nicht zum Arbeitsplatz zu kommen. Nach langen Diskussionen gibt es nun einen Veteranentag und einen Tag der Bundeswehr, der mit vielen Ausstellungen einhergeht. Aber eine militärische Parade in Deutschland wäre bis heute undenkbar. Politisch die Bundeswehr jetzt buchstäblich personell, finanziell und technisch stark zu puschen wird nicht von allen Fraktionen des Deutschen Bundestags getragen. Hier wird es noch viele politische und gesellschaftliche Widerstände geben.
Es muss klar sein, dass Streitkräfte immer nur Mittel zum Zweck sind, um politische Interessen durchzusetzen – notfalls mit militärischer Gewalt und unter dem Einsatz von Menschenleben. Diese Begleitumstände erschweren es deutlich, einen gesellschaftlich akzeptierten und politisch gewollten massiven Ausbau der Bundeswehr umzusetzen.
Sollte Deutschland tatsächlich die finanziellen Mittel aufbringen und eine größere Armee mit neuen militärischen Fähigkeiten schaffen wollen, wäre dies ein langwieriger Prozess von mindestens zehn Jahren – mit Investitionen im dreistelligen Milliardenbereich. Dazu müssten jährlich etwa fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung fließen, was angesichts anderer gesellschaftlicher Herausforderungen kaum realistisch erscheint.
Vor 2030 sind erhebliche Modernisierungsschritte nötig, die parallel zum Aufwuchs der Streitkräfte erfolgen müssen. Die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Beschaffung von Wehrmaterial müssen dringend reformiert werden, was ebenfalls Zeit braucht. Die Bundeswehr wird deshalb eine politische Großbaustelle bleiben, die viel Geld und politische Kraft erfordert.
Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass eine größere deutsche Armee auch größere Erwartungen seitens der NATO und internationaler Partner mit sich bringt – etwa in Form von mehr Auslandseinsätzen. Dieser Aspekt wird von der deutschen Politik bislang kaum ausreichend reflektiert.
Info zur Person: Thomas Alexander Meuter (62) ist seit rund 35 Jahren wehrtechnischer Journalist und beschäftigt sich mit militärischen Fragen und Ausrüstungen von Streitkräften. Sein Schwerpunkt liegt dabei auf der weltweiten Luftwaffen- und Heeresrüstung und militärische Analysen von Konflikten sowie Technologien, die dort zum Einsatz kommen. Das Thema Altmunition, Landminen und militärische Altlasten bearbeitet er ebenfalls redaktionell. Er ist erfolgreicher Fachbuchautor und Chefredakteur des Verlags MD&Partner in Meckenheim bei Bonn.