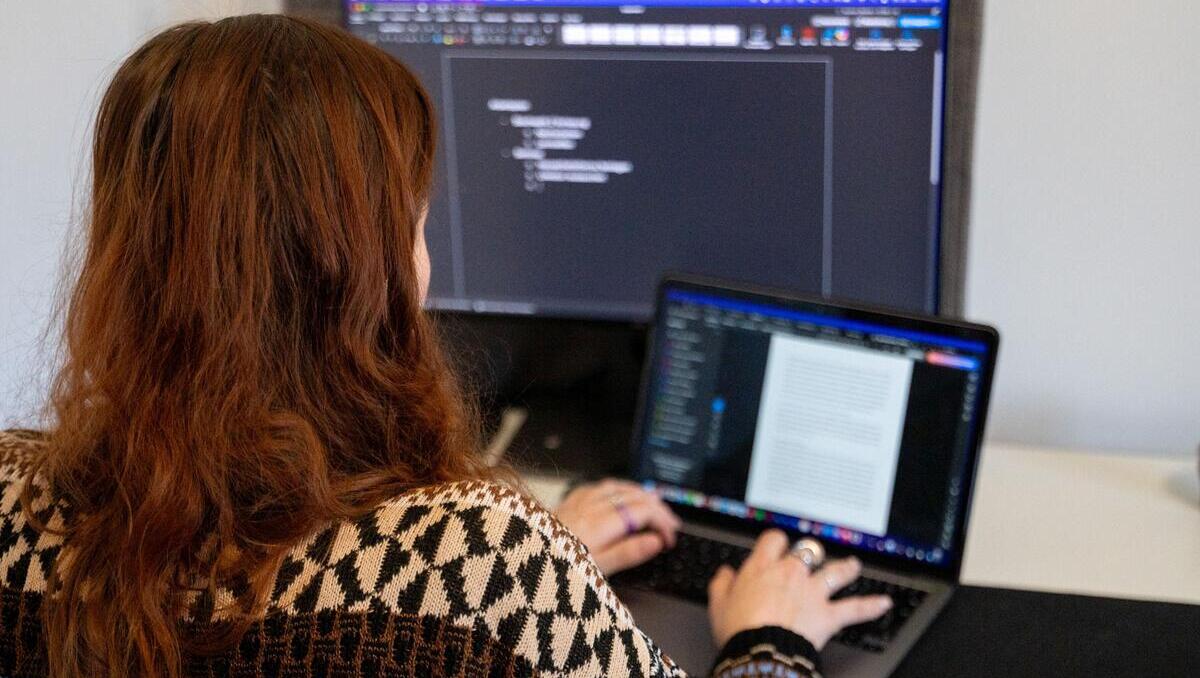Die EU-Kommission hat einen neuen Siebenjahreshaushalt mit einem Volumen von zwei Billionen Euro vorgeschlagen. Dieser Plan soll ab 2028 gelten und umfasst unter anderem Mittel für Verteidigung, Wettbewerbsfähigkeit und den Wiederaufbau der Ukraine. Die Finanzierung soll über fünf neue Einnahmequellen erfolgen. Doch schon jetzt formiert sich Widerstand gegen den Entwurf – auch aus Deutschland.
Umbau zugunsten von Rüstung, Ukraine und Technologie
Der Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 sieht deutliche Verschiebungen vor: Rund 1.000 Milliarden Euro sind für Kohäsions- und Agrarpolitik eingeplant. Davon sollen 168 Milliarden Euro für die Rückzahlung der Corona-Kredite (NextGenerationEU) verwendet werden. 589,6 Milliarden Euro fließen in den neuen "Europäischen Fonds für Wettbewerbsfähigkeit", das Horizon-Forschungsprogramm, Erasmus+ und Infrastruktur. Für Verteidigung, Außenpolitik und Grönland sind 215,2 Milliarden Euro vorgesehen. Die Verwaltung verschlingt 117,9 Milliarden Euro. Hinzu kommt ein Sonderfonds für die Ukraine in Höhe von rund 100 Milliarden Euro.
Gleichzeitig beteuert die Kommission, dass jedes Land weiterhin mindestens so viel für weniger entwickelte Regionen erhält wie bisher. Allerdings sollen künftig 14 Prozent der Mittel für Reformen, Armutsbekämpfung und soziale Inklusion reserviert werden. Der Agrarhaushalt schrumpft von 387 auf etwa 300 Milliarden Euro. Die Kommission versichert zwar "gleichbleibende Leistungen", doch Parlamentarier rechnen mit realen Kürzungen von bis zu 30 Prozent.
Neue Einnahmen durch CO2, Tabak und Großkonzerne
Zur Finanzierung des aufgeblähten Haushalts schlägt Brüssel fünf neue Einnahmequellen vor. Dazu gehören Einnahmen aus dem Emissionshandel (ETS1), dem CO2-Grenzausgleich CBAM, einer Abgabe auf Elektroschrott, Verbrauchsteuern auf Tabak sowie eine neue Konzernpauschale (CORE) für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über 100 Millionen Euro. Diese sollen ab 2028 jährlich 58,5 Milliarden Euro einbringen. Die Rückzahlung der Corona-Kredite soll mit jährlich 24 Milliarden Euro (168 Milliarden bis 2034) finanziert werden. Insgesamt müssten dafür 8,4 Prozent des gesamten Haushalts reserviert werden.
Widerstand aus Deutschland und anderen Mitgliedstaaten
In Berlin läuten bereits die Alarmglocken. Die Bundesregierung hat erklärt, dass sie den Haushalt in dieser Form nicht akzeptieren kann. "Eine umfassende Erhöhung des EU-Haushalts ist inakzeptabel", so Regierungssprecher Stefan Kornelli. Deutschland lehnt insbesondere die CORE-Pauschale für Großunternehmen ab. Aus wirtschaftlicher Sicht sei eine Mehrbelastung in Zeiten konjunktureller Unsicherheit kontraproduktiv.
Auch die Bauernverbände schlagen Alarm. Bereits bei der Vorstellung protestierten sie in Brüssel. Die Kürzungen der GAP könnten massive Auswirkungen auf die Landwirtschaft in Deutschland haben, wo viele Betriebe auf EU-Subventionen angewiesen sind. Die Agrarpolitik gerät so in Konflikt mit Rüstungs- und Digitalambitionen der EU.
Mehr Flexibilität und Risiko für Kohäsionsmittel
Die Kommission will zudem mehr Flexibilität: Künftig sollen Mittel zwischen Programmen leichter verschoben werden können, ein Notfallfonds ist geplant. Doch Kritiker fürchten, dass dies zu Lasten traditioneller Politikbereiche wie Kohäsion oder Landwirtschaft gehen könnte.