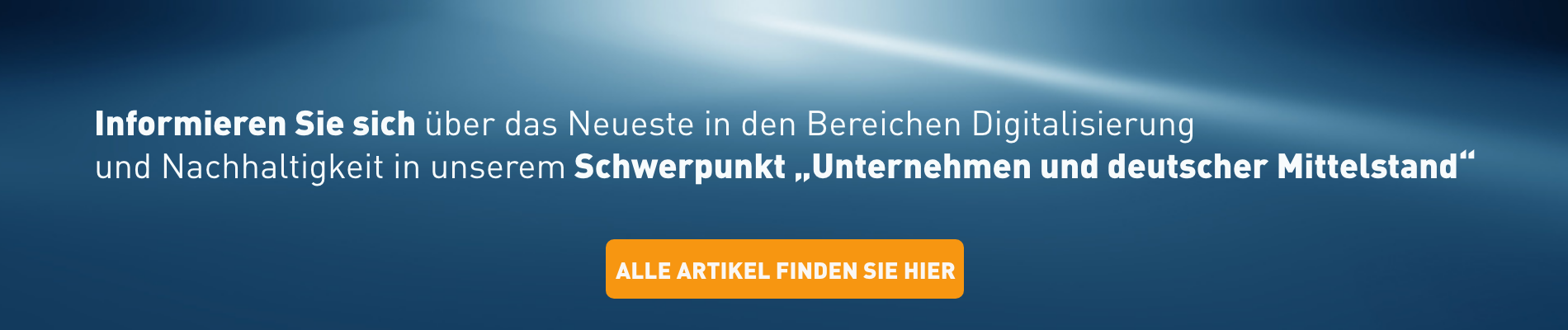EU-China-Gipfel: Handel mit China gerät weiter ins Ungleichgewicht
In den ersten fünf Monaten des Jahres sind die deutschen Exporte nach China um rund 14 Prozent gesunken. Zugleich importierte Deutschland zehn Prozent mehr aus Fernost, zeigt eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). China nutzt dabei unfaire Methoden – die EU muss entschlossen reagieren.
Gegenläufiger Trend trotz politischer Warnungen
In den vergangenen Jahren war das politische Ziel im Umgang mit China eindeutig: diversifizieren, Abhängigkeiten abbauen, keinesfalls denselben Fehler wie im Fall Russlands wiederholen. Doch neue Berechnungen des IW zeigen, dass das Gegenteil eingetreten ist. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres importierte Deutschland rund zehn Prozent mehr aus China, während die Exporte dorthin um rund 14 Prozent zurückgingen. China ist damit längst kein Wachstumstreiber mehr für die deutsche Exportwirtschaft – im Gegenteil.
Warenflut aus China trifft deutsche Industrie
Besonders gravierend ist die Entwicklung beim Außenhandel mit Metallerzeugnissen: Während die Ausfuhren nach China um rund 25 Prozent sanken, legten die Einfuhren um 25 Prozent zu. Bei Kraftwagen (minus 36 Prozent Export) und elektrischen Ausrüstungen (minus 16 Prozent Export) zeigen sich ebenfalls deutlich rückläufige Zahlen. Die sinkenden Exporte bei gleichzeitig steigenden Importen belasten die deutsche Wertschöpfung und gefährden Arbeitsplätze.
China setzt auf staatlich geförderten Wettbewerbsvorteil
"Der China-Schock ist da", erklärt IW-Außenhandelsexperte und Studienautor Jürgen Matthes. Dass die chinesische Regierung ihre Unternehmen massiv subventioniert, sei seit Langem bekannt. "Bislang hatten wir aber nicht im Blick, dass der Yuan gegenüber dem Euro massiv unterbewertet ist – und zwar in erheblichem Umfang", so Matthes. Dies erkläre die extreme Schieflage bei Exporten und Importen. Die Kombination aus Subventionen und unterbewertetem Yuan ermögliche es chinesischen Unternehmen, zu extrem niedrigen Preisen anzubieten. "China agiert mit unfairen Mitteln, das ist nicht länger hinnehmbar. Es beschleunigt die De-Industrialisierung in Deutschland. Die EU sollte sich mit handelspolitischen Instrumenten wehren, um faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen", so Matthes. Im Fall der europäischen Ausgleichszölle auf chinesische E-Autos zeigt die Gegenwehr bereits Wirkung: Hier sind die Importe entgegen dem Trend um 38 Prozent eingebrochen.
Neue Zahlen zeigen wachsende Abhängigkeit Europas
Laut einer Analyse des ifo Instituts vom Juni 2024 hat sich die Abhängigkeit Europas von chinesischen Vorleistungen zuletzt sogar noch verstärkt – vor allem in den Bereichen Maschinenbau, Chemie und Batterietechnologie. Der Anteil chinesischer Komponenten in EU-Produktionsprozessen liegt inzwischen bei über 15 Prozent, bei bestimmten Schlüsseltechnologien wie Solarpanels sogar bei über 80 Prozent. Für deutsche Unternehmen bedeutet dies wachsende strategische Risiken: Lieferketten werden anfälliger, der Handlungsspielraum bei geopolitischen Spannungen schrumpft. Zudem gefährdet die Preisunterbietung durch chinesische Anbieter nicht nur Marktanteile, sondern langfristig auch Innovationskraft und Investitionsbereitschaft. Der BDI warnt in einer Stellungnahme vom März 2025 vor einem "strategischen Kontrollverlust in zentralen Zukunftsbranchen". Gerade für mittelständische Unternehmen sei es entscheidend, auf neue Bezugsquellen zu setzen, um eigene Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Die Zahlen bestätigen: Es reicht nicht, von "Dekoupling" zu sprechen – es braucht konkrete industriepolitische Maßnahmen.