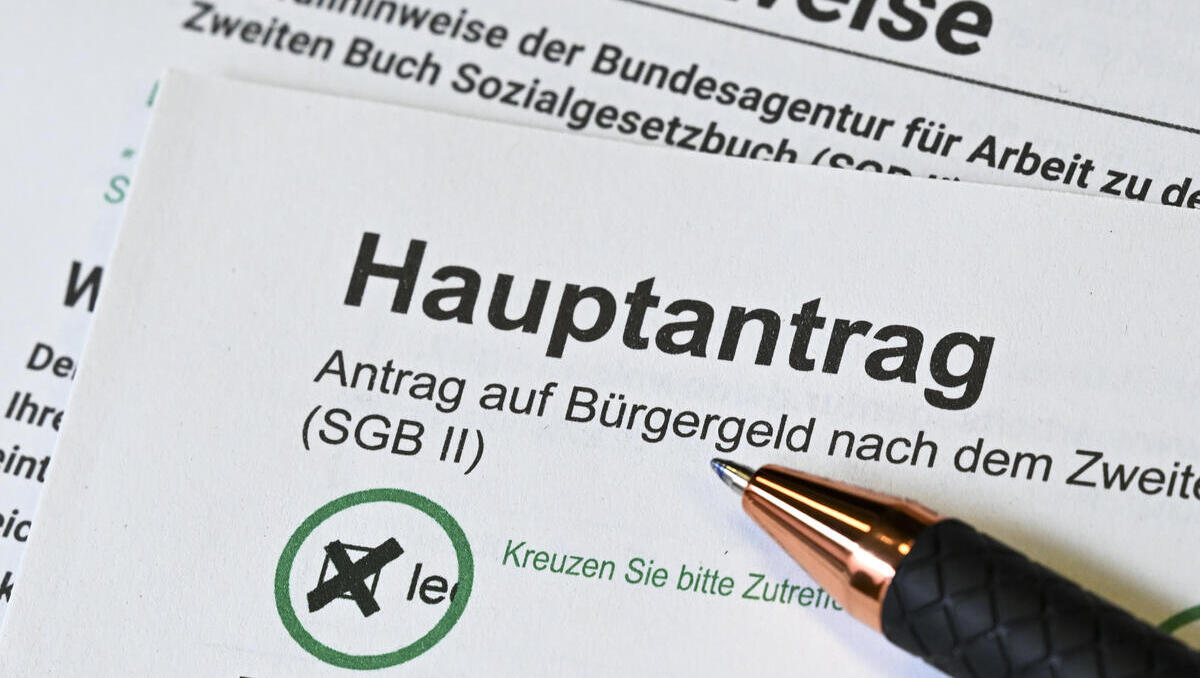Kapitalflucht nach Osten: Kapitalumschichtung von den USA nach Europa
An der Wall Street war in der vergangenen Woche von der sinkenden Attraktivität des US-Aktienmarkts, von Konjunkturaussichten und von den Quartalszahlen der Unternehmen die Rede. Auch die Handelskonflikte rückten in den Fokus – obwohl apokalyptische Szenarien wohl abgewendet werden konnten, wird die Wirtschaft dennoch negativ betroffen sein.
Investoren beschleicht zunehmend das Gefühl, dass es an der Zeit sein könnte, nach Anlagemöglichkeiten etwas weiter östlich – in Europa – zu suchen, fernab der instabilen USA. Stephane Boujnah, Chef des Börsenbetreibers Euronext, sagt, dass Amerika infolge der politischen Instabilität zunehmend nicht mehr wie ein entwickelter, sondern wie ein sogenannter Schwellenmarkt erscheine – zumindest im Aktiensegment. Im Bloomberg-Podcast „Merryn Talks Money“ erklärte Boujnah, dass die Kapitalumschichtung von den USA nach Europa bereits eingesetzt habe – aber durch die Wiederwahl Donald Trumps massiv beschleunigt worden sei. Ein schwacher Dollar und attraktive Aktienbewertungen hätten eine neue Welle des Interesses an Europa ausgelöst. „Europa wird heute als großes ‚Schweiz‘ wahrgenommen. Es ist nicht so, dass alle von den Wachstumsaussichten der europäischen Volkswirtschaften begeistert wären“, so Boujnah. „Aber es überwiegt das Gefühl, dass die institutionelle Struktur stabil und berechenbar ist.“
Goldman Sachs: Es bestehen ausreichend Wachstumsrisiken
Strategen von Goldman Sachs raten Kunden, riskantere Engagements abzusichern, nachdem sich die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen auf das niedrigste Niveau seit 2007 verringert haben. Nachdem es im Zollstreit mit mehreren Handelspartnern zu vorläufigen Abkommen gekommen sei, hätten Investoren mehr Klarheit über die US-Handelspolitik gewonnen – „und sind daher geneigt, die konjunkturelle Schwäche der nahen Zukunft zu ignorieren, solange das Rezessionsrisiko kontrollierbar bleibt“, so die Analysten des Hauses. Am Donnerstag sank der Risikoaufschlag globaler Unternehmensanleihen mit Investment-Grade auf 79 Basispunkte – der niedrigste Stand seit 2007, also unmittelbar vor der Weltfinanzkrise. Dieser Aufschlag bemisst die Differenz zwischen Unternehmens- und gleichrangigen Staatsanleihen.
„Es bestehen ausreichend Wachstumsrisiken, um den Einsatz von Absicherungsinstrumenten im Portfolio zu rechtfertigen. Die Konjunkturentwicklung könnte negativ überraschen“, so Goldman Sachs. Die Volkswirte der Bank rechnen weiterhin damit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im September, Oktober und Dezember jeweils um 25 Basispunkte senken wird – und zwei weitere Schritte 2026 folgen.
Mike Wilson sieht das Ende einer „schleichenden Gewinnrezession“
Die Quartalsergebnisse der Unternehmen befinden sich in einem „schleichenden Aufschwung“, so Analysten von Morgan Stanley. Der Leitindex S&P 500 könnte deshalb binnen zwölf Monaten auf 7.200 Punkte steigen. Die Bank erklärt damit das Ende einer „schleichenden Gewinnrezession“, deren Beginn sie im Jahr 2022 verortet hatte. „Wir befinden uns nun offenbar in einem Umfeld des schleichenden Aufschwungs, getragen von positiven Cashflows, KI-Implementierung, Dollar-Schwäche, Steuervorteilen durch das Haushaltsgesetz OBBBA, einfachen Vergleichsbasiswerten, aufgestauter Nachfrage in vielen Sektoren und einer hohen Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen durch die Fed bis zum ersten Quartal 2026“, so Mike Wilson, Chief Investment Officer von Morgan Stanley. Im Bullen-Szenario erwartet die Bank ein S&P-500-Plus.
Burton Malkiel: Ein Aktienverkauf wäre in der Krise ein Fehler
Burton Malkiel ist Finanzexperte, ehemaliger Wirtschaftsprofessor an der Princeton University, 28 Jahre lang bei Vanguard tätig und Autor des Klassikers „Random Walk Down Wall Street“. Angesichts historischer Höchststände an den Aktienmärkten veröffentlichte der 92-jährige ehemalige Chief Investment Officer von Wealthfront nun einen offenen Brief, in dem er erklärt, warum ein Aktienverkauf in der Krise ein Fehler wäre. Der Versuch, den idealen Verkaufs- und Wiedereinstiegszeitpunkt zu erraten, sei womöglich der „größte unprovozierte Anlagefehler“, schrieb er – auch wenn er das Gefühl kenne, das aufkomme, wenn Werte fallen.
„Oh Junge, ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß, wie schwer das ist“, räumte er ein – und fügte hinzu, dass ein Rückzug „immer eine schlechte Entscheidung“ sei. Die langfristige Marktrendite sei „verdammt schwer zu schlagen“, so Malkiel – und wer glaube, es besser zu wissen als der Markt, begebe sich „wahrscheinlich direkt ins Unglück“.
Fidelity International: Goldpreis von 4.000 EU-Dollar?
Ian Samson, Multi-Asset-Fondsmanager bei Fidelity International, hält einen Goldpreis von 4.000 Dollar bis Ende 2026 für möglich – sofern die Fed die Leitzinsen senkt, um den Wirtschaftsabschwung zu dämpfen. Das Unternehmen bleibt bullish für das Edelmetall und hat seine Position zuletzt aufgestockt, nachdem die Preise leicht unter das Rekordniveau zurückgefallen waren. „Unsere Logik war, dass sich die Perspektive auf eine lockerere Fed-Politik klarer abzeichnet“, erklärt Samson im Bloomberg-Interview – und verweist darauf, dass einige Fonds ihre Goldallokationen im Vorjahr verdoppelt hätten.
„Vielleicht entgehen wir den apokalyptischen Szenarien, die Anfang des Jahres gezeichnet wurden – aber am Ende werden wir eine Art 15-Prozent-Steuer auf rund 11 Prozent der US-Wirtschaft sehen, sprich auf Importe“, so Samson. „Das dürfte die Konjunktur verlangsamen.“ Ein solches Abschwächen würde vermutlich zu Zinssenkungen und einem schwächeren Dollar führen – zwei Faktoren, die dem Goldpreis gewöhnlich zugutekommen. Gold hat 2025 bereits über 25 Prozent zugelegt – angetrieben vom US-Handelskrieg mit dem Rest der Welt, geopolitischen Konflikten und Goldkäufen der Zentralbanken.