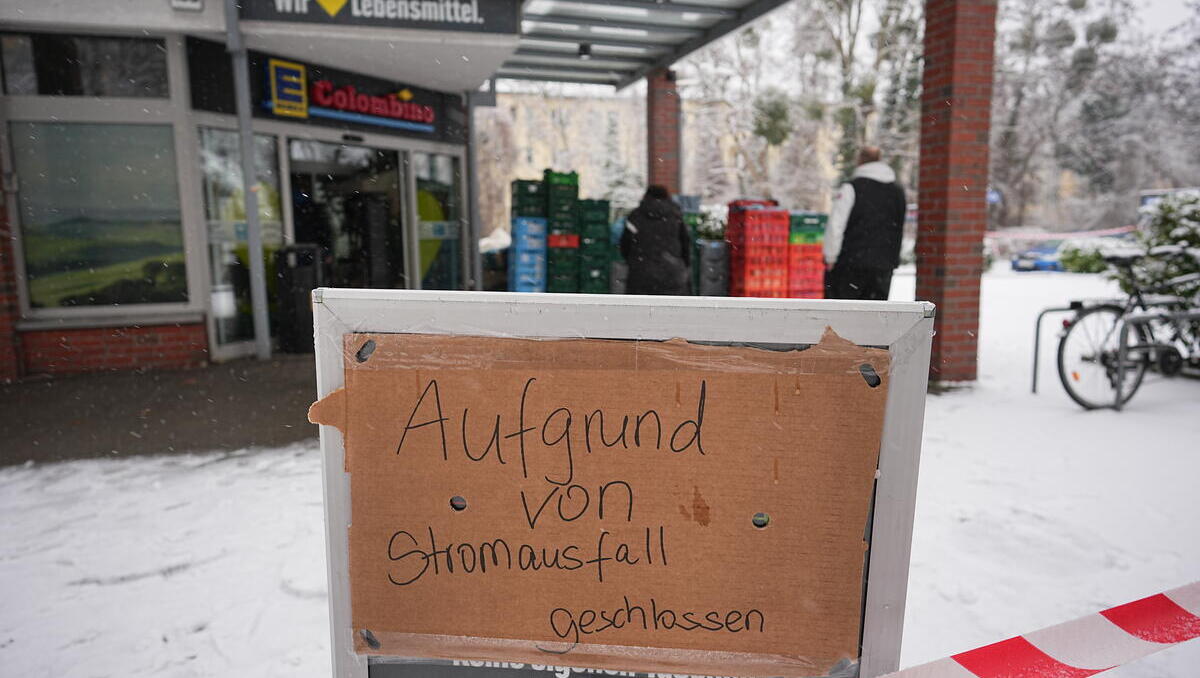Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Gewissheiten verschieben sich. Gewissheiten, die wir jahrzehntelang nicht hinterfragt und die wir als gegeben angesehen haben: politische Stabilität, eine resiliente Demokratie und eine starke Wirtschaft mit einem sicheren Arbeitsplatz. Seit der Corona-Pandemie, seit Russlands Krieg gegen die Ukraine, seit der Wiederwahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und seit der Erfindung der künstlichen Intelligenz haben diese Grundpfeiler unserer globalen Ordnung tiefe Risse bekommen. Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära, die nicht mehr von den vertrauten Gesetzen der vergangenen Jahrzehnte regiert wird. Die Frage, die unsere Titelthese diesen Monat stellt – „Wohin steuert die EU?“ – ist daher keine akademische Übung. Sie ist die essenzielle Frage nach unserer Zukunft, unserem Wohlstand und unserer Rolle in einer Welt, die sich radikal neu ordnet.
Europa und die Schauplätze der Zukunft
Europa, dieser Kontinent der Philosophen, der Erfinder und der sozialen Marktwirtschaft, befindet sich in einem fundamentalen Identitätskampf. Wir waren es gewohnt, die Regeln zu setzen, den Ton anzugeben, den Maßstab für Zivilisation und Fortschritt zu definieren. Doch das Brett, auf dem gespielt wird, ist nicht mehr dasselbe, die Figuren, die das geopolitische Schachspiel dominieren, sind nicht mehr dieselben. Die Gleichung, dass wirtschaftliche Macht unweigerlich politisches Gewicht bedeutet, geht plötzlich nicht mehr auf. Wir müssen uns einer unbequemen Wahrheit stellen: Wir sind dabei, vom Gestalter zum Getriebenen, vom Akteur zum Zuschauer zu werden.
Dieses Magazin handelt von den Schauplätzen, auf denen die künftige Rolle – Statist oder Held – verhandelt, entschieden und neu bestimmt wird.
Behalten wir Souveränität in einer digitalen Welt? Wer kontrolliert die Datenströme, die für unsere Unternehmen so lebenswichtig sind? Halten wir Schritt mit der KI-Revolution? Brüssel ringt mit den Giganten aus dem Silicon Valley, die nicht nur Märkte, sondern zunehmend auch staatliche Souveränitätsrechte herausfordern. Es ist ein Kampf David gegen Goliath, bei dem David zwar moralische und rechtliche Argumente, Goliath aber oft die schiere ökonomische und technologische Macht besitzt. Dies wirft fundamentale Fragen auf: Wie viel Regulierung braucht der Markt, um fair und frei zu bleiben? Und wo erstickt ebenjene Regulierung die Innovation, die wir so dringend benötigen? Ein schwieriger Balanceakt.
Europas Krise als historische Chance
Doch in dieser Krise liegt auch eine historische Chance. Noch nie war die Notwendigkeit, endlich zu handeln, größer. Noch nie war der Konsens, dass wir handeln müssen, weiter verbreitet. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen – von der digitalen Souveränität und der künstlichen Intelligenz über die Energie- und Klimapolitik bis hin zur europäischen Verteidigungspolitik –, sind gewaltig. Aber sie sind auch die Blaupause für eine Renaissance des europäischen Projekts. Es geht nicht um weniger Markt, sondern um einen gestärkten, integrierten und technologisch unabhängigen Binnenmarkt. Es geht nicht um planwirtschaftliche Eingriffe, sondern um kluge, strategische Investitionen in jene Schlüsseltechnologien, die über unsere Zukunftsfähigkeit entscheiden.
Der „Green Deal“ ist dabei der vielleicht ambitionierteste und gleichzeitig riskanteste Hebel. Er ist weit mehr als Umweltpolitik; er ist eine gigantische industriepolitische und geostrategische Weichenstellung. Er eröffnet den Weg, unsere Energiefreiheit zurückzugewinnen und zum Architekten weltweiter Klimastandards aufzusteigen. Doch er droht auch, Unternehmen mit einer Flut von Bürokratie zu ersticken und sie im internationalen Wettbewerb zu benachteiligen. Die Frage ist nicht, ob wir nachhaltiger werden müssen, sondern wie wir es schaffen, dies ohne Deindustrialisierung und ohne massive Wohlstandsverluste zu tun. Hier trifft der Idealismus von Brüssel auf die harte Realität der Fabrikhallen und Bilanzbücher.
Es geht um uns
Letztlich, verehrte Leser, geht es um eine einzige, alles überragende Frage: Haben wir noch den Willen, uns unsere Zukunft selbst zu gestalten? Oder überlassen wir es anderen, über unser Schicksal zu bestimmen? Die Antwort liegt nicht allein in den Hauptstädten oder in Brüssel. Sie liegt in den Chefetagen, in den Forschungsabteilungen, in den Start-ups und den Familienunternehmen. Sie liegt bei uns allen.
Ihr Markus Gentner
DWN-Chefredakteur