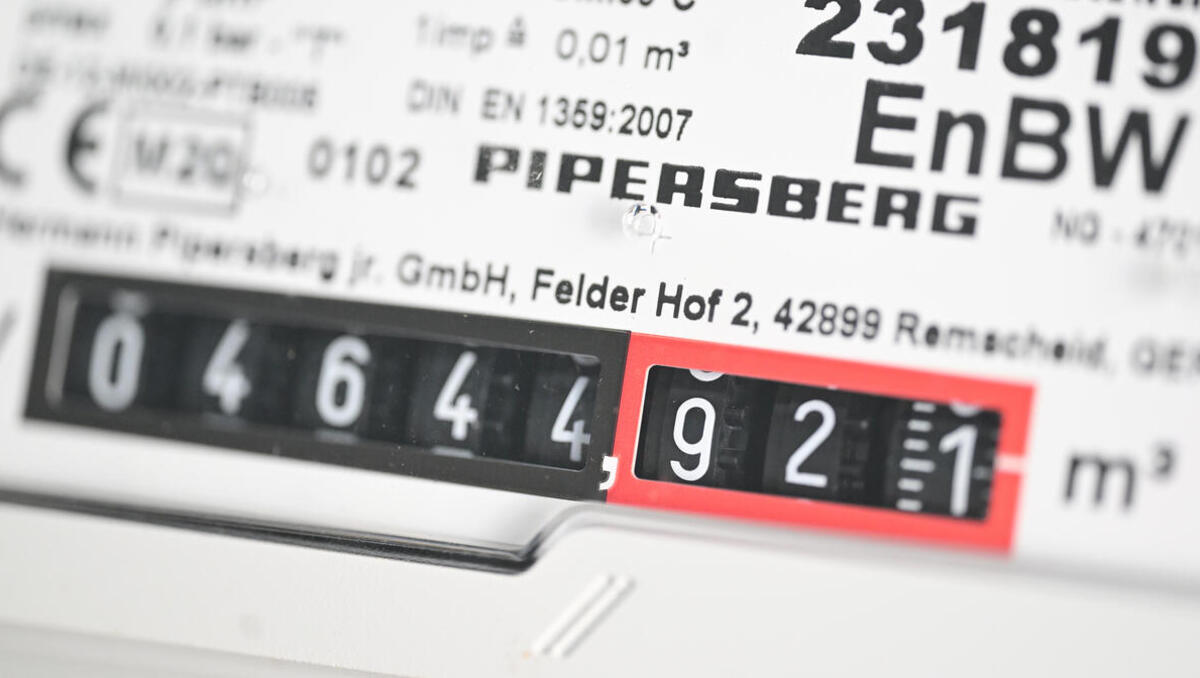COP30: Wetterextreme treffen Entwicklungsstaaten am härtesten
Wirbelstürme, Hitzewellen, Fluten: Ganze Regionen kommen kaum noch zur Ruhe angesichts immer neuer Wetterextreme. Ein kleiner Inselstaat steht an der Spitze der traurigen Statistik.
Entwicklungsstaaten sind in den vergangenen 30 Jahren am verheerendsten von Wetterextremen wie Hitzewellen, Stürmen und Überflutungen getroffen worden. Dies zeigt der neue Klimarisiko‑Index 2026, den die Umwelt‑ und Entwicklungsorganisation Germanwatch zur UN‑Klimakonferenz in Brasilien veröffentlicht hat. Die Länder werden teilweise in so kurzen Abständen heimgesucht, dass sich ganze Regionen kaum noch von den Katastrophen erholen können, wie Co‑Autorin Vera Künzel sagte. Das gelte speziell für Haiti, die Philippinen oder Indien, allesamt in den Top Ten.
Erst am Wochenende hatte – wenige Tage nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" – ein neuer Sturm die Philippinen hart getroffen. Über den Inselstaat ziehen im Durchschnitt rund zwanzig tropische Wirbelstürme pro Jahr.
830.000 Todesopfer in drei Jahrzehnten erfasst
In 30 Jahren verzeichnet der Index nun schon mehr als 9.700 Wetterextreme mit gut 830.000 Todesopfern und inflationsbereinigt 4,5 Billionen US‑Dollar an direkten Schäden. Dabei stellten Hitzewellen und Stürme die größte Gefahr für Menschenleben dar, wie Laura Schäfer, eine weitere Autorin, sagte. Stürme verursachten zugleich die mit Abstand grössten Sachschäden.
An der Spitze des Index über 30 Jahre steht Dominica – ein kleiner karibischer Inselstaat. Er wurde schon mehrmals von Wirbelstürmen heimgesucht. Allein der Hurrikan Maria 2017 verursachte dort laut Germanwatch Schäden von 1,8 Milliarden US‑Dollar – nahezu das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts. Myanmar kommt auf Rang zwei. Hier tötete allein der Zyklon Nargis 2008 fast 140.000 Menschen und richtete Schäden von 5,8 Milliarden US‑Dollar (5 Mrd. Euro) an. Das unterstreiche den wissenschaftlich bestätigten Trend, dass tropische Wirbelstürme in einer wegen der Klimakrise heißeren Welt stärker und gefährlicher werden, hieß es.
Forderungen auf der Klimakonferenz
Auf der Klimakonferenz fordern ärmere Staaten deutlich mehr Hilfen, um sich der Klimakrise so gut es geht anzupassen. Der Bedarf ist gigantisch. Der neue UN‑Report zur "Anpassungslücke" zeigt, dass Entwicklungsländer bis 2035 jährlich mindestens 310 Milliarden US‑Dollar (268 Milliarden Euro) dafür brauchen – das Zwölffache der derzeitigen internationalen öffentlichen Finanzmittel.
Auch Industrieländer betroffen
Aber auch EU‑Staaten und Industrieländer wie Frankreich (Rang 12), Italien (16), die USA (18) und selbst Deutschland (29) landen im oberen Bereich der betroffenen Länder. Neben den Sachschäden spielen auch Todesopfer in Deutschland eine Rolle. "In der Öffentlichkeit wird bisher unzureichend wahrgenommen, wie viele Todesopfer massive Hitzewellen oft fordern", erklärte Co‑Autor David Eckstein.
Hierzulande waren demnach vor allem in den Sommern 2003, 2022 und 2023 insgesamt fast 24.000 Todesopfer zu verzeichnen. "Viele Todesopfer forderten zudem die Flutkatastrophen im Westen Deutschlands im Jahr 2021", erklärte Eckstein. Die gesamten Schäden belaufen sich seit 1995 inflationsbereinigt auf knapp 130 Milliarden US‑Dollar (112 Milliarden Euro).
Bedeutung für Unternehmen
Vor dem Hintergrund der COP30‑Konferenz in Belém rückt Klimaanpassung zunehmend in den Fokus von Unternehmen: Laut dem United Nations Environment Programme schätzt man die jährlichen Anpassungskosten für Entwicklungsländer bis 2035 auf über 310 Milliarden US‑Dollar. Diese Summe entspricht etwa dem Zwölffachen der derzeitigen öffentlichen Mittel. Für CEO s und Mittelständler eröffnen sich damit markante Chancen: Investitionen in Infrastruktur‑Resilienz, Lieferketten‑Anpassung oder Versicherungsmodelle gegen Wetterrisiken sind nicht nur ethisch geboten, sondern zunehmend wirtschaftlich strategisch.
Ein aktueller Bericht von Reuters zeigt, dass ohne gezielte Anpassungsmaßnahmen Unternehmen bis 2050 mit jährlichen Verlusten von bis zu 1,2 Billionen US‑Dollar rechnen müssen. Auf der COP30 dürften daher private Akteure stärker in die Pflicht genommen werden; eine frühzeitige Risiko‑Analyse und Anpassungsstrategie wird zu einem Wettbewerbsfaktor. Unternehmen sollten jetzt prüfen, wie ihre Geschäftsmodelle extreme Wetterereignisse, Unterbrechungen von Lieferketten oder Ausfälle von Infrastruktur bewältigen — und gelten damit nicht nur als verantwortungsbewusst, sondern sichern sich auch operativ gegen steigende Risiken ab.