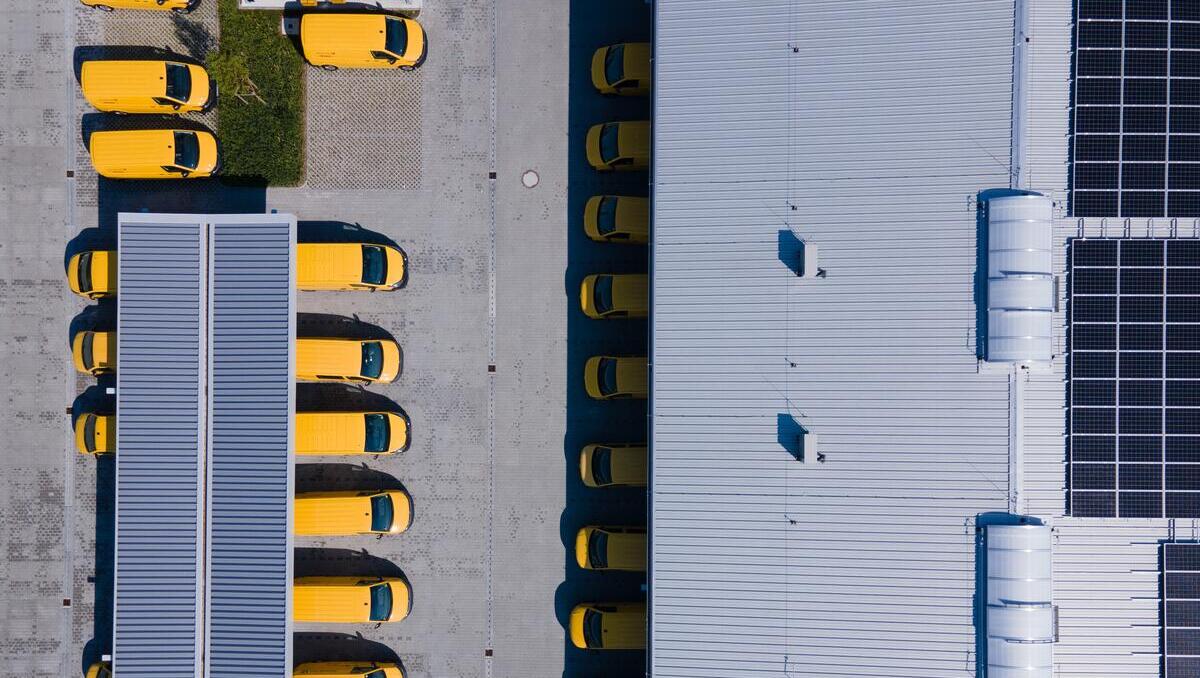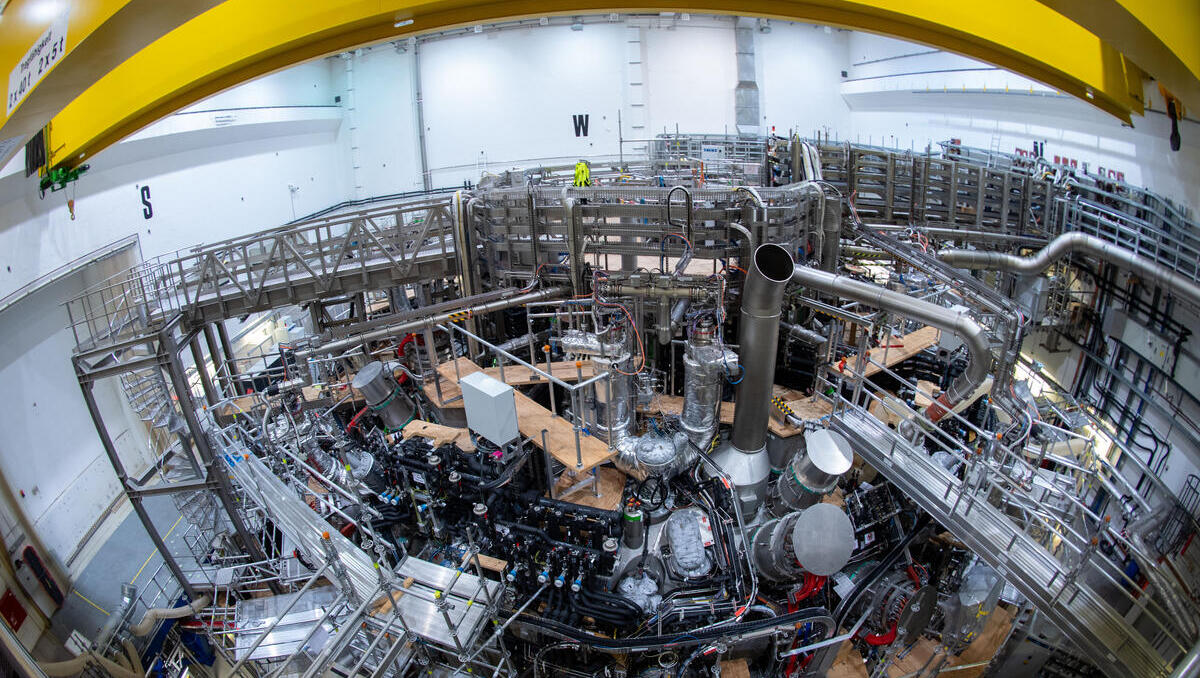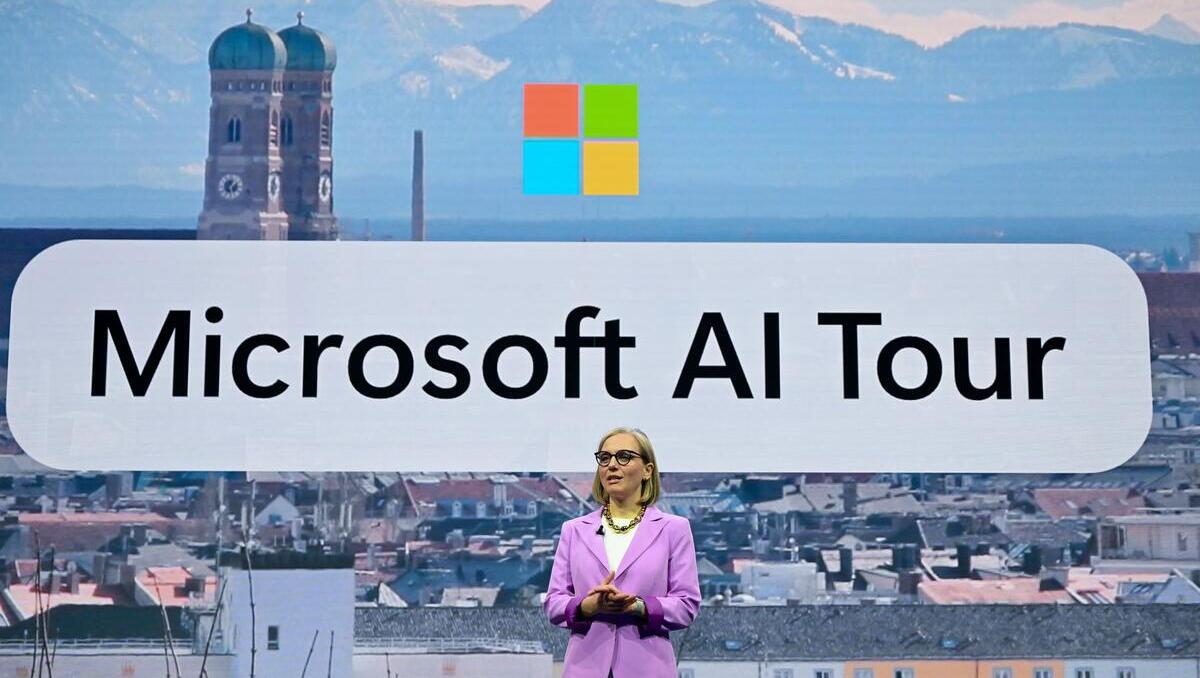Für jedes einzelne Produkt, das man kauft, kann man selbst nachrechnen, wie viel es sich binnen zwölf Monaten verteuert hat – vorausgesetzt natürlich, man hat ein gutes Gedächtnis oder hebt seine Quittungen entsprechend lange auf. Was den Benzinpreis angeht: da hilft der ADAC – er weiß zum Beispiel, dass Super E10 derzeit rund ein Viertel mehr kostet als noch vor einem Jahr.
Doch wie sieht es für die Verbraucherpreise in ihrer Gesamtheit aus? Hier kommt das Bundesamt für Statistik ins Spiel – es behauptet, die Veränderung genau feststellen und beziffern zu können und veröffentlicht dementsprechend jeden Monat die offizielle Inflationsrate für Deutschland.
Auf den ersten Blick scheint die die entsprechende Berechnung leicht möglich: Man bilde einfach einen repräsentativen Warenkorb und notiere über zwölf Monate hinweg die jeweils geltenden Preise. Anschließend kann man jedes Jahr wieder für jeden einzelnen Monat die neuen Preise mit den alten vergleichen. So macht es auch das Statistische Bundesamt, das tausende Produkte in seinem Warenkorb hat, darunter neben Nahrungsmitteln auch Kostenträger wie Wohnen, Kleidung, Verkehr und Freizeit. Die einzelnen Faktoren werden gemäß ihrem Verbrauch gewichtet: So gingen beispielsweise die Preisänderungen bei Butter zuletzt mit einer Gewichtung von 0,119 Prozent in die Berechnung der Inflationsrate ein und die Preisänderungen bei Eiern mit 0,143 Prozent.
Die Probleme mit dem Warenkorb
Doch wenn man genauer hinblickt, zeigen sich Probleme, die letztlich mit Mitteln der Statistik nicht gelöst werden können. Schon die Gewichtung ist ein solches Problem. Warum flossen zuletzt Butter mit 0,119 Prozent und Eier mit 0,143 Prozent in die durch den Warenkorb symbolisierte Inflationsrate ein? Nun, diese Zahlen sollen den tatsächlichen durchschnittlichen Verbrauch widerspiegeln. Doch liegt gerade hier das Problem: Das Kaufverhalten ist nämlich immer auch vom Preis abhängig; wenn ein Gut teurer wird, wird es von den Konsumenten weniger stark nachgefragt – und sollte dementsprechend eine geringere Gewichtung im Warenkorb erhalten. Fazit: Es ist also gar nicht möglich, einen objektiven Warenkorb zu bilden und damit die Preisentwicklung zu messen, da der Warenkorb selbst an der Preisentwicklung hängt.
Das Statistische Bundesamt reagiert auf dieses Dilemma dahingehend, dass es die Gewichtung innerhalb des Warenkorbs alle fünf Jahre ändert. Immerhin. Doch innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren verändert sich das Konsumverhalten der Menschen; das heißt, der Warenkorb bildet den tatsächlichen Konsum nicht mehr ab. So kam das Rauchen vor einiger Zeit stark aus der Mode; der Konsum und damit die Ausgaben für Tabak gingen innerhalb relativ kurzer Zeit stark zurück. Darüber hinaus kommen immer wieder neue Produkte auf den Markt wie zum Beispiel vor einigen Jahren der Streamingdienst „Netflix“, dessen Programm natürlich kostenpflichtig ist – was sich selbstverständlich auf die Zahl der Kinobesuche sowie die Anschaffungen von DVDs auswirkte.
Die Erstellung eines Warenkorbs geht darüber hinaus davon aus, dass sich die Qualität der darin enthaltenen Produkte nicht ändert. Denn wie soll ein Statistiker objektiv bewerten, ob zum Beispiel ein neues Design oder veränderte Inhaltsstoffe ein Produkt hochwertiger machen (was bedeuten würde, dass der höhere Preis nicht inflationsbedingt wäre, sondern die gestiegene Qualität widerspiegelt). Wenn etwa ein Computer schneller und kleiner wird, muss der Statistiker letztlich subjektiv und willkürlich entscheiden, wie viel besser das neue Gerät ist. Manch einer würde etwa sagen, dass die heutigen Autos gar nicht teurer sind als diejenigen von vor zehn Jahren, sondern dass sie mit all der eingebauten Elektronik einfach besser geworden sind, was sich dann auch in den heute höheren Preisen niederschlage.
Inflation: Schlechtes Maß mit großen Folgen
Trotz aller Probleme mit ihrer Aussagekraft gilt die mit Hilfe des Warenkorbs gemessene Inflationsrate als unbedingte Wahrheit und hat dementsprechend großen Einfluss. Vor allem die Europäische Zentralbank schaut genau auf sie. Denn die EZB hat sich verpflichtet, eine Inflationsrate von zwei Prozent anzustreben – was ihr jedoch bei Weitem nicht gelingt. In der Theorie kann die Notenbank eine höhere Inflation herbeiführen, indem sie mit frischem Geld Wertpapiere kauft oder die Zinsen senkt. Oder sie kann eine niedrigere Inflation herbeiführen, indem sie Wertpapiere abbaut und das damit eingenommene Geld wieder vernichtet. Aber die Realität, die sieht anders auf. Schaut man sich die Entwicklung der letzten Jahre an, wird offensichtlich, dass die EZB wenig Kontrolle über die Inflationsrate hat, die vor kurzem noch negativ war – und aktuell über fünf Prozent beträgt. Aber die Rate von zwei Prozent dient den Bankern dennoch weiterhin als Grundlage ihrer Geldpolitik: ein massiver wirtschaftspolitischer Übelstand!
Tatsache ist nämlich: Einen viel größeren Einfluss auf die Verbraucherpreise als die Politik der Notenbanken hat das Kaufverhalten der Bürger. Die Erfahrung zeigt, dass das extreme Gelddrucken und die äußerst niedrigen Zinsen die Inflationsrate in den vergangenen Jahren – entgegen der Theorie – sogar gedrückt haben. Ein Grund dafür war (und ist, denn der Zustand hält weiter an), dass viele Bürger Angst um ihre finanzielle Zukunft hatten, deshalb sparsamer wurden und weniger konsumierten. Mit dem logischen Ergebnis, dass die sinkende Nachfrage nach Konsumgütern die Verbraucherpreise drückte. Zugleich stiegen die Preise für Geldanlagen, da die Bürger mehr sparten und ihr Geld investierten. Dies zeigte sich an den Preisen für Wertpapiere aller Art und für Immobilien. Die lockere Geldpolitik hat zwar auch die einige Konsumgüter – also die Produkte im Warenkorb – etwas teurer gemacht, aber bei weitem nicht so stark wie die Anlageprodukte.
Die Geldmenge als Maß für Inflation
Die offizielle Inflationsrate ist also kein Maß für den Wert des Euro, wie man oft hört, sondern lediglich ein (schlechtes) Maß für den Anstieg der Verbraucherpreise. Denn wenn der Euro so wertbeständig wäre, wie die Inflationsrate es aussehen lässt, wie ließen sich dann die überdurchschnittlich hohen Preisanstiege bei Geldanlagen und Immobilien erklären? Zudem durchaus zu erwarten ist, dass das Pendel irgendwann wieder zurückschwingen wird, dass heißt, dass Geldanlagen relativ zu Konsumgütern wieder günstiger werden, beziehungsweise dass Konsumgüter relativ zu Geldanlagen wieder teurer werden. Denn letztlich legt man sein Geld ja nur deshalb an, damit man damit irgendwann in der Zukunft wieder konsumieren kann.
Die Ökonomen der Österreichischen Schule vermeiden daher alle komplizierten Bemühungen der Statistiker, mithilfe eines Warenkorbs einen Verbraucherpreisindex erstellen zu wollen, und schauen allein auf die Geldmenge. Sie argumentieren, dass das Geld eben weniger wert ist, wenn es mehr davon gibt, und dass es wertvoller ist, je knapper es wird. Ludwig von Mises erklärte dies im Jahr 1958 wie folgt: „Wenn das Angebot an Kaviar so reichlich wäre wie das Angebot an Kartoffeln, würde sich der Preis für Kaviar – das heißt das Austauschverhältnis zwischen Kaviar und Geld oder Kaviar und anderen Waren – erheblich ändern. [...] Ebenso sinkt die Kaufkraft der Geldeinheit, wenn die Geldmenge erhöht wird, und die Warenmenge, die für eine Einheit dieser Geldeinheit erworben werden kann, nimmt ebenfalls ab.“
Wie gut durchdacht diese Theorie ist, kann man mittels eines einfachen historischen Beispiels zeigen: Im 16. Jahrhundert entdeckten die Europäer große Gold- und Silbervorkommen in Amerika. Weil das viele Edelmetall, das nach Europa gebracht wurde, dort die Geldmenge erhöhte, stiegen auch die Preise. Denn die Kaufkraft einer einzelnen Goldmünze verringerte sich. Auf die gleiche Weise verliert nach Auffassung der Österreichischen Schule heute auch der Euro in dem Maße an Kaufkraft, wie sich die Menge an Euros erhöht. Aber: Die verringerte Kaufkraft zeigt sich nicht prinzipiell in allen Bereichen in gleichem Maße. Es können zum Beispiel die Immobilienpreise sein, die stärker ansteigen, oder auch die Nahrungsmittelpreise. Entscheidend ist, auf welchem Weg das neu geschaffene Geld in den wirtschaftlichen Kreislauf gebracht wird.
Zur Messung oder gar zur Prognose der Verbraucherpreise für einzelne Güter, ja zur Prognose der Verbraucherpreise an sich, taugt die Entwicklung der Geldmenge also nur wenig. In den USA etwa hat sich Geldmenge M1 in den letzten zwei Jahren mehr als vervierfacht. Wenn das in gleicher Relation auf die Verbraucherpreise durchschlagen würde, müssten die Inflationsraten im dreistelligen Bereich liegen. Tatsächlich sind die Inflationsraten jedoch weiter „nur“ einstellig. Und auch Anlageprodukte haben sich zwar massiv verteuert, jedoch gibt es keine Vervierfachung der Preise. Die Geldmenge allein ist also offensichtlich kein gutes Maß für die Wertentwicklung einer Währung, für die Messung der Inflation. Während der Preisanstieg des Warenkorbs die Inflation zu gering bemisst, scheint die Geldmengenentwicklung die Inflation tendenziell zu hoch zu schätzen. Ein Instrument, mit Hilfe dessen man die Inflation korrekt berechnen und prognostizieren könnte, fehlt also weiterhin.