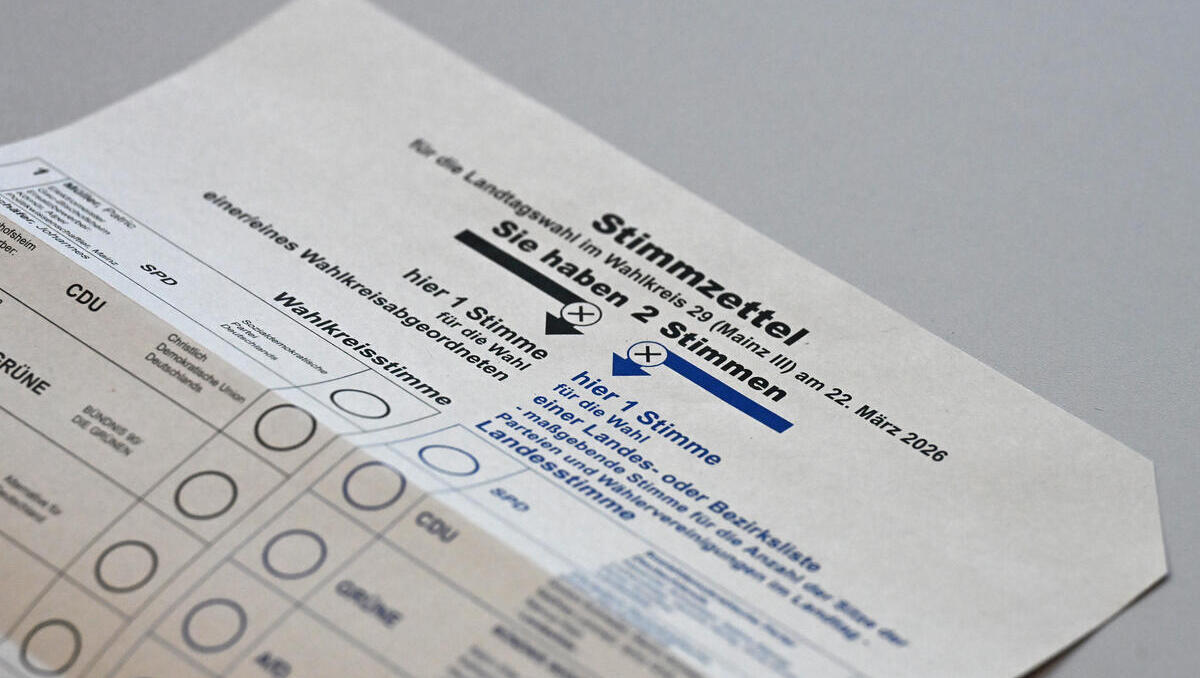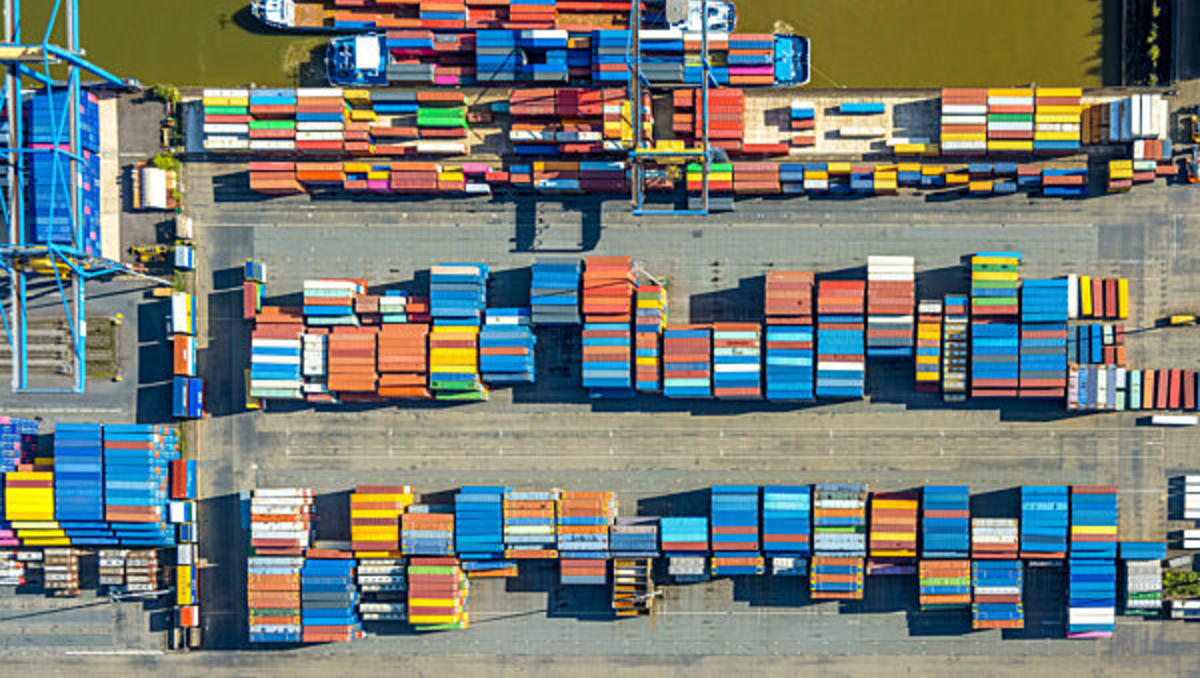Steigende Preise für Lebensmittel, Kraftstoffe und Energie sind ein weltweites Problem. Die Inflation, Folgen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine haben eine toxische Mischung erzeugt, die den Zusammenhalt der Gesellschaft in vielen Ländern gefährdet. Forscher aus aller Welt schlagen nun Alarm, dass diese Mischung die Gefahr von sozialen Unruhen deutlich erhöht.
Gefahr für soziale Unruhen steigt weltweit an
Das Wirtschaftsmagazin Economist hat ein statistisches Modell entwickelt, um die Beziehung zwischen der Inflation der Lebensmittel- und Energiepreise und Unruhen zu bewerten. Dazu hat das Magazin die Daten eines globalen Forschungsprojekts namens ACLED über alle Formen von Unruhen (Massenproteste, politische Gewalt und Aufstände) seit 1997 verwendet. Es stellt sich heraus, dass ein Anstieg der Lebensmittel- und Energiepreise ein starkes Signal für anstehende politische Instabilität ist.
Die Preisanstiege waren selbst dann noch ein signifikanter Faktor bei der Vorhersage von Unruhen, wenn Demografie und Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) berücksichtigt wurden. Basierend auf diesem Modell schätzt der Economist, dass sich die Zahl der Unruhen in den kommenden Jahren weltweit verdoppeln wird. In einigen Ländern ist die Lage bereits heute stark angespannt. Laut der Vorhersagen liegt die Chance bei 50 Prozent, dass es in Pakistan, Kirgisistan, Tunesien, Uganda und Südafrika in den kommenden zwölf Monaten zu verstärkten Unruhen kommen wird. Für Turkmenistan und Ägypten liegt die Chance sogar bei 75 Prozent.
Die sozialen Spannungen auf der Welt haben sich über viele Jahre aufgebaut. Das Institute for Economics and Peace (IEP) hat berechnet, dass 84 Länder seit 2008 weniger friedlich geworden sind, nur in 77 Ländern hat sich die Lage verbessert. Die Zahl der gewalttätigen Proteste sei im gleichen Zeitraum um 50 Prozent gestiegen, warnt der australische Think-Tank. Auch der Internationalen Währungsfonds (IWF) schätzt, dass sich die Lage derzeit wieder zuspitzt. Eine Auswertung von Medienberichten aus 130 Ländern, die in den letzten Jahren mit sozialen Unruhen in Zusammenhang gebracht werden, ergab, dass die Lage dort den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie erreicht hat. Die Pandemie stellte demnach nur eine kurze Pause dar in einem Trend von seit Jahren steigenden sozialen Spannungen.
Der stärkste Faktor für die Vorhersage künftiger Instabilität ist die Instabilität in der Vergangenheit. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle IWF-Studie. Die Forscher haben sich die sozialen Unruhen in verschiedenen Ländern im Lauf der Geschichte angesehen und ein Muster erkannt. Demnach liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Land in einem bestimmten Monat schwere soziale Unruhen erlebt, bei nur einem Prozent. Dieser Wert vervierfacht sich jedoch, wenn das Land in den vorangegangenen sechs Monaten unter solchen Unruhen gelitten hat, und verdoppelt sich, wenn ein Nachbarland davon betroffen war.
Eine gefährliche Mischung: Inflation, Pandemie und Krieg
Die ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken und die hohen Staatsausgaben der letzten Jahre fordern nun in Form rasant steigender Inflation ihren Tribut. Die Pandemie hat in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu hoher Arbeitslosigkeit und gestörten Lieferketten geführt. Hinzu kommt der Krieg in der Ukraine, der Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben und den Energie-Markt unter Druck gebracht hat. Dadurch sind weltweit Millionen Menschen von Hunger bedroht.
Besonders in Afrika sind viele Länder abhängig von Getreidelieferungen aus der Ukraine. Ersatz für diese Lieferungen ist logistisch schwierig und teuer. Die Lage dürfte sich in den kommenden Monaten sogar noch verschärfen, denn besonders in ärmeren Ländern werden die Kosten für Lebensmittel und Energie weiter steigen. Währenddessen sind die Staatsschulden dieser Länder durch den Kampf gegen die Pandemie und ihre Auswirkungen auf ein bedenkliches Niveau angestiegen.
„Viele Regierungen würden die Effekte gerne abmildern. Aber da sie sich während der Pandemie stark verschuldet haben und die Zinsen steigen, sind viele dazu nicht in der Lage. All dies verschärft die bereits bestehenden Spannungen in vielen Ländern und macht Unruhen wahrscheinlicher“, zitiert der Economist den Konfliktforscher Steve Killelea vom IEP.
Der IWF schätzt, dass das durchschnittliche Schuldenniveau ärmerer Länder bei rund 70 Prozent Staatsverschuldung vom Bruttoinlandsprodukts (BIP) liegt und erwartet, dass diese Verschuldung in den kommenden Jahren weiter steigt. Was auf den ersten Blick nach einer geringen Staatsverschuldung aussieht (Italien als achtgrößte Volkswirtschaft der Welt hat eine Staatsverschuldung von rund 150 Prozent), wirkt bei näherem Hinsehen bedrohlich. Denn ärmere Länder müssen am Kapitalmarkt auch deutlich höhere Zinsen zahlen, um sich zu refinanzieren. Nach Angaben des IWF sind 41 Länder, in denen 7 Prozent der Weltbevölkerung leben, von ernsthaften Schuldenproblemen betroffen.
In der Türkei spitzt sich die Lage zu
Ein Land, das ebenfalls auf der Liste der instabilen Staaten steht, ist die Türkei. Der Economist beziffert die Chance, dass es in der Türkei in den nächsten zwölf Monaten zu sozialen Unruhen kommt, mit 25 Prozent. Die Inflation stieg im Juni auf fast 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das entspricht dem höchsten Wert seit 24 Jahren. Hinzu kommt die Unterbrechung der Lebensmittel- und Treibstoffimporte aus der Ukraine und Russland, die die Preise in der Türkei in die Höhe schnellen lassen.
Zu allem Übel schüttet die Zentralbank des Landes mit ihrer Geldpolitik auch noch Öl ins Feuer. Statt die Zinsen angesichts der grassierenden Inflation zu erhöhen, ordnete Regierungschef Erdogan, der die Zentralbank heute de facto kontrolliert, die Senkung der Zinsen an, denn er zeigt sich überzeugt davon, dass hohe Zinsen Inflation verursachen. Das Ergebnis ist eine beispiellose Talfahrt der türkischen Lira. Seit Anfang des Jahres hat die Währung fast 25 Prozent an Wert verloren.
Um den Währungsverfall aufzuhalten und zu verhindern, dass die türkische Bevölkerung ihr Vermögen ins Ausland schafft (und den Verfall damit weiter beschleunigt), hatte die Regierung 2021 alle Bürger aufgefordert, ihre Gelder auf spezielle, abwertungsgeschützte Konto zu transferieren. Verbunden war die Aufforderung mit dem Versprechen des Staates, jegliche Defizite auszugleichen, sollte die Lira im Vergleich zum Dollar weiter abwerten.
Da die Lira nun seit Jahresbeginn weiter abgestürzt ist, sind viele Türken der Aufforderung gefolgt und haben in den letzten sechs Monaten rund 960 Milliarden Lira (54 Milliarden Euro) auf diesen Konten geparkt. Für die türkische Regierung ist das eine enorme finanzielle Verpflichtung, die rund sieben Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung entspricht. Und mit jedem Tag, an dem die Lira weiter fällt, steigt die drohende Rechnung für den Staat. Der türkische Oppositionspolitiker Garo Paylan bezeichnet das als „Dynamit im System“. Denn sollte die Regierung ihr Versprechen brechen und die Defizite nicht ausgleichen, wären soziale Unruhen vorprogrammiert.