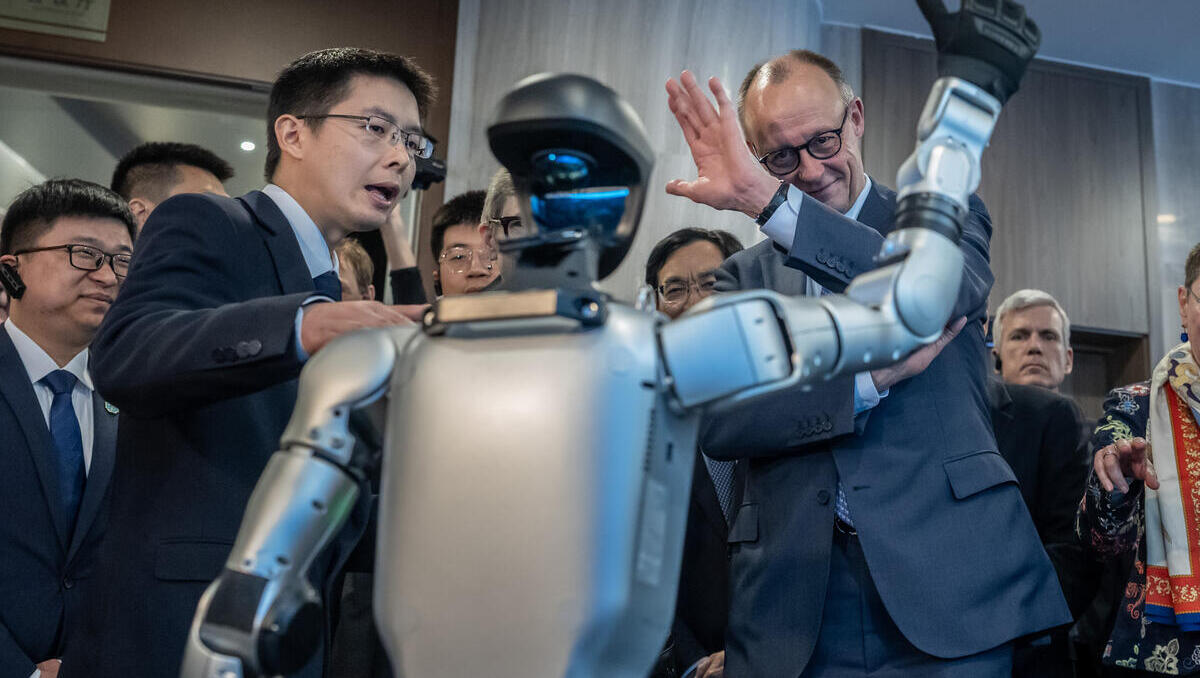Die Vermögen auf den Konten und in den Portfolios der privaten Haushalte in Deutschland sind im vergangenen Jahr von 8,8 Billionen auf 9,3 Billionen Euro gestiegen. Das hat die Research-Abteilung der DZ-Bank eruiert.
Aktieninvestments: Warum immer noch viel zu viel Geld auf dem Girokonto versauert
„Bereits 2023 sorgten kräftige Kurszuwächse an den Aktienmärkten für einen beschleunigten Aufbau des Geldvermögens. Und auch im zurückliegenden Jahr liefen Aktien sehr gut. So konnte beispielsweise der DAX von Jahres-Börsenschluss 2023 bis Ende 2024 um rund 19 Prozent zulegen“, lautet die Einschätzung der Banker. Als Kehrseite der Medaille wird freilich die „vergleichsweise hohe Sparquote durch verunsicherte Konsumenten“ erachtet. Die Deutschen halten sich in unsicheren Zeiten extrem mit Ausgaben zurück. Was viele für eine Tugend halten, ist freilich Gift für die Konjunktur.
Nur gut 11,5 Prozent ihres Einkommens haben die privaten Haushalte auf die hohe Kante gelegt. „Im historischen Vergleich ist das eine sehr hohe Sparquote, die zuletzt lediglich in der Ausnahmesituation der Corona-Krise 2020 und 2021 gestoppt wurde. Das bremst die dringend notwendige konjunkturelle Erholung“, heißt es weiter. Außerdem seien (die von Verunsicherung getriebenen) Ersparnisse nicht für den Vermögensaufbau genutzt worden - viel zu viel Geld blieb in den letzten Monaten einfach auf dem Girokonto stehen.
Aktiengewinne summieren sich inzwischen auf über 200 Milliarden Euro
Für die Börsen war 2024 ein gutes Jahr - in den USA kann man mit Fug und Recht von einer Hausse (vor allem im Tech-Sektor) sprechen. Auch der DAX in Deutschland ist um 19 Prozent gestiegen. Es hat sich herumgesprochen, dass sich wohl nur an der Börse kontinuierlich Vermögen aufbaut lässt und die Inflationsrate ausgleichen kann. Obendrein geht es vielen Bürgern um eine zweite verlässliche Säule, um der Unsicherheit der klassischen Rentenversicherung entgegenzuwirken und das Risiko einer unzureichender Absicherung im Alter zu mindern.
Während die Politik die von der FDP vorgeschlagene Aktienrente während der Ampel-Koalition vertändelt hat, haben Anleger zunehmend die Chancen ergriffen sich, an den Blue Chips der Wirtschaft zu beteiligen und nebst Dividenden vor allem auf Wertzuwachs ihren Aktien zu setzen. Während nur 4,2 Millionen Menschen Einzelaktien besitzen, sind es mittlerweile insgesamt 12,1 Millionen Bürger, die dank der immer beliebter werdenden ETF-Fonds am Kapitalmarkt investiert sind. Das geht aus aktuellen - vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) - veröffentlichten Zahlen hervor. Das sind nominell zwar um 200.000 Anleger weniger als im Vorjahr. Doch der seit mit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 zu verzeichnende Rückgang ist angesichts der wirtschaftlich verschlechterten Lage unserer Wirtschaft nicht wirklich verwunderlich. In der ökonomisch stabilen Vor-Corona-Zeit waren es nur wenig mehr als neun Millionen Trader.
So weit wie in den USA sind wir freilich noch immer nicht: Amerikaner halten nur 13 Prozent ihres Geldvermögens in bar, mehr als die Hälfte freilich in Unternehmensanteilen und Investmentfonds. Mehr als ein Fünftel der US-Familien hält sogar direkt Aktien von Unternehmen. Und die Gesamtzahl steigt auf 58 Prozent, wenn man indirekte Anlagen wie Rentenfonds in die Betrachtung mit einbezieht. Statt die Bürger dort zum weiteren Aderlass zu bitten, wird dort mit dem 401k-Modell das Altersvorsorgesystem gestärkt und vom US-Staat gefördert, indem Arbeitnehmer einen Teil ihres Bruttogehalts in einen Pensionsplan einzahlen, der meist in Aktien und ETFs investiert ist.
Sozialbeiträge auf Aktieneinkünfte? Mehr rote Ideologie statt eines grünen Daumens
Die Aktienkultur in Deutschland ist ein zartes Pflänzchen, für das viele grobe Gärtner in den politischen Parteien einfach noch immer kein Gespür haben. Wenn der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck die ohnehin (schon um 25 Prozent Kapitalertragssteuer) gekürzten Aktiengewinne mit vermeintlich geschuldeten Sozialabgaben belasten möchte, bezeugt er eher rote Ideologie statt eines grünen Daumens.
Bemerkenswert bei der Analyse des Aktienvermögens ist die Frage, wie die Anleger eigentlich „Hands on“ und ganz praktisch investieren. Dazu hat die Bundesbank ganz eindrückliche Informationen zur Verfügung gestellt: Im September 2024 hielten die Bundesbürger demnach Einzeltitel im Wert von 580 Milliarden Euro - längst nicht nur im Inland, sondern verstärkt auch in den USA und Asien. Das Aktienvermögen der Deutschen so groß wie nie. Zehn Jahre zuvor waren es erst 230 Milliarden Euro gewesen.
Auch bei Investmentfonds ist ein deutlicher Leap in die Höhe zu verzeichnen. Von Fondsanteilen in Höhe von für 450 Milliarden Euro Anno 2014 sind es zum letzten Stichdatum der Bundesbanker im September 2024 schon inzwischen 1,1 Billionen Euro – ebenfalls neuer Rekordwert.
Damit zeichnet sich ein überfälliger Paradigmenwechsel ab. Statt weiter den Irrungen des früheren Arbeitsministers Walter Riester von der SPD zu folgen oder gar weiter den Versprechungen der AWD-Drücker (nach der Masche Carsten "Nomen ist omen" Maschmeyers) zu folgen und in ertragsschwache Lebensversicherungen zu investieren, halten sich die beiden Anlageformen mittlerweile fast schon die Waage. Nur noch 1,2 Billionen Euro stecken in alten Policen fest und sorgen wegen ihrer niedrigen Verzinsung weiterhin für Kopfschmerzen. Dass Aktien und Aktienfonds deutlich bessere Renditen vorweisen können, spricht sich herum. Laut Bundesbank sind 6,4 Prozent des Geldvermögens in Aktien angelegt - und 12,2 Prozent in Investmentfonds.
In Aktien investieren: Warum Zinsen auf Tages- und Festgeldkonten keine wirkliche Alternative sind
Die Freude der Aktionäre über starke Wertzuwächse findet indessen bei Sparern kaum Entsprechung bei den Erträgen ihrer Zinsprodukte. Die Deutsche Bundesbank beziffert den Durchschnittszins, den Bankkunden für neu angelegtes Tagesgeld erhalten, mit 0,5 Prozent. Angesichts manch verlockender Angebote etwa von Neobanken ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Bei der Inflationsrate von derzeit 2,6 Prozent bedeutet dies nur, dass die große Mehrheit der Sparer trotz erfreulich hoher Rücklagen und Sparpolster mit ihren Guthaben auch weiterhin noch an Kaufkraft verlieren - egal ob die hart erarbeiteten Spargroschen realiter auf Tagesgeldkonten, Giro- und Sparkonten liegen oder altbewährt als Bargeld unter der Matratze schlummern.
Das Gros des deutschen Wohlstands ist in Bankeinlagen und Bargeld-Reserven gebunkert. Mit 3,3 Billionen der über neun Billionen Euro, auf die die Bundesbanker als privates Geldvermögen hochgerechnet haben, sind dies effektiv 37 Prozent des finanziellen Reichtums. Und der wird nicht von Robert Habeck mit seinem Vorschlag geschmälert, sondern von der anhaltenden Inflation, die die Bürger bei ihrer persönlichen Sparquote nicht einbeziehen. Die Summe des deutschen Reichtums wächst zwar. Doch viele Bürger verlieren tatsächlich viel Geld, sie ahnen dies nur nicht. Inflationsbereinigt steht das Land nicht besser da als im Jahr 2020 - dem Jahr der ersten großen Zäsur durch Corona.
Die Deutsche Bank ist jedoch überzeugt: „Künftig dürfte das Bargeld als Spargeld aber verschwinden. Daran ist nicht nur die Rückkehr der Zinsen schuld, sondern vor allem die fortschreitende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs, die mit digitalen Zentralbank-Währungen einen weiteren Schub erfahren dürfte - Scheine und Münzen sind in manchen Ländern schon heute eher ein Relikt. Und Bargeld hat den großen Nachteil, dass es weder Zinsen abwirft noch im Wert steigt.“ Insofern ist der Kauf von Gold womöglich der bessere Weg, wenn man sich denn ein Schließfach im Keller der Bank leistet und die Barren oder Plättchen nicht im Wäscheschrank versteckt.
Bei Sachwerten dominieren die soliden Blue Chips - kaum IPOs mehr an der Frankfurter Börse
Die Lektion aus Sicht von Finanzexperten lautet: „Wer langfristige Kaufkraftverluste vermeiden möchte, kommt an Sachwerten nicht vorbei.“ Der Deutsche Aktienindex hat inmitten der wirtschaftlichen Krise Deutschlands bei knapp unter 21.000 Punkten ein neues Allzeithoch erklommen. Börsen-Insider beobachten als Reaktion auf die Großwetterlage allerdings einen neuen Trend: Die Anleger setzen ihr Geld zunehmend auf solide Unternehmen statt auf spekulative Newcomer. Wer zur Corona-Zeit noch Gefallen an kurzfristig hell erleichtere, aber schon fast gänzlich ausgeglühte Sternschnuppen gesetzt hat, geht jetzt lieber auf Nummer sicher und investiert in die großen Namen wie Apple, Amazon, Alphabet, Meta oder Microsoft.
Auch deutsche Firmen, so vermuten Analysten, könnten anno 2025 vor einem Rebound stehen und den verlorenen Anschluss an die Aktien Wall Street verringern - SAP, die Telekom und Infineon etwa. Bei den inländischen Automobil-Herstellern wird sich dies wohl erst noch zeigen müssen. Bedauerlich ist, dass es in Frankfurt nur noch selten einen Börsengang zu feiern gibt. Heiko Leopold, bei der Deutschen Bank für IPOs zuständig, erinnert an die die Aufbruchstimmung, die vorübergehend nach Corona geherrscht hat. 2021 war das letzte Jahr, in dem es auch mehrere kleine IPOs gab. Aktien von schnell wachsenden, meist defizitären Tech-Firmen wurden hoch gehandelt. „Doch viele dieser Börsenneulinge haben anschließend eine schlechte Kursentwicklung gezeigt“, bedauert Leopold. „Seitdem verlangen die Eigenkapitalinvestoren wieder, dass Unternehmen profitabel sind und sich selbst finanzieren können.“
Sparvermögen heben, hüten und hebeln - für Infrastrukturprojekte und die Verteidigung Europas
Hoffnungen, dass sich die Lage am Finanzmarkt - auch in Europa - endlich verbessern könnte, nährt derweil die EU-Kommission unter Führung Ursula von der Leyens. Sie will einen europäischen Kapitalmarkt schaffen, der nicht weiter die USA (und Donald Trumps jetzt verschärft drohendes "Deficit spending") finanziert und damit in die Karten spielt, sondern ein volkswirtschaftliches Gegengewicht zur Macht zur Wall-Street schafft. Es geht darum, unser enormes Sparvermögen diesseits des Atlantiks zu heben, zu hüten und zu hebeln, um es für eine ordentliche Rendite in den Wiederaufbau von Infrastrukturprojekten und Verteidigungsfähigkeit zu investieren. Dann könnte Europa auch mit den Oligarchen in Trumps White House besser auf Augenhöhe dealen und womöglich drohende Zollschranken verhindern.