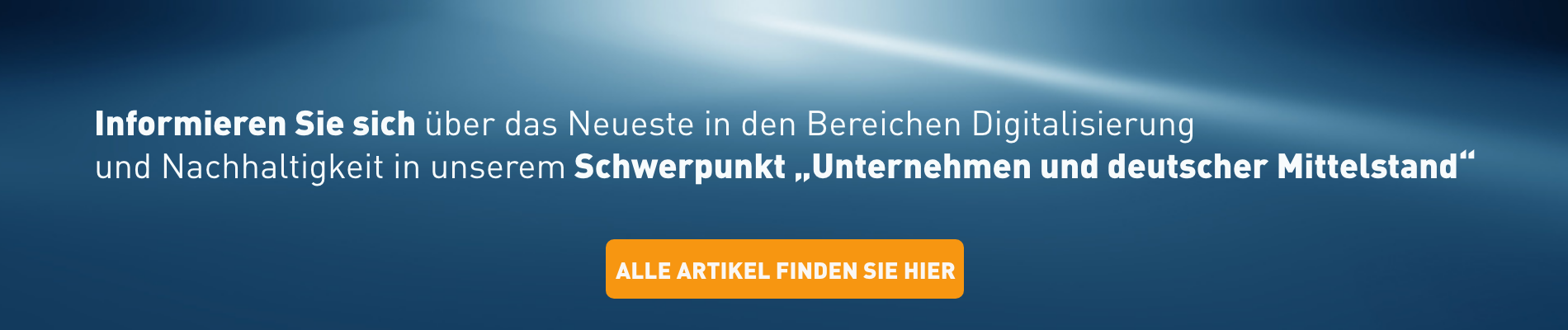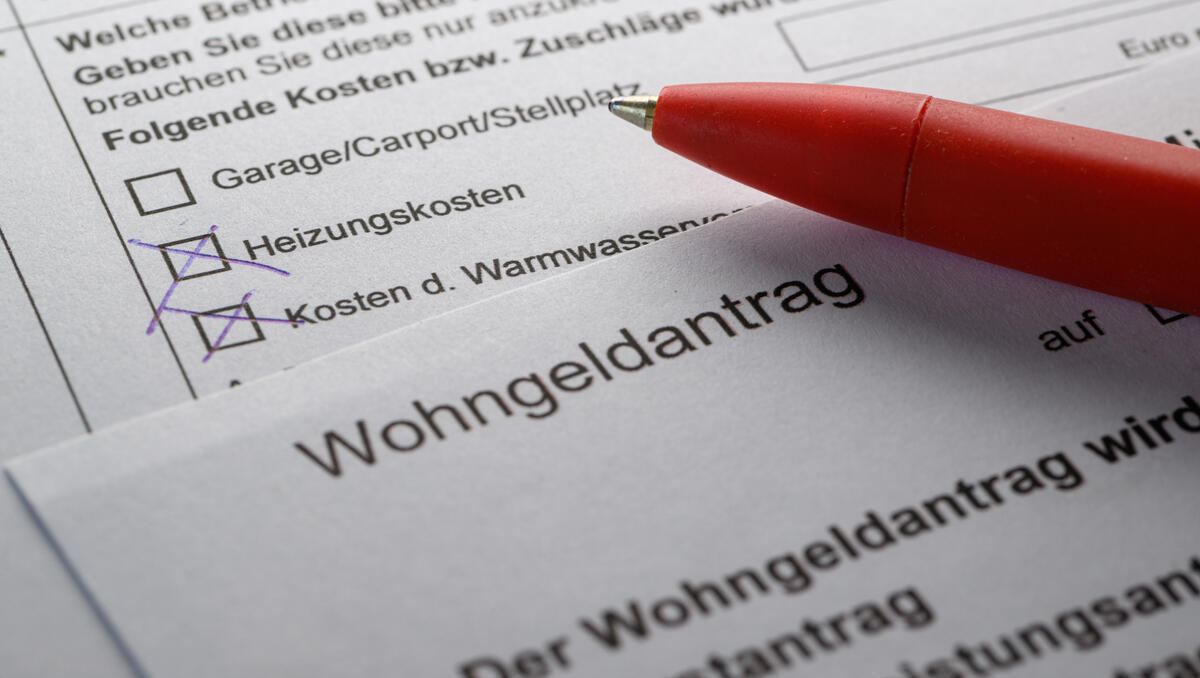Manchmal wird das ganze Ausmaß deutscher Bürokratie in einer Garage in Sachsen sichtbar: Wo andere ihr Auto abstellen, lagert Firmenchef Christian Kirpal Akten. Nicht, weil er das gerne macht, sondern weil er muss. In den Lagerräumen seines Unternehmens für Kunststoffverarbeitung im sächsischen Wermsdorf stehen Regale voller Papierordner, so viele, dass ein zweiter Raum eingerichtet werden musste.
Zwei Mitarbeitende sind täglich damit beschäftigt, für Kirpal die Anforderungen verschiedenster Ämter zu dokumentieren und zu erfüllen. Von Berichtspflichten zu Arbeitskräften bis zum Energieverbrauch, alles muss minutiös dokumentiert werden.
Kirpal, der auch Präsident der Industrie- und Handelskammer Leipzig ist, sagt im Gespräch mit dem SPIEGEL: „Du kannst locker 20 Prozent deiner Arbeitszeit dafür verwenden, nur um Zettel auszufüllen, die an irgendwelche Ämter geschickt werden, ohne zu wissen warum.“ Eigentlich wollte Kirpal für sein Unternehmen eine neue Produktionshalle bauen. Doch nach einem sieben Seiten langen Antwortschreiben der Landesdirektion auf seinen Bauantrag entschied er sich dagegen und strich seine Erweiterungspläne.
Dieses Beispiel ist eines von Tausenden und es steht für einen tief verankerten Frust bei hiesigen Unternehmen über behördliche Antragsverfahren, die nicht nachvollziehbar scheinen, über Papierberge ohne erkennbaren Nutzen und über Ämter, die auf Rückfragen oft mit weiteren Formularen reagieren. Zwangsläufig stellt sich dabei die Frage, ob diese langatmige bürokratische Pedanterie überhaupt zu etwas gut ist und wenn ja, zu was?
Wieviel Staat und Verwaltung verträgt Fortschritt?
Laut einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) schätzen viele Unternehmen genau diese Struktur. Sie loben die Verlässlichkeit, mit der Regeln eingehalten und Entscheidungen überprüfbar getroffen werden, auch wenn das oftmals mehrere Monate dauert. Vor allem deutsche Großkonzerne wie BASF, Bayer, Siemens und Bosch äußerten in der Studie, dass sie die Zusammenarbeit mit Steuer- und Sozialbehörden als überraschend positiv empfinden, nämlich weniger fehleranfällig, transparenter und planbarer als in anderen Ländern.
Was also steckt hinter dieser stabilen, verlässlichen Struktur der deutschen Verwaltung und hinter der Rechtsstaatlichkeit, die ihr Fundament bildet? Und worin liegt trotz aller Kritik ihr ökonomischer Nutzen?
Der deutsche Staatsrechtler Christoph Möllers hat es in seinem 2021 erschienenen Buch “Die Möglichkeit der Normen” so zusammengefasst: „Rechtsstaatlichkeit bedeutet, dass staatliches Handeln sich an Regeln zu orientieren hat, die es vorher gibt, die transparent sind und die durch unabhängige Instanzen kontrolliert werden können.“
Das klingt abstrakt, ist aber ökonomisch höchst relevant. Weil genau in dieser vorhersehbaren, überprüfbaren und institutionell abgesicherten Regelanwendung für Unternehmen die Sicherheit liegt, dass Verfahren nachvollziehbar sind, Entscheidungen nicht willkürlich getroffen werden und Regelwerke auch morgen noch gelten, und zwar unabhängig von politischen Stimmungen oder persönlichem Einfluss.
Christoph Knill, Professor für Politikwissenschaft und Bürokratieforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München, bringt es im Herbst 2024 im „Good Impact“-Magazin auf den Punkt. In einem Gespräch mit Justus Lenz, Leiter des Liberalen Instituts der Friedrich-Naumann-Stiftung, sagt er: „Deutschland ist ein Rechtsstaat, hat im internationalen Vergleich eine hoch entwickelte öffentliche Verwaltung. Sie garantiert Verlässlichkeit und die einheitliche Anwendung des Rechts – in der Umwelt-, Wirtschafts- oder Sozialpolitik.“
Knill argumentiert weiter, dass diese Stabilität auch wirtschaftlich fruchtbar sei: „Ein starker Staat mit einer starken Verwaltung begünstigt nachweislich ein höheres Wirtschaftswachstum.“ Für Unternehmen bedeute das: verlässliche Verfahren, klare Zuständigkeiten, ein geringes Maß an Willkür, und das trotz aller Frustration über die behördliche Langsamkeit hierzulande.
Justus Lenz sieht das anders: „Bürokratische Hürden kosten Deutschland nach einer aktuellen Studie des ifo Instituts jedes Jahr etwa 146 Milliarden Euro. Unternehmen verlieren dadurch Zeit, Geld und Innovationskraft.“ Als Beispiel nennt Lenz das sogenannte Statusfeststellungsverfahren für Selbstständige: „Ein Formular mit 18 Einzelfragen für einen Nebenjob mit klarer Rechtslage. Das ist absurd.“ Auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit leide unter diesen Zuständen, so Lenz: „Deutschland wird zunehmend unattraktiv für Investitionen, weil Genehmigungsverfahren ausufern und kaum planbar sind.“
Rückblick: Die Geschichte der deutschen Verwaltung
Um zu verstehen, warum es viele dieser Strukturen überhaupt gibt, reicht es nicht zu sagen, sie seien historisch gewachsen. Vielmehr wurzeln sie in einem tiefen Bedürfnis nach Verlässlichkeit, das aus den Brüchen der deutschen Geschichte erwachsen ist.
Die deutschen Verwaltungstraditionen sind eng mit dem Namen Max Weber verbunden.
Der Soziologe formulierte in seinem postum erschienenen Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1922) die bis heute einflussreichste Definition moderner Bürokratie sinngemäß als die moderne Form rationaler Herrschaft, geprägt durch Amtshierarchie, Regelbindung und Sachlichkeit.
Für Weber war Bürokratie nicht bloß ein technokratisches Verwaltungsmodell, sondern eine bewusste Reaktion auf vormodernes Herrschaftsgebaren, geprägt von Willkür, Patronage und Intransparenz. Sie sollte Rationalität in das staatliche Handeln bringen, Entpersonalisierung und Berechenbarkeit schaffen, und das vor allem dort, wo zuvor Fürstenwille und Adelsprivileg galten. Sein Idealbild lautete: „Die reinste Form der Verwaltung ist die bürokratische Verwaltung“. Will heißen: Nur bürokratische Verwaltung ist geordnet, entkoppelt von persönlichen Interessen und politisch neutral.
Diese Prinzipien prägen bis heute das Selbstverständnis deutscher Behörden.
„Leider!“, werden einige jetzt kopfschüttelnd einwenden. Doch während andere Länder eher auf politische Einflussnahme oder persönliche Netzwerke setzen, hat sich in Deutschland eine Verwaltungskultur etabliert, die auf Rechtsförmigkeit, Zuständigkeiten und Konsistenz setzt. Das Ergebnis sind zwar oft langsame Prozesse, die aber Sicherheit bieten. Und genau diese Sicherheit ist für internationale Investoren nach wie vor ein entscheidendes Kriterium bei Standortentscheidungen.
Bürokratie unter der Lupe – Was den Mittelstand wirklich belastet
Tatsache ist: Die Kritik an der überbordenden Bürokratie in Deutschland ist weder Einbildung noch urban legend sondern enervierende Realität für Unternehrinnen und Unternehmer zwischen Flensburg und Garmisch, zwischen Köln und Cottbus.
Laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft vom November 2023 spüren über 90 Prozent der befragten Unternehmen eine steigende Bürokratiebelastung. Besonders stark empfinden kleine und mittlere Unternehmen (KMU) die psychologischen Kosten, etwa in Form von Frust, Überforderung und Ohnmacht. Mit Blick auf diese ernüchternde Germengelage wünschen sich die befragten Unternehmen vor allem:
- eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren,
- mehr digitale Verwaltungsprozesse,
- eine frühzeitige Einbindung von Praxiswissen in die Gesetzgebung,
- sowie weniger Kontrollkultur und mehr Vertrauen.
Ist Digitalisierung ein Schlüssel zur Entlastung?
Ein zentrales Versprechen der Politik bleibt die Digitalisierung. Doch wie groß sind die Chancen der Einlösung dieses Versprechens tatsächlich? Glaubt man einer Studie des ifo Instituts aus dem November 2024, könnte ein umfassender Digitalisierungsschub in der Verwaltung das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf um bis zu 2,7 Prozent steigern.
Nach der Bundestagswahl 2025 hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ein neues Ressort eingerichtet: das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Geleitet wird es von dem vormaligen Unternehmer Karsten Wildberger (CDU). Mit seiner Ernennung setzt die Bundesregierung auf Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft, ein Schritt, der Erwartungen an mehr operative Effizienz und pragmatisches Prozessverständnis weckt, aber auch Skepsis darüber, ob sich wirtschaftliche Logik eins zu eins auf staatliche Strukturen übertragen lässt.
Zu den angekündigten Kernprojekten gehören die Einführung eines zentralen Unternehmenskontos für alle behördlichen Interaktionen, ein digitalisiertes Verfahren für Baugenehmigungen sowie ein bundesweiter Rahmen für interoperable Schnittstellen zwischen Behörden.
Doch bislang bleibt die politische Realität weit hinter diesen Ambitionen zurück. Ein Beispiel, dass es auch anders geht, ist Schweden: Während es im Königreich nur sieben Stunden dauert, eine Immobilie online zu registrieren, sind es in Deutschland 52 Stunden, verteilt auf sechs verschiedene Ämter.
Ein Hauptgrund dafür, warum Deutschland beim digitalen Verwaltungsausbau deutlich hinter Ländern wie Schweden zurückliegt, liegt laut Professor Oliver Falck, Co-Autor der ifo-Studie, in der zersplitterten Behördenstruktur und der fehlenden Interoperabilität: „Verschiedene Behörden sind in Schweden unter einem Dach und digital vernetzt, in Deutschland agieren sie oft isoliert.“ Falck spricht vom politischen Teufelskreis der “Legislativlogik”. Schweden dagegen denke Verwaltungsmodernisierung parteiübergreifend und langfristig. Der Unterschied liege nicht nur in der Technologie, sondern im Mindset.
Was Unternehmen sich wünschen und warum sie bleiben
Trotz aller Frustration wollen viele Mittelständler dem Standort Deutschland zwar nicht den Rücken kehren, doch der Unmut wächst. Eine aktuelle Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) aus dem Jahr 2024 zeigt: 57 Prozent der befragten Industrieunternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden bewerten die Rahmenbedingungen für ihre Innovationsaktivitäten als weniger oder gar nicht gut. Hauptgründe sind überbordende Berichtspflichten, strenge gesetzliche Vorgaben und langwierige Genehmigungsprozesse.
Besonders alarmierend: Jeder fünfte Betrieb hat bereits Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ins Ausland verlagert, weitere neun Prozent planen dies konkret. Fast 60 Prozent der Unternehmen geben an, aufgrund der regulatorischen Hürden derzeit keine größeren Investitionen in Deutschland tätigen zu wollen.
Es gibt aber auch positive Gegenbeispiele. So zeigt eine repräsentative Umfrage des Softwareanbieters Proalpha aus dem Frühjahr 2024 unter mittelständischen Industrieunternehmen, dass viele Betriebe den Standort Deutschland nicht pauschal abschreiben. Zwar wünschen sich 68 Prozent mehr Flexibilität und fordern weniger Detailregelungen, doch 64 Prozent betonen, dass stabile und verlässliche Rahmenbedingungen ihnen Planungssicherheit geben.
Für Proalpha-Geschäftsführer Michael Finkler seien daher ein durchdachtes Anreizsystem und gezielte Unterstützung für den Mittelstand deutlich hilfreicher „als ein Tsunami an Regelwerken, der in der Praxis kaum handhabbar ist.“
Was Deutschland jetzt braucht
Der Ruf nach Bürokratieabbau gehört seit Jahren zum Standardrepertoire wirtschaftspolitischer Sonntagsreden, entscheidend ist jedoch das Wie.
Ein Blick nach Europa zeigt, dass Reformen möglich sind. Die Niederlande etwa setzen auf systematische Praxischecks, die Gesetzesvorhaben auf ihre Umsetzbarkeit und den tatsächlichen Nutzen prüfen. In Großbritannien gilt das Prinzip „Regulation only if necessary“: Bevor ein Gesetz verabschiedet wird, muss geklärt sein, ob es nicht auch eine einfachere Alternative gibt.
Deutschland kann von diesen Ansätzen lernen ohne dabei seine Stärken zu verlieren. Denn die Fähigkeit, Regeln rechtsstaatlich verlässlich umzusetzen, ist kein Makel, sondern eine Kernkompetenz. In einer Welt wirtschaftlicher und politischer Volatilität sind Rechtsklarheit und institutionelle Stabilität für Investoren gerade in der aktuellen geopolitischen Phase entscheidender als Geschwindigkeit.
Gleichzeitig gilt: Verwaltungsverfahren müssen schlanker und effizienter, Zuständigkeiten klarer und Abläufe digitaler werden. Der Staat muss zum Möglichmacher werden, nicht zum Flaschenhals. Der Blick nach Skandinavien zeigt, dass das kein Wunschtraum ist, sondern eine Frage politischer Priorität und des politischen Willens. Bürokratieabbau ist kein Selbstzweck. Aber wenn er gelingt, kann er das leisten, worum es der deutschen Wirtschaft eigentlich geht: Freiräume schaffen für Innovationen, das Vertrauen in staatliche Institutionen wiederherstellen und für ein Standortklima sorgen, das Bestand hat.