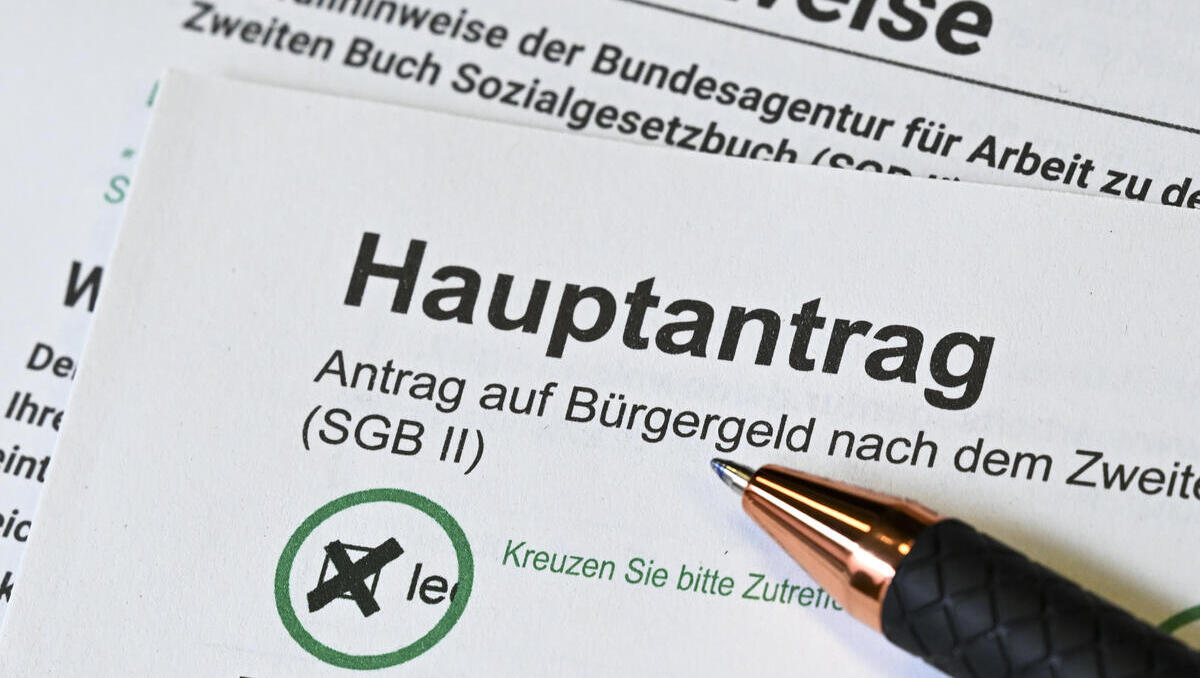Wer das Kontorhaus “Zippelhaus” in Hamburg betritt, bekommt wenig von der technologischen Revolution mit, die sich hier abspielt. Ganz oben, unterm Dach, in historischen Backsteinambiente und mit Blick auf Hamburgs Speicherstadt, arbeiten elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem System, das derzeit die industrielle Fertigung grundlegend verändert: Die Softwareplattform von 3D Spark analysiert Bauteile und berechnet automatisch, mit welcher Technologie, zu welchen Kosten und in welchem Zeitraum sie mittels 3-D-Druck hergestellt werden können.
“Die meisten Unternehmen wissen, dass 3D-Druck für bestimmte Teile sinnvoll sein kann”, sagt Mitgründer Fritz Lange. “Aber sie wissen nicht, wo genau er wirtschaftlich oder ökologisch sinnvoll ist. Unsere Software gibt darauf eine Antwort.” Die Idee zur Gründung entstand 2019, als Lange, Arnd Struve und Ruben Meuth am Fraunhofer-Institut für Additive Produktionstechnologien (IAPT) für den Zughersteller Alstom erste Prototypen entwickelten. 2021 folgte die Ausgründung. Seitdem nutzt Alstom die Lösung marktreif: Mit dem Tool wurden laut Unternehmensangaben bereits über zehn Millionen Euro an Fertigungskosten eingespart.
3D Spark ist ein Paradebeispiel für gelungenen Wissenstransfer: wissenschaftlich fundiert, industriell erprobt und mit realem Marktecho. Und: Das Start-up denkt weiter. Neben dem Part Request Portal (PRP), das Beschaffungsprozesse automatisiert, arbeitet das Team am sogenannten Supplier Panel, einem digitalen Brückenschlag zwischen OEMs wie Alstom und deren Zulieferern. “Was heute Wochen dauert, soll künftig in Sekunden möglich sein”, sagt Head of Business Development Çağrı Üzüm. Für die Branche ist das mehr als eine Prozessoptimierung, es ist ein Infrastrukturumbau.
Transferlücken: Wenn Wissen im Elfenbeinturm bleibt
Trotz solcher Erfolgsgeschichten bleibt der Wissenstransfer aus Hochschulen in Deutschland vielfach unter seinen Möglichkeiten. Zwar meldeten deutsche Hochschulen laut Fraunhofer ISI zwischen 2012 und 2022 über 8.800 Patente an, davon rund die Hälfte aus nur 15 Universitäten. Doch viele dieser Patente landen nie im Markt. “Der klassische Technologietransfer funktioniert kaum noch”, heißt es in einem aktuellen Positionspapier von SPRIND, der Bundesgentur für Sprunginnovationen. Die gängigen Lizenzmodelle seien zu komplex, der wirtschaftliche Nutzen vieler Schutzrechte zu gering. Stattdessen brauche es gründungsfreundlichere Bedingungen und eine aktivere Rolle der Hochschulen beim IP-Management.
Das Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) nennt in seinem Kompetenzbarometer zu Digitalisierungsberufen aus dem Frühjahr 2024 die Transferfähigkeit als eine der größten Stellschrauben für den Strukturwandel. Besonders in Hochtechnologiebereichen könnten aus Hochschulen deutlich mehr Gründungen hervorgehen, wenn Patente und Know-how einfacher überführt würden. Doch aktuell fehlen vielerorts institutionelle Anreize, personelle Ressourcen oder schlicht das Interesse der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
Exzellenz und Expansion: Wie forschungsstarke Unis gründen
Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele aus dem In- und Ausland. Forschungsstarke Universitäten wie die RWTH Aachen oder die TU München haben eigene Transfergesellschaften aufgebaut, die Ausgründungen nicht nur ermöglichen, sondern systematisch begleiten, von der ersten Idee über den Businessplan bis zum Exit. Während Aachen vor allem durch ein aktives Begleitmodell in der Gründungsberatung punktet, überzeugt die TU München mit ihrer hohen Zahl erfolgreicher Ausgründungen: Allein zwischen 2018 und 2023 entstanden dort über 130 Spin-offs, ein Spitzenwert im deutschen Hochschulraum.
Ein Blick ins Ausland verdeutlicht, wohin sich der Trend entwickelt: Die ETH Zürich und die University of Cambridge erzielen mit Technologietransfer nicht nur Lizenzumsätze, sondern gründen gezielt Unternehmen mit Hochschulbeteiligung. In Großbritannien ist dies längst Standard, fast alle Universitäten halten Anteile an ihren Spin-offs.
Im Gegensatz dazu fehlt in Deutschland oftmals der politische Wille, dass Hochschulen sich aktiv an Gründungen beteiligen. Damit bleibt ein zentraler Hebel ungenutzt: Rückflüsse aus erfolgreichen Start-ups, die wieder in Forschung und Lehre investiert werden könnten.
Was öffentlich geförderte Forschung leisten kann, zeigen zwei Ausgründungen aus der Fraunhofer-Welt: Das Software-Start-up 3D Spark, hervorgegangen aus dem Fraunhofer-Institut für Additive Produktionstechnologien (IAPT) in Hamburg, und das Food-Biotech-Unternehmen Bluu Seafood, entstanden am Fraunhofer-Institut für Marine Biotechnologie und Zelltechnik (IMTE) in Lübeck. Beide sind Beispiele dafür, wie forschungsbasierte Gründungen funktionieren können – wenn sie systematisch unterstützt werden.
Während 3D Spark mit Partnern wie Alstom erfolgreich Prozesse in der Bahnbranche digitalisiert, entwickelt Bluu Seafood zellbasierten Fisch in Bioreaktoren, mit Pilotanlagen in Hamburg-Altona und Skalierungsperspektiven bis 500-Liter-Fermentern. “Wir sehen uns als Food-Biotech-Unternehmen mit der Ambition, den konventionellen Fischmarkt technologisch zu ergänzen, tierleidfrei, ressourcenschonend und skalierbar”, sagt Cornelius Lahme, Leiter Marketing und Vertrieb bei Bluu Seafood. Möglich wurde die Ausgründung nicht zuletzt durch gezielte Fraunhofer-Förderung sowie Investitionen in Millionenhöhe.
Damit aus solchen Innovationen auch nachhaltige Geschäftsmodelle werden, braucht es mehr als Kapital und Forschung, es braucht Schutzrechte, sprich Patente.
Ost-Unis liegen bei Patenten vorne
Wer erfinden will, muss schützen können. Patente gelten als härteste Währung im Innovationssystem, nicht nur, weil sie technologischen Vorsprung sichern, sondern weil sie Ideen in wirtschaftlich verwertbares Eigentum übersetzen. Das macht sie zum strategischen Instrument für forschungsstarke Unternehmen ebenso wie für Hochschulen mit Transferambition.
Laut IW-Analyse aus dem Jahr 2024 stammen über 40 Prozent aller Hochschulpatente von nur zehn Universitäten, darunter auffallend viele aus Ostdeutschland. Gemessen an der Studierendenzahl führen Sachsen und Thüringen das bundesweite Ranking klar an, mit der TU Dresden, Ilmenau und Magdeburg auf den vorderen Plätzen. Damit zeigen gerade jene Regionen Innovationsstärke, die im öffentlichen Diskurs oft als strukturschwach gelten. Für das industrielle Rückgrat Deutschlands ist das mehr als eine Randnotiz: Wo geschützt wird, kann investiert werden. Das gilt nicht nur für Produkte und Technologien, sondern auch für Menschen.
Wirtschaft braucht Wissenschaft und umgekehrt
Dass sich Investitionen in den Wissenstransfer lohnen, zeigen auch makroökonomische Berechnungen. Laut IW-Studie im Auftrag des DAAD bringen 1.000 internationale Studierende über ihren Lebensverlauf in Deutschland bis zu 1,77 Milliarden Euro an Wertschöpfung.
Entscheidend sei, wie viele von ihnen im Land bleiben und sich beruflich integrieren lassen.
Auch deutsche Studierende profitieren. Laut INSM-Sondergutachten “Bildungspolitik 2025” sei das Potential der Hochschulen als Innovationsmotor bislang unzureichend ausgeschöpft. Es brauche gezielte Anreize, den Gründungsgeist zu stärken, etwa durch mehr Mittel für MINT-Lehrstühle, praxisnahe Labore und Kooperationen mit Unternehmen.
Gerade in Nordrhein-Westfalen zeigt sich, was möglich ist, wenn Politik, Forschung und Wirtschaft an einem Strang ziehen. Laut NRW Startup Report 2024 bezeichnen 61 Prozent der Gründer das Ökosystem als “sehr gut” oder “gut”. Erfolgsfaktor Nummer eins: das Gründungsstipendium.NRW. Doch neben Geld braucht es auch Geduld. “Wir brauchen in Deutschland eine Kultur, die Scheitern als Teil des Prozesses akzeptiert”, sagt Mona Neubaur, Wirtschaftsministerin in NRW in einer Mitteilung ihres Hauses.
Hinzu kommt: Viele der Startups kämpfen mit den immer gleichen Problemen. “Sales, Kapital, Sichtbarkeit”, heißt es in der Umfrage. Dass Frauen seltener gründen, liegt laut Report oft an strukturellen Hürden, etwa mangelnder Vereinbarkeit von Gründung und Familie.
Umso relevanter wird die Frage: Wer bildet eigentlich die Gründer von morgen aus? Eine Antwort liefern private Hochschulen, die Praxisnähe und unternehmerisches Denken systematisch fördern.
Private Hochschulen als Innovationsmotor
Wie eng Wissenschaft und Wertschöpfung mittlerweile in Deutschland miteinander verwoben sind, zeigt sich nicht nur in Gründungen. Auch Unternehmen greifen gezielt auf wissenschaftliches Know-how zurück, ob in Form von Studien, Beratung oder Technologietransfer. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) verweist darauf, dass Bildung und Forschung als "Schlüsselressourcen" des Wirtschaftsstandorts Deutschland gelten. Doch die Innovationsimpulse aus Hochschulen blieben bislang unter ihren Möglichkeiten.
Der Bielefelder Soziologe Frank Meier spricht in diesem Zusammenhang vom „akademischen Kapitalismus“: Wissenschaft werde zunehmend auf ihre Verwertbarkeit hin betrachtet. Die Ökonomisierung sei nicht nur Chance, sondern auch Risiko für die Erkenntnisproduktion. Gerade deshalb sei es entscheidend, zwischen wissenschaftlicher Freiheit und strategischer Transferpolitik die Balance zu wahren.
Während öffentliche Hochschulen oft auf strukturelle Förderprogramme und Ministerialstrategien angewiesen sind, agieren private Hochschulen in Deutschland mitunter deutlich schneller, praxisnäher und unternehmerischer. Die Kühne Logistics University (KLU) in Hamburg etwa ist längst mehr als ein akademischer Exot mit Reedereihintergrund.
„Unsere Universität ist auf einem geraden Wege zum Erfolg – in Lehre, in Forschung und auch in der Ausbildung von jungen Menschen“, sagt Klaus-Michael Kühne beim Logistiktag der Kühne Stiftung, die als Finanzier dahinter steht. Die KLU setzt auf ein schlankes, spezialisiertes Modell: 330 Studierende, 22 Professorinnen und Professoren, ein klares Profil in globaler Logistik und digitaler Supply Chain.
Was das konkret heißt, zeigen Karrieren wie die von Victoria Herzog. Die heute 36-Jährige ist CEO von The Creative Club, Europas größtem DIY-Online-Marktplatz und war einst Masterstudentin der KLU. „Das Studium bringt einem bei, Konzepte zu überdenken und eigene Ideen zu entwickeln“, sagt sie. Entscheidend sei gewesen, „Probleme im interkulturellen Team unter Druck zu lösen.”
Auch auf dem akademischen Pfad zeigt die KLU Wirkung. Arne Heinold, Absolvent des Jahrgangs 2013, ist heute Professor an seiner Alma Mater. „Ich wollte etwas machen, was sehr nah an der Wirtschaft ist – dafür war die KLU der richtige Ort“, erklärt er. Seine Forschung zur 5G-Logistik in Häfen und zu nachhaltigem Transport wurde unter anderem mit DFG-Mitteln gefördert. „Campuswissen wird hier operationalisiert und direkt in reale Wertschöpfung überführt“, so Heinold. Kooperationen mit Konzernen wie Hapag-Lloyd oder Lufthansa Cargo gehören zum Alltag. Auch das PhD-Programm ist international ausgelegt.
Elite mit Gründergeist: Die WHU - Otto Beisheim School of Management
Ein anderes Beispiel findet sich in Rheinland-Pfalz, genauer in Vallendar bei Koblenz: die WHU – Otto Beisheim School of Management. Die Hochschule gilt als eine der renommiertesten betriebswirtschaftlichen Einrichtungen im deutschsprachigen Raum und rangiert in Gründungs- und Innovationsrankings regelmäßig weit oben.
Einige der bekanntesten deutschen Digitalunternehmer haben ihren Abschluss an der WHU gemacht, darunter Zalando-Mitgründer Robert Gentz oder Rocket-Internet-Investor Oliver Samwer. „Hierbei ist es auch entscheidend, welche Alumni bei Wagniskapitalgebern arbeiten“, erklärt Malin Fiedler, Gründungsforscherin an der TU München, in einem Interview mit der WirtschaftsWoche. Die WHU verfüge in dieser Hinsicht über ein “sehr gutes Alumninetzwerk”, das weit in die Finanzierungslandschaft hineinreiche.
Die Jacobs University Bremen, seit 2022 unter dem Namen Constructor University aktiv, setzt stärker auf Wissenschaft und Technologie. Rund 1.800 Studierende aus über 100 Ländern lernen hier interdisziplinär und mit einem klaren Fokus auf angewandte Forschung. Auch in puncto Start-up-Freundlichkeit liegt die private Science-Uni vorn. „Das überschaubarere Umfeld und der starke Fokus auf eine gute Vernetzung – auch zu Alumni – sind bei Gründungen durchaus hilfreich“, so Fiedler. In einem System, das oft träge wirkt, beweisen private Hochschulen: Geschwindigkeit, Praxisbezug und Transferbereitschaft sind keine Gegensätze.
Auch der Staat kann Transfer: Exzellenzunis in Deutschland
Gelungener Wissenstransfer ist in Deutschland kein Zufallsprodukt, er basiert auf einer gewachsenen politische Grundlage. Seit 2006 bündelt der Bund mit den Ländern in der sogenannten Exzellenzstrategie gezielt Mittel, um forschungsstarke Universitäten international konkurrenzfähig zu machen. Auslöser war einst der Pisa-Schock. Heute gilt das Programm als eines der effektivsten Mittel, um akademische Exzellenz mit gesellschaftlicher Wirkung zu verbinden.
Die Anforderungen sind hoch: Nur Universitäten mit herausragenden Forschungsschwerpunkten und klarer Transferstrategie erhalten Zugang zu den Mitteln. Derzeit profitieren elf Hochschulen und ein Universitätsverbund von der Förderung. Dafür stehen jährlich 533 Millionen Euro zur Verfügung, ein großer Teil davon fließt in Clusterprojekte, die den Schulterschluss von Wissenschaft, Unternehmen und Gesellschaft ermöglichen sollen.
„Die Exzellenzstrategie ist wie ein Nordstern, der uns antreibt“, sagt Prof. Hauke Heekeren, Präsident der Universität Hamburg. Seine Hochschule ist seit 2019 als einzige im Norden Teil des Programms. Was dabei herauskommen kann, zeigen Projekte wie das SimLab, ein chirurgisches Trainingslabor, oder die international gefragte Gesundheitsökonomin Prof. Dr. Iris Kesternich. Beide wären ohne gezielte Strukturförderung kaum realisiert worden.
Was viele nicht wissen: Exzellenzförderung ist längst kein elitäres Elfenbeinturmprojekt mehr, sondern ein Standortfaktor mit Breitenwirkung. Forschungsschwerpunkte werden evaluiert, Transferpotenziale geprüft, Mittel an sichtbaren Output geknüpft. Damit trägt das Programm nicht nur zur akademischen Qualität bei, sondern auch zu einer regionalen wie wirtschaftlichen Dynamik. Und es zeigt: Der Staat kann Transfer, wenn er exzellenzorientiert und strategisch denkt.
Kanada statt Kalifornien: Exodus der US-Bildungselite
In den USA hingegen gerät die akademische Freiheit zunehmend unter Druck, nicht nur finanziell, sondern auch politisch. Unter US-Präsident Donald Trump wurde die Forschungsausgaben beschnitten, die Einwanderung erschwert und wissenschaftliche Institutionen als „linke Brutstätten“ diffamiert.
Der renommierte Yale-Philosoph Jason Stanley erklärte kürzlich gegenüber dem US-Medium CTInsider: „Ich kann nicht mehr unter einem System arbeiten, das Bildung als Waffe benutzt.“ Zusammen mit Kollegen wie Timothy Snyder oder Marci Shore verließ er die Yale University und wechselte nach Kanada an die University of Toronto.
Wissen und Wertschöpfung brauchen den Rechtsstaat
Während US-Universitäten mit verunsicherten Lehrstühlen und restriktiver Politik kämpfen, punktet Deutschland mit Stabilität: Die Freiheit von Forschung und Lehre ist hier grundgesetzlich garantiert, unabhängig vom politischen Kurs. Die Grundlage für die akademische Freiheit in Deutschland ist eindeutig: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“, so heißt es in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Gerade in Krisenzeiten zeigt sich: Rechtsstaat und Hochschulautonomie sind Standortvorteile, nicht zuletzt für internationale Talente, die ein verlässliches Umfeld suchen. In einer Zeit, in der akademische Freiheit andernorts zur Disposition steht, wird Deutschland zum stabilen Gegenmodell. Und genau hier liegt die Chance: Wenn Deutschland Transfer und Talentbindung zusammendenkt, kann aus rechtlicher Sicherheit auch wirtschaftliche Dynamik entstehen.