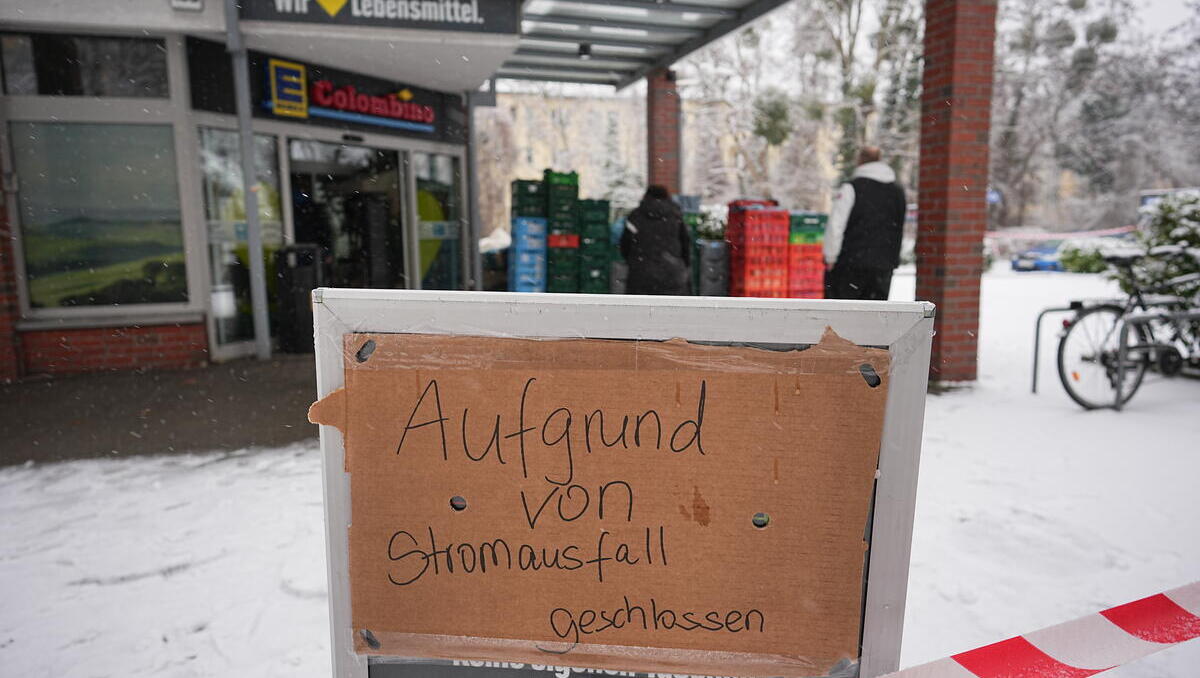Trotz demonstrativ guter persönlicher Beziehungen zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem neuen deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz steht die angekündigte Wiederbelebung der deutsch-französischen Partnerschaft auf wackeligen Beinen. Denn in den zentralen Bereichen Verteidigung und Handel sind die Differenzen tiefgreifend.
Bereits im Mai, kurz nach seiner Amtseinführung, reiste Merz nach Paris, wo er einen „Neuanfang für Europa“ ausrief, wie Politico berichtet. Beide Seiten betonten damals ihre Bereitschaft zu engerer Kooperation, besonders im wirtschaftlichen Bereich. Auch beim umstrittenen Thema Kernenergie gab es Bewegung: Deutschland stellte in Aussicht, seine ablehnende Haltung gegenüber der Einstufung von Atomstrom als nachhaltige Energieform zu überdenken.
Rüstungsfragen blockieren die Einigkeit
Doch gerade in sicherheitspolitischen Fragen nehmen die Spannungen zu. Deutschland plädiert – mit Rückendeckung aus Washington – dafür, amerikanische Waffenlieferungen an die Ukraine stärker zu koordinieren. Frankreich hingegen hält an seinem Kurs fest, auf europäische Rüstungsproduktion zu setzen und sich weniger abhängig von den USA zu machen. Auch das gemeinsame Projekt eines europäischen Kampfjets, der als Gegengewicht zur F-35 dienen sollte, liegt derzeit auf Eis. Paris bemüht sich zwar um Deeskalation, doch ein klarer gemeinsamer Kurs ist nicht erkennbar.
Streitpunkt Handel: US-Zölle und Agrarschutz
Noch ausgeprägter sind die Differenzen in der Handelspolitik. Merz setzt sich für ein zügiges Freihandelsabkommen mit den USA ein, um die noch aus der Trump-Zeit stammenden Strafzölle abzubauen, die insbesondere der deutschen Exportindustrie geschadet haben. Frankreich hingegen pocht auf strengere Auflagen und zeigt sich zurückhaltender. Macron lehnt zudem das EU-Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Mercosur-Bund ab – vor allem aus Rücksicht auf französische Landwirte, die sich vor billigen Fleischimporten fürchten.
Bedeutung für Berlin und Brüssel
Für Deutschland steht viel auf dem Spiel: Ohne Fortschritte bei der Handelsöffnung gegenüber den USA bleiben zentrale Industriezweige wie Maschinenbau und Automobil unter Druck. Gleichzeitig ist Deutschland bei militärischen Großprojekten wie dem Kampfjet auf die Kooperation mit Paris angewiesen. Die strategische Balance zwischen industriepolitischem Eigeninteresse und europäischer Einigung wird so zum Drahtseilakt für Berlin.
Viele deutsche Beobachter fordern deshalb einen realpolitischen Kompromiss: Berlin soll Paris bei Verteidigungsfragen entgegenkommen, während Frankreich seine protektionistische Linie in der Handelspolitik überdenken müsse. Doch die politische Lage ist angespannt: Der wachsende Einfluss rechter Kräfte in beiden Ländern und innenpolitischer Druck könnten den ohnehin schmalen Korridor für Einigungen bald schließen.
Die traditionell starke deutsch-französische Partnerschaft – einst als Motor der europäischen Integration gepriesen – droht an gegensätzlichen Interessen und politischen Realitäten zu scheitern.