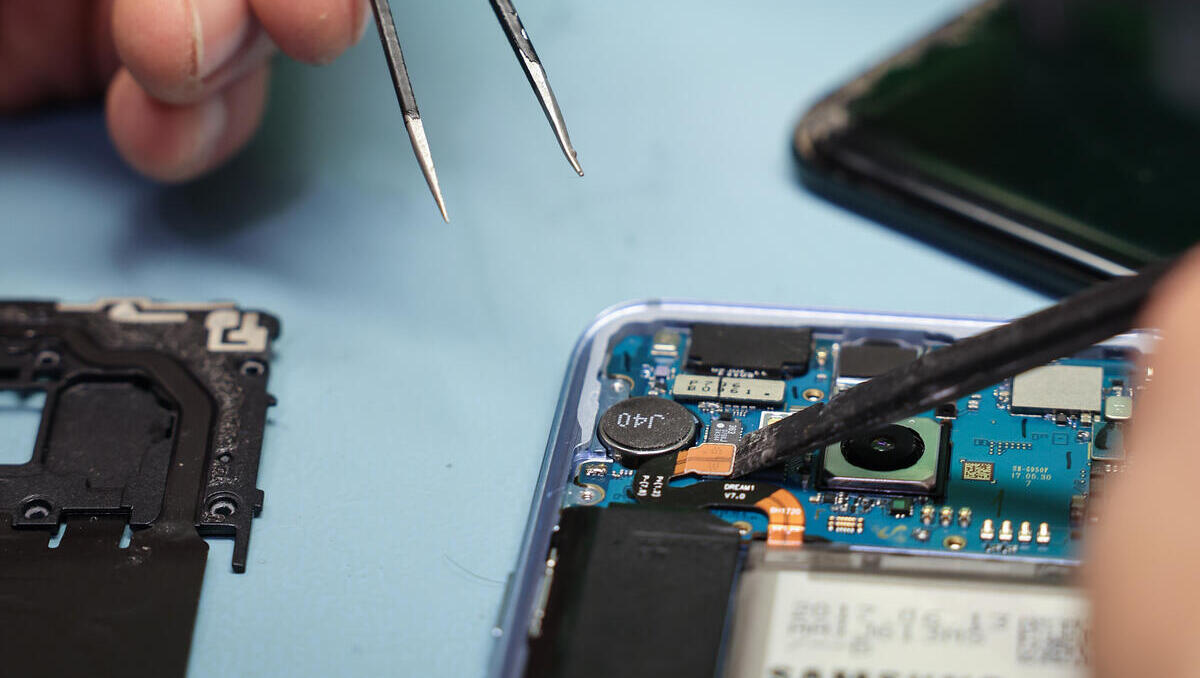Abbau von Arbeitszeitkonten, Personalreduzierung, Standortverlagerung - sogar Werksschließungen - die Autozulieferer in Deutschland trifft die Krise der heimischen Automobilindustrie mit voller Wucht. Die Firmenchefs gehen längst nicht mehr von einer vorübergehenden Konjunkturdelle aus, sondern von einem verfestigten Abschwung, berichtet die dpa.
Denn die Automobilindustrie und damit die Zulieferer hat mit der von der Politik geforderten Abkehr vom Verbrennungsmotor sowie Marktproblemen in China, Indien und den USA eine saftige Strukturkrise ereilt. Und zwar viel schneller, als einige Konzernlenker erwartet hatten.
Ein Überblick über einige der größten deutschen Zulieferer:
BOSCH: Der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung, Volkmar Denner, hat es der «Süddeutschen Zeitung» jüngst vorgerechnet: Der Zulieferer setzt für das Einspritzsystem eines Dieselmotors zehn Mitarbeiter ein. Bei einem Benziner sind drei Bosch-Beschäftigte beteiligt, bei einem Elektrofahrzeug einer. Stellenkürzungen seien praktisch unausweichlich. Die Stuttgarter beschäftigen weltweit 410 000 Menschen. 50 000 Arbeitsplätze, davon allein 15 000 in Deutschland, hängen vom Diesel ab. Allerdings ist der größte Autozulieferer der Welt auch noch in anderen Sparten aktiv, etwa im Maschinenbau.
CONTINENTAL: Der Hannoveraner Traditionshersteller hat große Probleme, die Spur zu halten. «Derzeit ist das Marktumfeld sehr herausfordernd», sagte Vorstandschef Elmar Degenhart zuletzt, er sprach von einem tiefgreifenden, sich dramatisch beschleunigenden und «teilweise disruptiven» Wandel in der Branche. Es brauche nun «Kostendisziplin» - was für Conti auch heißen dürfte: Stellen streichen! Wie viele der fast 245 000 Conti-Mitarbeiter es treffen werde, sei Gegenstand von Diskussionen mit der Gewerkschaft. An der Börse zeigt die Kurve der Conti-Aktie seit Wochen nach unten. Auch Verkäufe von Firmenteilen schloss Degenhart nicht aus. Das Reifengeschäft ist für Continental weiter ein fester Ertragspfeiler.
ZF Friedrichshafen: Der Hersteller unter anderem von Getrieben aus Friedrichshafen ist breit aufgestellt - spürt aber dennoch den Gegenwind der Branche. Der ZF-Vorstand nahm seine noch im April geäußerte Umsatzerwartung um eine satte Milliarde Euro zurück - auf 36 bis 37 Milliarden Euro. Der Gewinn brach im ersten Halbjahr 2019 drastisch auf die Hälfte des Vorjahreswertes ein. Chef Wolf-Henning Scheider musste einräumen, ZF liege deutlich unter Plan. In China reagierte ZF bereits mit Entlassungen. In Deutschland soll es dazu nicht kommen - es würden ausgleichende Maßnahmen wie etwa Gleitzeit reichen, heißt es von ZF.
MAHLE: Auch bei den 79 000 Mitarbeitern von Mahle geht die Angst um. Der Betriebsrat des Stuttgarter Unternehmens hat ein Strategiepapier vorgelegt, das zu einem Entlassungsstopp bis 2025 führen soll. Die Geschäftsleitung hatte zuvor den Abbau von 380 der 4300 Stellen in Stuttgart und die Schließung eines Werks in Öhringen angekündigt. Mahle hat bisher vor allem mit Filtern und Kolben Geschäfte gemacht. Inzwischen versuchen die Stuttgarter, den Hebel herumzureißen und stärker auf Elektromobilität zu setzen - auch bei Fahrrädern.
SCHAEFFLER: Der größte fränkische Auto-Zulieferer aus Herzogenaurach sieht bisher noch keine Notwendigkeit für drastische Maßnahmen, will aber dennoch kürzer treten. So sollen etwa nach Brückentagen in der zweiten Jahreshälfte die Bänder still stehen. Im März hatte das Unternehmen bereits einen Abbau von 700 Stellen in Deutschland und 200 im europäischen Ausland bekanntgegeben sowie vier Standorte auf den Prüfstand gestellt.
BROSE: Das Coburger Familienunternehmen musste ebenfalls Federn lassen und will mit «Kapazitätsanpassungen» reagieren. Man habe ein Programm zur Kostensenkung gestartet. Im ersten Quartal 2019 lagen die Umsätze um fünf Prozent unter dem Vorjahr. Langfristig sieht Brose allerdings in den neuen Mobilitätstrends mehr Chancen als Risiken und will in neue Technologien kräftig investieren - mit 1,5 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren immerhin rund ein Viertel eines Jahresumsatzes.
LEONI: Der im SDax notierte Nürnberger Zulieferer ist wohl einer der bisher am stärksten Betroffenen der Branche in Deutschland. Firmenchef Aldo Kamper musste sich zuletzt schon gegen Untergangsszenarien wehren. «Wir brauchen keinen Arzt und keinen Pfarrer», sagte der Niederländer. Stattdessen setzt er trotz der anhaltenden Krise auf die Selbstheilungskräfte des Unternehmens. Während die meisten Firmen der Branche zwar Einbußen wegstecken, aber immer noch gut über der Nulllinie wirtschaften, steckt der Kabel- und Bordnetzexperte bereits tief in den roten Zahlen. Im ersten Halbjahr liefen unter dem Strich 176 Millionen Euro Verlust auf.
Die Deutschen Wirtschaftsnachrichten hatten in den vergangenen Wochen darüber hinaus über erhebliche Probleme bei den Zulieferern Marquardt, Eisenmann und Weber Automotive berichtet.
Die heraufziehende Krise in Deutschlands umsatzstärkstem Industriezweig mit seinen 835.000 Beschäftigten macht auch Kreditgeber nervös. "Die Banken schauen genau hin. Kredite werden teurer und sind schwerer zu bekommen", sagt Elmar Kades vom Beratungsunternehmen AlixPartners zu Reuters.
Offiziell wollen sich die Geldhäuser nicht zu ihren Kundenbeziehungen äußern, doch hinter vorgehaltener Hand bestätigen sie die Aussagen des Beraters. "Wir sind selektiver geworden", sagt ein Banker. "Kreditlinien an die Autoindustrie werden tendenziell gekürzt", berichtet ein anderer. "Mir macht die Geschwindigkeit des Branchenwandels Sorgen", erklärt ein dritter. "Bei rund zehn Prozent der Zulieferer stehen die Ampeln auf rot. Sie sind weder zukunftsfähig, noch haben sie die Kapazität, sich zukunftsfähig zu machen."
Die wachsende Vorsicht der Geldhäuser hat ihren Grund: Sie wollen verhindern, dass eine Autokrise zu einer Bankenkrise führt. Zu frisch sind die Erinnerungen an die Schifffahrtskrise, als ausfallende Kredite viele Banken Milliarden kosteten - und einige gar selbst in Schieflage gerieten.
Die Autoindustrie steht vor gewaltigen Herausforderungen. Einerseits schwächelt der Absatz auf allen wichtigen Märkten und erhöht den Druck auf die Margen. Andererseits fallen hohe Investitionen für Elektroantriebe, autonomes Fahren und andere Zukunftstechnologien an. "Es gleicht einem Marsch durch die Wüste. Einige Zulieferer werden auf der Strecke bleiben", sagt Kades. Auch Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI warnt: "Wir stehen vor einer Autokrise." Diese werde 2020 oder 2021 ihren Höhepunkt erreichen.
Hart trifft es Unternehmen, die am Verbrennungsmotor hängen. "Alles, was mit alter Antriebstechnik zusammenhängt, ist schwierig", berichtet einer der Banker. "Wir schauen uns genau an, wer sich den Herausforderungen am besten stellt." Schließlich erwarten Branchenexperten, dass bereits 2030 nur noch 50 Prozent der Neuwagen mit einem klassischen Verbrennungsmotor ausgeliefert werden. Der Kostendruck steigt nicht nur durch die sinkende Nachfrage, sondern auch durch die neuen Schwerpunkte der Autobauer. "Was in Infotainment-Systeme, autonomes Fahren und andere Zukunftstechnologien investiert wird, muss an anderer Stelle eingespart werden", erklärt Ellinghorst. Schnell vergeben die Autobauer Einkaufsbudgets über 100 Millionen Euro an Unternehmen, die diese neuen Technologien liefern oder die Software dafür entwickeln. "Das geht zu Lasten der klassischen
Viele Zulieferer müssen daher zügig neue Geschäftsfelder erschließen oder sich so aufstellen, dass sie trotz wegbrechender Geschäfte überleben können. Doch die Kredite für den Umbau zu bekommen, ist nicht trivial. "Die Autohersteller haben eine starke Kapitalausstattung. Aber bei den Zulieferern müssen wir genau hingucken", sagt einer der Banker. "Eine Finanzierung wird genauestens durchleuchtet", berichtet Kades. Die Banken fordern einen detaillierten Geschäftsplan und stellen viele Fragen: Wie hoch sind die Investitionen? Rechnet sich das? Sind die Produkte zukunftsfähig?
Noch sind Insolvenzen wie die des württembergischen Lackieranlagenbauers Eisenmann eher die Ausnahme. Auch die wachsende Zurückhaltung der Banken schlägt noch nicht voll durch. Viele Zulieferer haben das jahrelange Wachstum genutzt, um sich für schlechte Zeiten zu wappnen. Die Verschuldung wurde abgebaut, die Finanzierung auf eine breitere und längerfristige Basis gestellt. Zudem können sich Zulieferer, die Zugang zum Kapitalmarkt haben, dank der lockeren Geldpolitik weiterhin günstig über Anleihen oder Schuldscheine refinanzieren. "Wir können allmählich höhere Preise durchsetzen, doch die Unternehmen haben immer noch das Ventil über den Kapitalmarkt", sagt einer der Banker.
Angesichts rekordniedriger Zinsen haben viele Geldhäuser auf der Suche nach Rendite in den vergangenen Jahren ihr Firmenkundengenschäft ausgebaut und mehr Darlehen vergeben. Syndizierte Kredite, bei denen mehrere Banken als Teil eines Konsortiums ein Darlehen bereitstellen, sind inzwischen die Regel. Doch wehe ein Zulieferer verletzt die Kreditbedingungen (Covenants) - eine Gefahr, die angesichts fallender Margen zunimmt. Dann muss er sich nicht mehr nur mit einigen wenigen Hausbanken auf eine Lösung einigen, sondern zahlreiche Institute überzeugen.