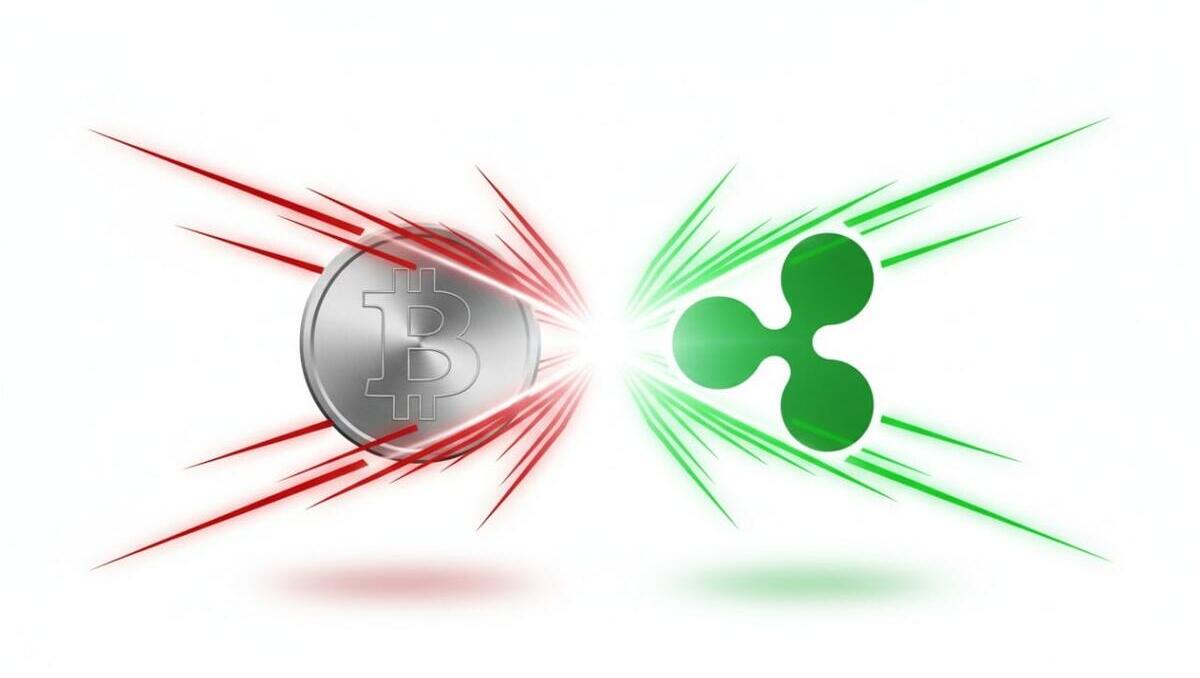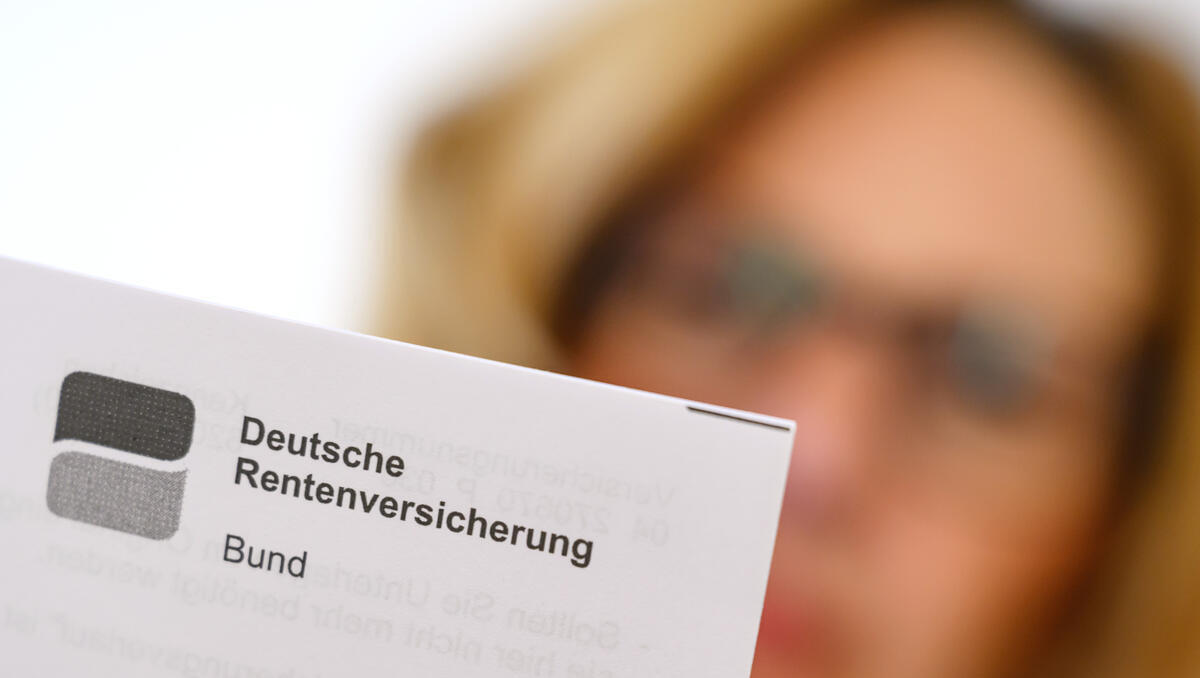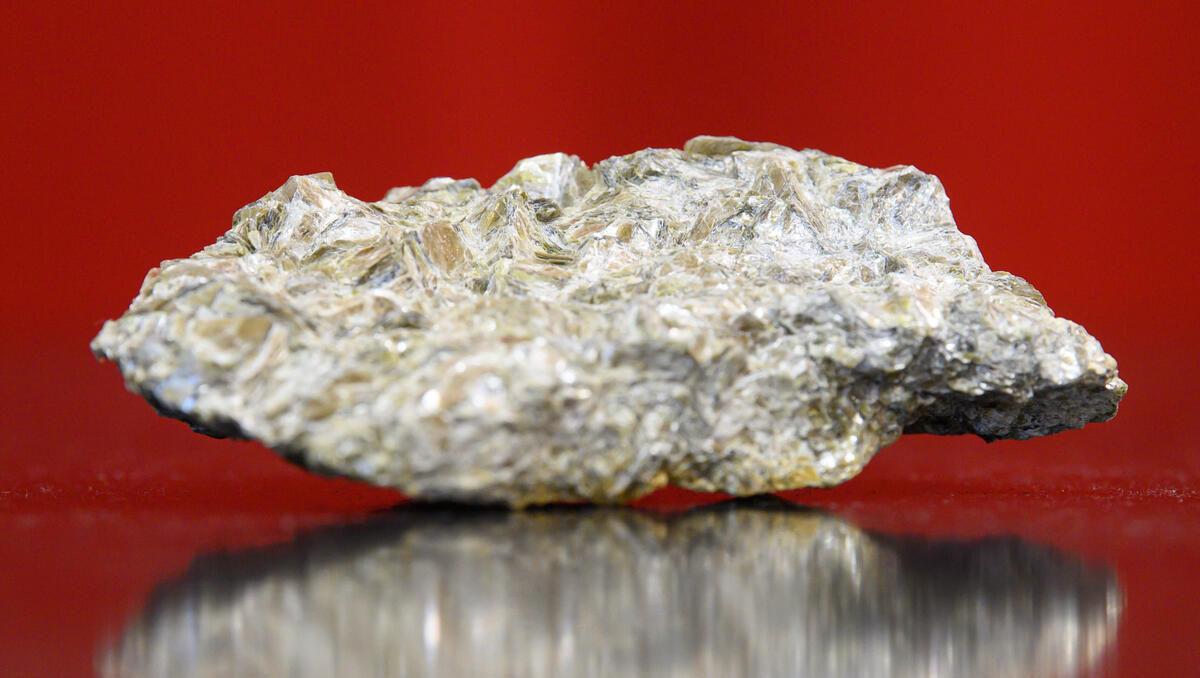Für das nächste Jahr erwartet der Bundesfinanzminister staatliche Gesamteinnahmen in Höhe von 962 Milliarden Euro, die Bund Länder und Gemeinden zugutekommen. Diese Schätzung wird zwei Mal im Jahr vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vorgenommen. Der Arbeitskreis, der 1955 gegründet wurde, ist ein Beirat beim Bundesfinanzministerium, dem verschiedene Bundesministerien, die Finanzministerien der Länder, Wirtschaftsforschungsinstitute, das Statistische Bundesamt und die Bundesbank angehören.
Steuerschätzungen des Arbeitskreises sind die Grundlage für die Haushaltsplanungen. Insgesamt stehen demnach dem Staat insgesamt 30,8 Milliarden Euro weniger zur Verfügung als bisher angenommen. Der Schätzung zufolge werden im nächsten Jahr dem Bund 377,3 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, 13 Milliarden weniger als bisher angenommen, was die zähen Haushaltsgespräche in der Koalition nicht einfacher machen dürfte.
Tatsächlich sieht Lindner aber im Bund eine strukturelle Haushaltslücke gar von 20 Milliarden Euro, denn zu den zurückgehenden Steuereinnahmen kämen zusätzliche Ausgaben durch die jüngsten Gehaltserhöhungen im Öffentlichen Dienst und durch die gestiegenen Kosten für den Schuldendienst. Lindner bekräftigte aber, dass er sowohl an der Einhaltung der grundgesetzlichen Schuldenbremse festhalte als auch nicht daran denke, Steuern zu erhöhen.
„Absurd von einer Geldnot des Staates zu sprechen“
Der Bund der Steuerzahler sieht sich durch die jüngsten Zahlen der Steuerschätzung hingegen bestätigt. Bei Einnahmen von beinahe 1000 Milliarden Euro sei es „absurd von einer Geldnot des Staates zu sprechen“, sagt ihr Präsident Reiner Holznagel den Deutschen Wirtschaftsnachrichten (DWN). Es sei deshalb zwingend, dass der Staat der Forderung des Bundes der Steuerzahler nach einem finanzpolitischen Kurswechsel nachkomme.
„Deutschland ist bei Steuern und Abgaben weltweit einer der Spitzenreiter. Mit Einnahmen von annähernd einer Billion Euro muss doch endlich wieder eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik gelingen – ohne Schattenhaushalte und sogenannte Sondervermögen.“ Der Bund der Steuerzahler schlägt deshalb nicht nur die strikte Einhaltung der Schuldenbremse, sondern auch die Einführung einer Belastungsgrenze für die Bürger ein. Als Anfang fordert Holznagel die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlages und einen konsequenten Inflationsausgleich im Steuerrecht vor.
Tatsächlich belastet kaum ein anderer Staat auf der Welt seine Bürger mit Steuern und Abgaben so sehr wie Deutschland. Im OECD-Vergleich liegt Deutschland mit einer durchschnittlichen Steuer- und Abgabequoten von 49 Prozent beim Alleinstehenden und mit 32,9 Prozent bei Ehepaaren mit zwei Kindern zusammen mit Frankreich an zweiter und dritter Stelle, nur knapp hinter dem Spitzenreiter Belgien.
Zum Vergleich: die USA haben eine Steuer- und Abgabenquote von 14 Prozent bei Alleinstehenden und von 28,3 Prozent bei Ehepaaren mit zwei Kindern. Auch das Vereinigte Königreich schröpft seine Bürger weit weniger brachial (26,4/30,8 Prozent) und selbst das frühere Sozialstaats-Paradies Schweden bürdet seinen Bürgern weniger Steuern und Abgaben auf (37,5/42,7 Prozent) auf.
Die hohe Steuer- und Abgabenlast aber entwickele sich, so Holznagel, zunehmend zu einer Wachstumsbremse. Denn eines der großen Hemmnisse für die heimische mittelständische Industrie sei der akute Fachkräftemangel. Und neben dem Sprachproblemen sind Steuern und Abgaben für viele Fachkräfte ein wichtiges Kriterium, wenn sie sich zwischen mehreren Ländern entscheiden können.
Es sei, so Holznagel gegenüber den DWN, nicht ohne weiteres beispielsweise einem pakistanischen Computer-Experten vermittelbar, warum er nach Deutschland statt nach Großbritannien gehen solle, wenn er in Deutschland nicht nur eine gänzlich neue Sprache lernen müsste, sondern obendrein auch noch deutlich weniger von seinem Lohn behalte. „Wir sind“, so Holznagel bündig, „im Rennen um die besten Köpfe einfach nicht wettbewerbsfähig.“
Experten warnen vor gestiegenen Haushaltsrisiken
Erhebliche Gefahren für die finanzpolitische Stabilität sieht auch der Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft. In einer Stellungnahme für die DWN legt der Verband dar, dass die Haushaltsrisiken deutlich stiegen. So werde die Zins-Steuer-Quote in diesem Jahr von sieben auf 11,1 Prozentpunkte steigen. Das heißt: Von zehn Euro gezahlten Steuern müsse der Staat mehr als einen Euro allein für die Zahlung der Zinsen ausgeben.
Zudem müssten die kommunalen Arbeitgeber mit rund 17 Milliarden Euro „den höchsten Tarifabschluss aller Zeiten schultern“, so Verbandschef Markus Jerger. Dies aber wirke sich dann auch auf die mittelständische Wirtschaft aus, denn das Geld, das die Kommunen für gestiegenen Löhne und Zinsen aufbringen müssten, fehle dann für Investitionen – und darunter leide der Mittelstand. Nach Ansicht des Verbandes steht der Mittelstand in Deutschland vor einer ganzen Reihe großer Herausforderungen. Denn zudem bremse eine „immer undurchsichtigere Regulierung und Bürokratie“ ein mögliches Wachstum des Mittelstandes.
Vor einer großen Herausforderung steht nun auch die Bundesregierung und insbesondere Bundesfinanzminister Lindner. Für den haushaltspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Otto Fricke, stehe Deutschland nun mit den zu erwartenden Mindereinnahmen vor einer „haushaltspolitischen Zeitenwende. Die Zeiten, in denen für alles und jedes Geld da war, sind endgültig vorbei.“ Ein Weiter-So gehe nun nicht mehr, erklärte der Haushaltsexperte gegenüber den DWN: Jeder müsse sich nun fragen, auf was er verzichten könne – und auf was er verzichten müsse.
Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 soll, so die bisherige, Planung noch vor der Sommerpause im Kabinett beschlossen werden, so dass er dann im Parlament beraten und im November beschlossen werden kann.