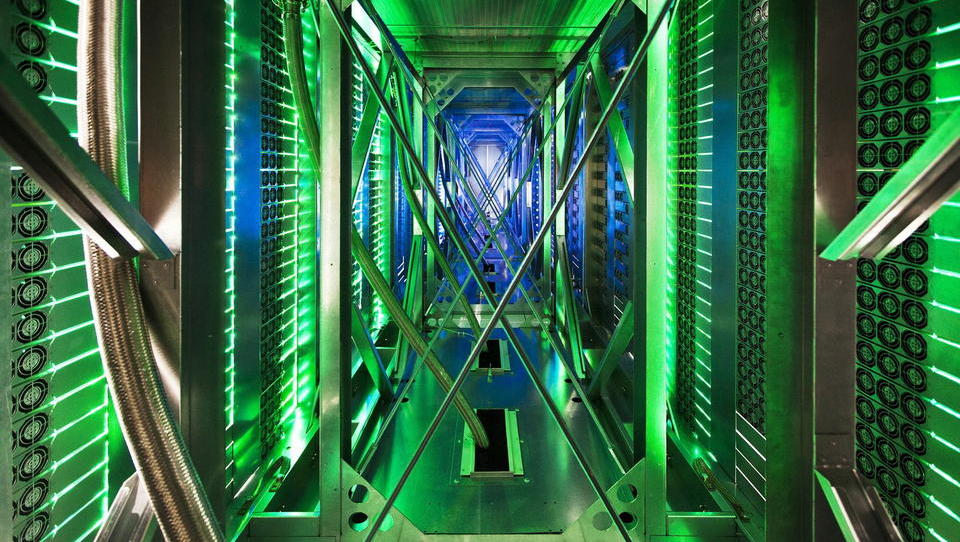Die Europäische Union hat zum 1. Oktober für Importe aus dem Rest der Welt einen sogenannten CO2-Grenzausgleichsmechanismus „Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)“ eingeführt. Der Mechanismus wird vorerst nur als Testlauf geprobt, ab dem Jahr 2026 jedoch sollen die im Rahmen der Maßnahme geplanten Abgaben erhoben werden.
Aus den Entwicklungsländern erhebt sich allerdings schon jetzt Einspruch gegen den Mechanismus, der faktisch eine Ausweitung europäischer Klima-Sonderabgaben und -restriktionen im Wirtschaftsgeschehen auf den Rest der Welt bedeutet.
Warum ein CO2-Grenzausgleich?
Mit dem Grenzausgleich will die EU außereuropäische Zulieferer von Rohstoffen oder energieintensiv hergestellten Produkten dazu zwingen, eine Sonderabgabe zu bezahlen. Faktisch handelt es sich also um einen Importzoll, dessen Verhängung Brüssel mit dem „Klimaschutz“ begründet.
Der Grund für den Mechanismus ist folgender: Die Unternehmen der EU müssen seit einigen Jahren immer mehr Geld aufwenden, um die zunehmend teurer werdenden Emissionszertifikate zu erwerben. Weil sie dadurch an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Firmen aus Ländern einbüßen, die sich an dem in Europa etablierten Emissionszertifikatehandel nicht beteiligen, versucht die EU-Kommission mit dem CO2-Grenzausgleich nun faktisch, die eigenen Industrien nach außen hin vor der günstigeren Konkurrenz zu schützen und einen Teil der vom Emissionshandel ausgelösten Sonderkosten den ausländischen Zulieferern aufzubürden.
Wie deutlich die Preisanstiege im europäischen Zertifikatehandel sind, berichtet der Blog German Foreign Policy. Demnach kosteten Zertifikate für den Ausstoß von einer Tonne des lebenswichtigen Naturgases Kohlenstoffdioxid (CO2) Mitte des vergangenen Jahrzehnts fünf Euro. Derzeit müssen Unternehmen rund 80 Euro bezahlen, um eine Tonne CO2 in Europa legal emittieren zu dürfen.
Tatsächlich haben viele energieintensiv arbeitende Konzerne aber weitaus weniger bezahlt, weil die EU in großem Umfang Gratis-Zertifikate verteilt hat. Ab 2026 jedoch sollen diese nicht mehr ausgegeben werden – und genau deshalb kommt dann der Grenzausgleich ins Spiel, der faktisch wie ein industriepolitisches Schutzprogramm gegenüber der außereuropäischen Konkurrenz fungieren soll.
Hoffnung auf Nachahmung
Daneben hofft man in Brüssel offenbar auch, dass der Grenzausgleich den Aufbau „klimaneutraler“ Industrien und Produktionsprozesse außerhalb Europas anstoßen wird. Denn führt ein außereuropäischer Staat selbst ein Emissionssystem ein oder de-karbonisiert seine Volkswirtschaft, würden die daraus resultierenden Kosten auf den Grenzausgleich der EU angerechnet und in vielen Fällen wohl ganz neutralisiert, wenn ein Unternehmen aus diesem Land Waren nach Europa exportiert.
Das entsprechende Land „erkauft“ sich dann gewissermaßen den weiterhin kostenlosen Zugang zum EU-Markt durch die Dekarbonisierung der eigenen Wirtschaft, so die Planspiele.
Mit Blick auf die Exporte europäischer Unternehmen in die Welt bleiben noch viele Fragen offen. „Auch schafft der Grenzzoll zwar bessere Wettbewerbsbedingungen innerhalb Europas, doch auf dem Weltmarkt bleibt der Kostenunterschied. Eine Lösung für die Exporte hat die EU bislang nicht gefunden. Die Voest kritisiert: Das System würde die globale Wettbewerbsfähigkeit der exportierenden EU-Industrie schwächen. Gleichzeitig biete die Entscheidung zumindest ‚deutlich mehr Planungssicherheit für die Umstellung auf CO2-reduzierte Technologien‘. Den Zweck, dass europäische Unternehmen am europäischen Markt geschützt werden, dürfte der Mechanismus erfüllen“, schreibt der Standard.
Proteste aus dem Globalen Süden
Der Mechanismus löst schon jetzt, während der Testphase, Proteste in vielen Entwicklungsländern aus und könnte langfristig zu ernsten Auseinandersetzungen mit anderen großen Wirtschaftsräumen führen, wenn er 2026 tatsächlich in Kraft treten sollte.
„Besonders hart trifft der CBAM die Staaten Afrikas. Weil viele von ihnen vom Export von Rohstoffen wie Eisen sowie von Produkten wie Dünger abhängig sind, steht für sie sehr viel auf dem Spiel. Der CBAM zwingt sie, kostspielige Kapazitäten aufzubauen, um den mit ihren Exportgütern verbundenen CO2-Ausstoß zu berechnen. ‚Das kann den Entwicklungsländern, die schon jetzt einigen der höchsten Handelsbarrieren weltweit gegenüberstehen, Gebühren technischer sowie verwaltungstechnischer Art aufbürden‘, warnt beispielsweise Rim Berahab vom Research for Policy Center for the New South. In Verbindung mit den ab 2026 zu zahlenden Abgaben auf Güter, die mit einem größeren CO2-Verbrauch hergestellt wurden, sei mit Verlusten bei den Ausfuhren aus Afrika nach Europa zu rechnen“, berichtet German Foreign Policy.
Zu den afrikanischen Ländern, die besonders anfällig für die vom Grenzausgleich ausgelösten Zusatzkosten wären, gehören beispielsweise Mosambik, Simbabwe und Guinea. So liefert Simbabwe fast 90 Prozent seiner Eisen- und Stahlexporte in die EU, Mosambik etwa 75 Prozent seiner Aluminiumausfuhren.
Europäische Länder, die vom CO2-Grenzausgleich stark betroffen sein könnten, sind Bosnien-Herzegowina, die Ukraine und Serbien.
Im Juli hatte die Regierung Südafrikas in einem offiziellen Schreiben gegen den Grenzausgleich protestiert. Eigenen Berechnungen zufolge würde die südafrikanische Wirtschaft, deren Exporte zu etwa der Hälfte aus Rohstoffen besteht, jährlich 1,5 Milliarden US-Dollar verlieren, wenn die Maßnahme der EU in Kraft trete.
Viele ärmere Länder warnen, dass sie nicht über die finanziellen und technischen Ressourcen verfügten, um die von den Europäern angestrebte De-Karbonisierung ihrer Volkswirtschaften zu realisieren, welche dutzende Milliarden Euro benötigen würde.
Rückwirkungen auf Deutschland
Noch befindet sich der CO2-Grenzmechanismus, wie bereits erwähnt, im Testmodus. Sollte er 2026 wirklich aktiviert werden, könnte er langfristig Umschichtungen im Welthandel und in den weltumspannenden Liefereketten auslösen und dadurch negative Rückwirkungen auch auf die deutsche Wirtschaft entfalten, welche in den vergangenen Jahrzehnten massiv vom freien Warenverkehr profitiert hat.
Entwicklungsländer wie Mosambik oder Simbabwe, die zu den ärmsten Staaten der Welt gehören, könnten dann geneigt sein, ihre Exporte nach Europa drastisch zu verringern und neue Abnehmer für ihre Rohstoffe und Produkte zu finden.
Hierfür bieten sich die schnell wachsenden großen Wirtschaftsmächte des Globalen Südens an, in erster Linie China und Indien, aber auch Länder wie Brasilien, Russland, die Türkei, Indonesien, Vietnam, der Iran, Saudi-Arabien oder Mexiko.
Alle diese Länder beteiligen sich weder am Emissionshandel der EU noch sind ihnen verpflichtende Maßnahmen im Rahmen der globalen Klimaschutz-Vereinbarungen wie etwa dem Pariser Abkommen auferlegt. Selbst die USA haben das Pariser Abkommen zwar formal bestätigt, aber bis heute nie ratifiziert.
Zudem orientieren sich viele von ihnen zunehmend an alternativen Machtstrukturen, etwa dem BRICS-Forum oder suchen Unterstützung bei der Asiatischen Infrastruktur- und Investitionsbank. Eine Umlenkung der Warenströme würde sich demnach zumindest teilweise in einem geopolitisch neuartigen Organisationsrahmen entfalten.
Es besteht also die Gefahr, dass sich die EU mit ihrer zunehmend restriktiveren Klima-Wirtschaft international isoliert und ihre ohnehin schwindende Wettbewerbsfähigkeit weiter einbüßt.