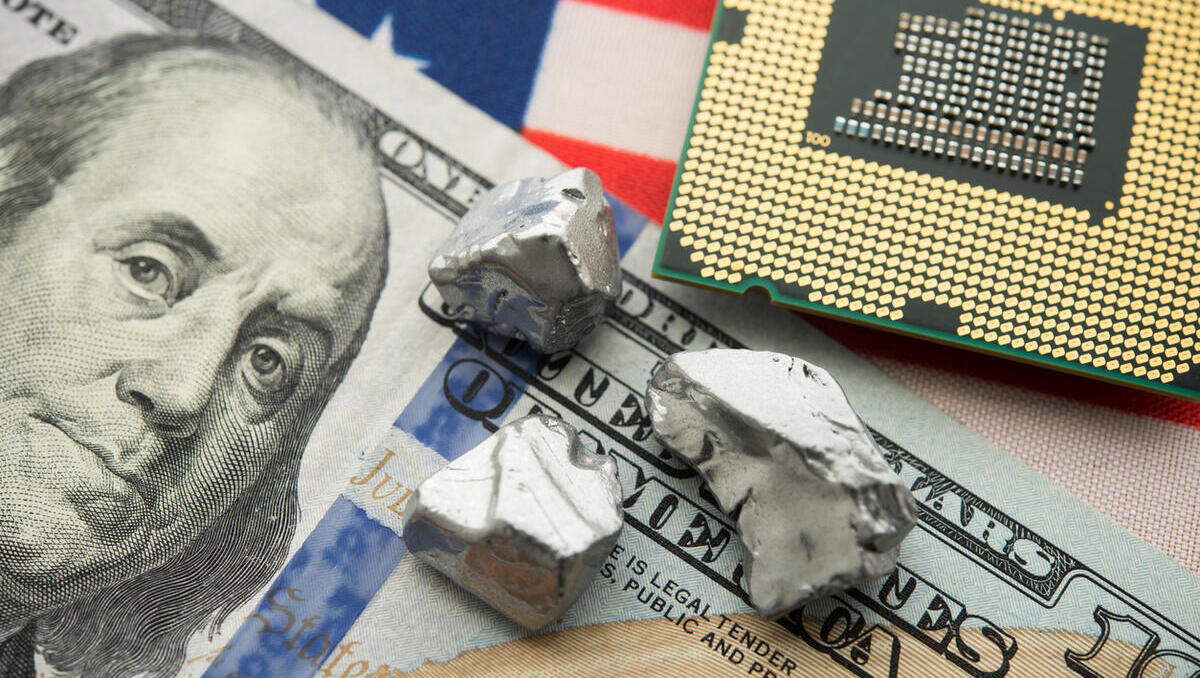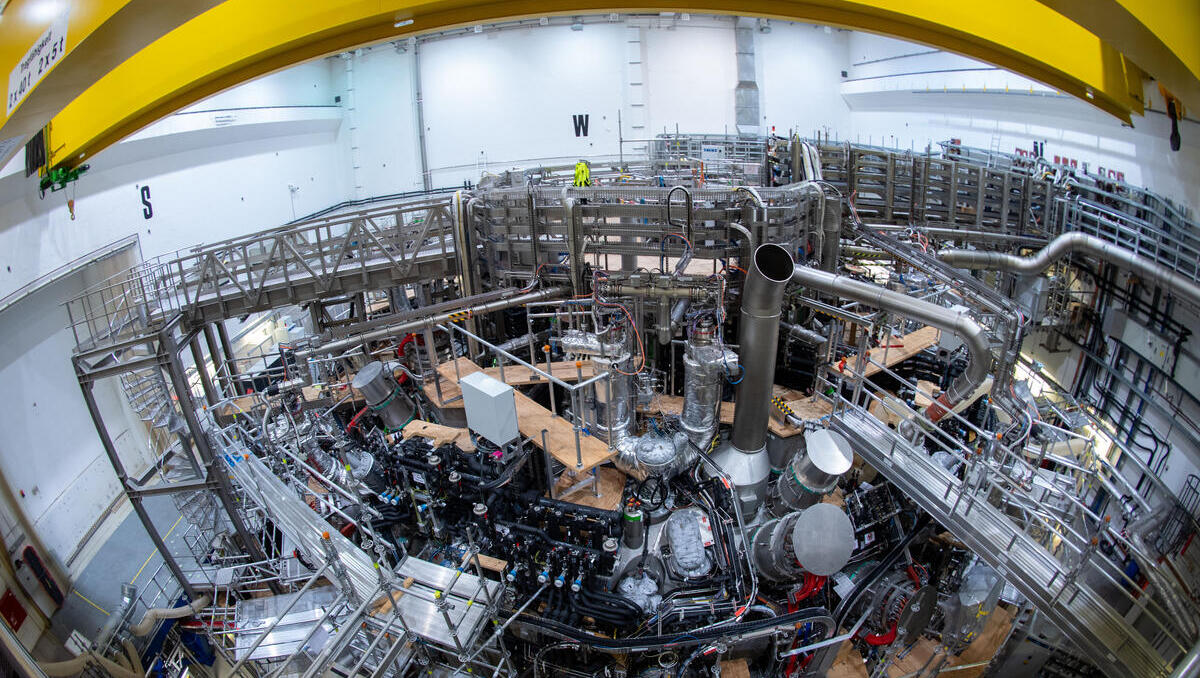Das Digital Services Act Paket (DSA) der EU trat Mitte Februar 2024 in Kraft. Kernbestandteile der Verordnung gelten bereits seit seiner Einführung Anfang 2022 doch der Großteil der Verpflichtungen ist erst jetzt seit Mitte Februar anwendbar. Die auch als „Notstandsgesetz“ bekannte Verordnung ist im Stande Teile der Demokratie auszuhebeln, sagen Kritiker. Die Formulierungen in der Verordnung sind teilweise sehr weit gefasst und lassen Spielraum für Interpretationen.
Ein Beispiel ist Artikel 36, welches die Überschrift „Krisenreaktionsmechanismus“ trägt. Für die Erfüllung dieses Artikels gilt eine Krise als eingetreten, „wenn außergewöhnliche Umstände vorherrschen, die zu einer schwerwiegenden Bedrohung der öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit in der Union oder in wesentlichen Teilen der Union führen können“. Welches diese sein könnten, bleibt offen. Verlangen kann die neue Verordnung viel von den betroffenen Anbietern, bis zur „Anpassung des algorithmischen Systems“, wie in Artikel 35 nachzulesen ist. Auch die rasche Entfernung, Anpassung der Inhalte etc. sind Maßnahmen, die der Artikel vorsieht.
Verordnung für die gesamte EU
Die Verordnung gilt für die gesamte EU und betrifft vor allem Online-Plattformen und -Marktplätze, soziale Netzwerke, Content-Sharing-Plattformen, App-Stores sowie Online-Reise- und Unterkunftsplattformen. Alles Internetangebote, bei denen auch viel Nutzerkommunikation vorkommt. Sei es in Form von Bewertungen, Kommentaren, Meinungen oder Rezensionen. Für den Nutzer soll die Verordnung für mehr Sicherheit und Transparenz sorgen. Doch der Gesetzestext ruft auch Fragen hervor, wie die des Artikels 34, denn was könnten „tatsächliche oder absehbare nachteilige Auswirkungen auf die gesellschaftliche Debatte und auf Wahlprozesse und die öffentliche Sicherheit“ sein? Wer den Regierungskurs nicht unterstützt oder eine andere Meinung zu politischen Entscheidungen öffentlich kundtut, gefährdet dieser bereits die öffentliche Sicherheit? Wer entscheidet darüber, wann die öffentliche Sicherheit in Gefahr ist? Wie soll das gemessen werden? Bei Eintritt dieser Situation wird ein rasches Handeln von der EU verordnet. Inhalte sollen laut EU entfernt werden, „die systemische Risiken in der Union haben, die sich aus der Konzeption oder dem Betrieb ihrer Dienste und seinen damit verbundenen Systemen, einschließlich algorithmischer Systeme, oder der Nutzung ihrer Dienste ergeben“ (Artikel 34). Als Desinformation bezeichnet die EU nicht nur falsche oder irreführende Information, sondern auch solche die die politische Entscheidungsfindung bedrohen.
Die Verordnung ist teilweise schwierig zu vereinbaren mit dem Demokratiebegriff. Natürlich verlangt Demokratie Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte. Doch Demokratie besagt auch, dass die Macht vom Volk ausgeht. Die Macht der freien Meinungsäußerung, ohne Zensur. Eine Vielfalt von Meinungen ist unabdingbar. Und besonders hier, bei der Vielfalt, könnte die EU als, sagen wir mal Instanz, Beschränkungen verordnen und damit ihre Macht entgegenstellen. Es läuft auf eine Art Gewaltenteilung zwischen Online-Anbieter, EU und Verbraucher hinaus, wobei den Verbrauchern zwar mehr Rechte und Sicherheit zugeordnet werden, die letzte Entscheidungsgewalt jedoch aufgrund der Auslegungsgestaltung bei der EU liegt. Das wiederum, fühlt sich nicht hundertprozentig demokratisch an. Artikel 48 verlangt von den betroffenen Plattformen die Informationen zur Krise vor den Behörden der Mitgliedsstaaten oder den Behörden der EU darzustellen. Die EU-Behörden können sodann verordnen schädliche, nachhaltig oder riskante Inhalte zu löschen. Ein Machtgefälle, dass Willkür nicht gänzlich ausschließt.
DAS-Vorgaben lassen Internetriesen kalt
Stur- oder Dreistigkeit herrschte auf der Seite der großen Plattformbetreiber vor. Denn obwohl das DAS-Gesetz Schluss machen sollte mit manipulativen und undurchsichtigen Praktiken, hielten sich nicht alle daran. Sie ignorierten schlichtweg die Vorgaben. Das zumindest ergab eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Bundesverband (Vzbv). So warf der Verband den Unternehmen gravierende Mängel bei der Einhaltung der vorgeschriebenen Werbetransparenz vor. Davon betroffen sind Riesen wie Instagram, Snapchat, TikTok und X (Twitter). Keiner, der genannten Anbieter, erfüllte die Anforderungen zum Erhebungszeitpunkt der Untersuchung, Verbraucher leicht zugänglich und verständlich darüber zu informieren, nach welchen Kriterien beispielsweise Werbeanzeigen platziert werden. Snapchat ging noch einen Schritt weiter und machte Werbung überhaupt nicht kenntlich. Und dass, obwohl für die sogenannten „very large online platforms“ (VLOP) strengere Regeln gelten als für kleinere Anbieter. Ob diese Mängel mittlerweile behoben wurden, ist offen.
Resilienz im digitalen Wandel nimmt ab
Da unsere Lebenswelt sich größtenteils bereits digital abspielt, ist es umso wichtiger den Verbraucherschutz zu stärken. Immer mehr Menschen in Deutschland nehmen an der digitalen Welt teil, was zunächst gut erscheint. Der Digital-Index Wert zeigt jedoch, dass die positive Grundeinstellung zum digitalen Wandel und damit die Fähigkeit mit der Entwicklung Schritt halten zu können, sinkt. Statt Anpassung an die steigenden Herausforderungen reagieren diese Menschen mit Rückzug. Das erzeugt eine Spaltung und führt letztendlich dazu, dass einige den technologischen Fortschritt nicht standhalten können und vom Wandel abgehängt werden. Die Europäische Kompetenzagenda setzte bereits vor drei Jahren das Ziel, dass bis 2025 mehr als zweidrittel (70 Prozent) der Erwachsenen über digitale Basiskompetenzen verfügen sollen. Bisher verfehlt Deutschland diese Vorgabe. Gerade einmal die Hälfte ist erst digital fit, so der D21-Digital-Indix 2023/24, eine Studie von Kantar. Zu den Basiskompetenzen zählen: Informationen online finden, Textprogramm nutzen, Fotos/Videos mit dem Smartphone verschicken, Smartphonefunktionen anpassen und starke Passwörter verwenden. Da es durch die Künstliche Intelligenz (KI) zu einer deutlichen Beschleunigung des digitalen Wandels kommt und die Nutzer vor neuen Herausforderungen stellen wird, gilt es umso mehr den Anforderungen des Wandels resilient zu begegnen. So ist zu erwarten, dass die Anforderungen an die Informationskompetenzen steigen werden, da KI erzeugte Inhalte nicht mehr von echten Informationen zu unterscheiden sind. Im Superwahljahr 2024 ist zu erwarten, dass das Thema Falsch- oder Desinformationen eine größere Rolle spielen wird. Die digitalen Kompetenzen der Bürger hinken dabei hinterher. Schlimmer noch, die Menschen zweifeln an der digitalen Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Schulen im Vergleich zu anderen Nationen. Nur 28 Prozent glaubten 2023, dass Schulen Schüler adäquat auf den Umgang mi der Digitalisierung vorbereiten. Die Befähigung der Menschen kann aber nicht ausschließlich in der Eigenverantwortung für dieses Thema erwartet werden. Es ist eine mindestens genauso große Mammutaufgabe wie die grüne Transformation, die viele Akteure, Unterstützung und Maßnahmen für das Gelingen benötigt.