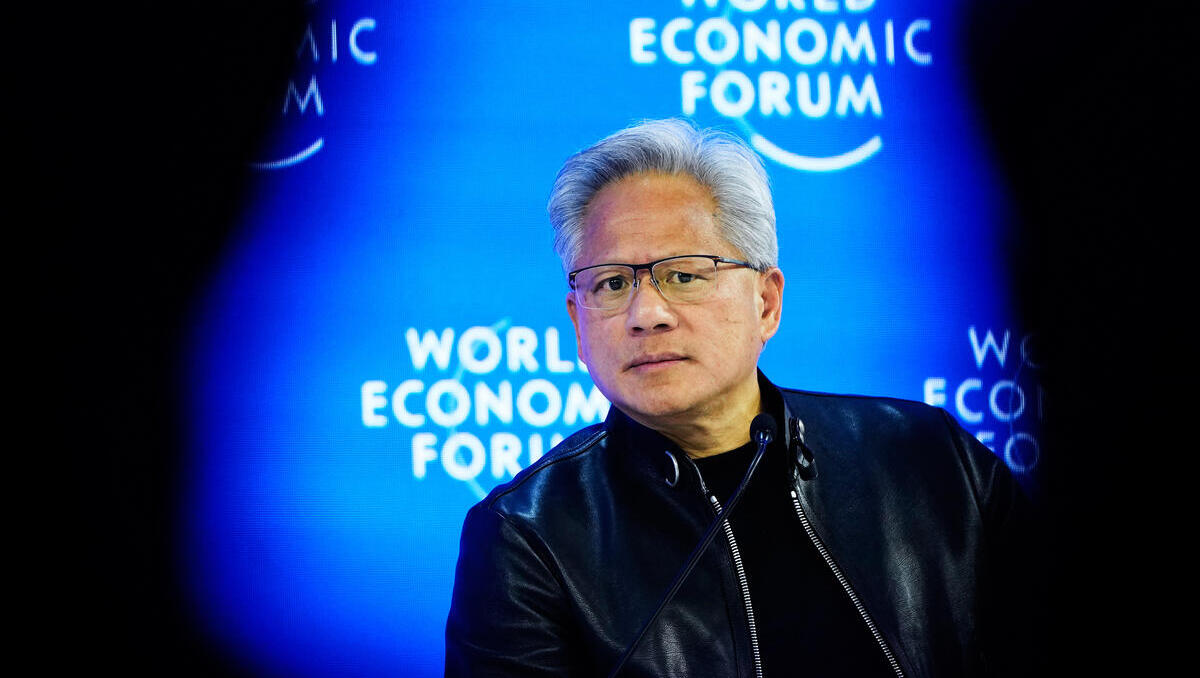Im Vorfeld der Einführung des neuen Gesetzes vermeldete das Statistische Bundesamt einen neuen Rekord an Einbürgerungen. Durch die gestiegene Zuwanderung in den vergangenen zehn Jahren konnten im Jahr 2023 rund 200.100 Menschen „Neubürger“ werden. Das sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 19 Prozent mehr Einbürgerungen als im Vorjahr. 2024 könnte diese Zahl noch einmal höher liegen.
Ab 27. Juni gilt das neue Gesetz zur Staatsangehörigkeit
Ihr Vorhaben, das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht zu reformieren, hatte die Ampel Ende 2021 in ihrem Koalitionsvertrag verankert. Als die Umsetzung konkreter wurde, erntete die Regierung viel Kritik für ihr Vorhaben. Denn: Der Gesetzesentwurf sah nicht nur eine Modernisierung des Staatsbürgerschaftsrechts vor, sondern auch eine Erleichterung von Einbürgerungen. Der CSU-Politiker Joachim Herrmann sprach etwa vom „Verramschen“ der deutschen Staatsbürgerschaft, während Innenministerin Nancy Faeser ihr Vorhaben mit den Worten verteidigte: „Den Wohlstand von morgen schaffen wir nicht mit den Regeln von gestern“. Im Januar wurde das Gesetz vom Bundestag verabschiedet.
Welche neuen Regeln gelten 2024 für den Erwerb der Staatsbürgerschaft?
Von einer Einbürgerung spricht man dann, wenn Menschen mit Migrationsgeschichte die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Ausgestellt werden der jeweiligen Person damit die Ausweisdokumente der Bundesrepublik Deutschland. Zudem erlangt sie faktisch dieselben Rechte wie eine Person, die in Deutschland geboren wurde. Dazu gehört beispielsweise das Wahlrecht.
Generell gilt für die Einbürgerung in Deutschland ein Mindestalter von 16 Jahren. Kinder, die in Deutschland geboren sind und deren Eltern hier leben, erhalten automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft.
Es soll weiter der Grundsatz gelten: „Wer eingebürgert werden möchte, muss selbst für seinen Lebensunterhalt aufkommen können“. Der Bezug von Grundsicherung, Bürgergeld oder ähnlichen Leistungen gilt entsprechend als Hindernis. Es sei denn, es gibt dauerhafte und schwerwiegende gesundheitliche Gründe.
Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren oder kürzer
Bisher galt: Wer eingebürgert werden wollte, musste zuvor schon mindestens acht Jahre in Deutschland gelebt haben. Es geht dabei um einen berechtigten Aufenthalt. Dafür braucht man eine Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaubnis oder eine Blaue Karte. Die Aufenthaltsdauer konnte aber auch verkürzt werden, wenn ein Integrationskurs vollständig absolviert wurde oder bei besonderen Integrationsleistungen, wie eine abgeschlossene Ausbildung.
Nach dem neuen Staatsbürgerschaftsrecht wird die Mindestaufenthaltsdauer auf fünf Jahre verringert. Ebenfalls kann bei besonderen Integrationsleistungen der kürzeste Zeitraum nun drei Jahre betragen, bevor eine Einbürgerung möglich wird.
Entscheidend sind die Sprachkenntnisse
Entscheidend bleibt der Erwerb des sogenannten „B1-Niveaus“. Das beschreibt das Minimum an Deutsch-Kenntnissen. Ein Schulabschluss in deutscher Sprache umfasst in etwa das B1-Niveau. Wurden anderweitig Sprachkurse absolviert und Sprachzertifikate erworben, werden diese behördlich geprüft. Wer das nicht nachweisen kann, muss dagegen einen Sprachtest für Zuwanderer ablegen. Ausgenommen sind Menschen mit Behinderung oder Krankheiten, die das Erlernen der deutschen Sprache unmöglich machen.
Darüber hinaus gilt eine Altersgrenze von 65 Jahren. Ab diesem Alter entfällt der Sprachtest auch für die sogenannte Gastarbeitergeneration. Dazu zählen Gastarbeiter und Vertragsarbeitnehmer, die bis 1974 in die Bundesrepublik oder bis 1990 in die ehemalige DDR eingereist sind.
Kritik: Doppelte Staatsbürgerschaft erlaubt
Migranten müssen Ihre bisherige Staatsbürgerschaft nicht mehr aufgeben. Zukünftig soll die doppelte Staatsbürgerschaft nicht mehr nur auf Bürger aus EU-Länder oder die Schweiz, Afghanistan, Iran und Marokko beschränkt sein. Der Grundsatz der Vermeidung von „Mehrstaatigkeit“ entfällt nach dem 26. Juni 2024. Von deutscher Seite steht damit auch der Annahme einer anderen ausländischen Staatsbürgerschaft an, ohne den deutschen Pass abgeben zu müssen.
Es reicht, wenn der Einbürgerungswillige sich schriftlich und vor Ausgabe der Einbürgerungsbestätigung auch mündlich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Als Nachweise für einen berechtigten Aufenthalt müssen persönliche Dokumente vorgelegt werden, die Herkunft und familiäre Abstammung belegen können.
Kann man ohne Einbürgerungstest eingebürgert werden?
Laut dem zuständigen Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge soll der Test bei Einbürgerungen Kenntnisse zu „Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland“ sicherstellen. Aktuell umfasst der Einbürgerungstest in allen Bundesländern 33 Fragen.
Ende März wurde bekannt, dass Bundesinnenministerin Faeser den Fragenkatalog zum Einbürgerungstest in Kürze umfassend erneuern will. So sollen künftig verstärkt Fragen zum jüdischen Leben in Deutschland eine Rolle spielen. Entsprechend sollen von einbürgerungswilligen Migranten künftig auch Fragen zum Holocaust beantwortet werden. Die Idee, vor Einbürgerungen ein explizites Bekenntnis zum Existenzrecht Israels zu verlangen, soll laut Bundesinnenministerium nicht umgesetzt werden.
Ist der Test nicht bestanden, gilt die Einbürgerung zunächst als gescheitert. Es gibt aber die Möglichkeit, erneut anzutreten.
Eine Ausnahme sieht das neue Gesetz für die sogenannte Gastarbeitergeneration vor. Für Migranten, die schon viele Jahrzehnte in Deutschland leben, soll der Einbürgerungstest – als Anerkennung ihrer Leistungen – künftig entfallen.
Können auch Flüchtlinge in Deutschland eingebürgert werden?
Insbesondere ab dem Jahr 2015 ist die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland deutlich gestiegen. Auch im vergangenen Jahr stellten rund 136.000 Flüchtlinge einen Asylantrag in Deutschland, wobei die aus der Ukraine geflüchteten Menschen noch nicht eingerechnet wurden. Für Geflüchtete gelten weitestgehend Regeln wie für andere Migranten auch, allerdings ist eine Anerkennung des Asylantrags die entscheidende Voraussetzung. Eine Duldung, ein negativer Asylbescheid oder eine drohende Abschiebung stehen einer Einbürgerung hingegen im Weg.
Fazit: Mit Einführung des neuen Gesetzes zur Staatsangehörigkeit rechnen die meisten Bundesländer noch mal mit einem deutlichen Anstieg der Einbürgerungsanträge, zusätzlich von Menschen, die jetzt ein Recht auf eine doppelte Staatsbürgerschaft haben. Der öffentliche Dienst braucht jetzt noch mehr Beamte für die Bearbeitung der Anträge. Da passt es doch, dass Nancy Faeser zukünftig mehr Migranten für eine Arbeit als Beamter im öffentlichen Dienst begeistern möchte. Ein dafür geplantes Bundespartizipationsgesetz steht schon in den Startlöchern.
Umstritten bleibt, ob ein Doppelpass die Integration und das eindeutige Bekenntnis zu Deutschland fördert oder gar verhindert.
Die Voraussetzungen für eine deutsche Staatsbürgerschaft stehen im sogenannten Staatsangehörigkeitsgesetz (kurz: StAG). In 42 Paragrafen findet man dort die Regularien rund um Antragsberechtigung, Aufenthaltsdauer, Ehe und Lebenspartnerschaft, Herkunft und Flucht sowie verschiedene Altersklassen. Die nun verabschiedeten Änderungen im Gesetz beziehen sich vor allem auf die Artikel 4 und 10.