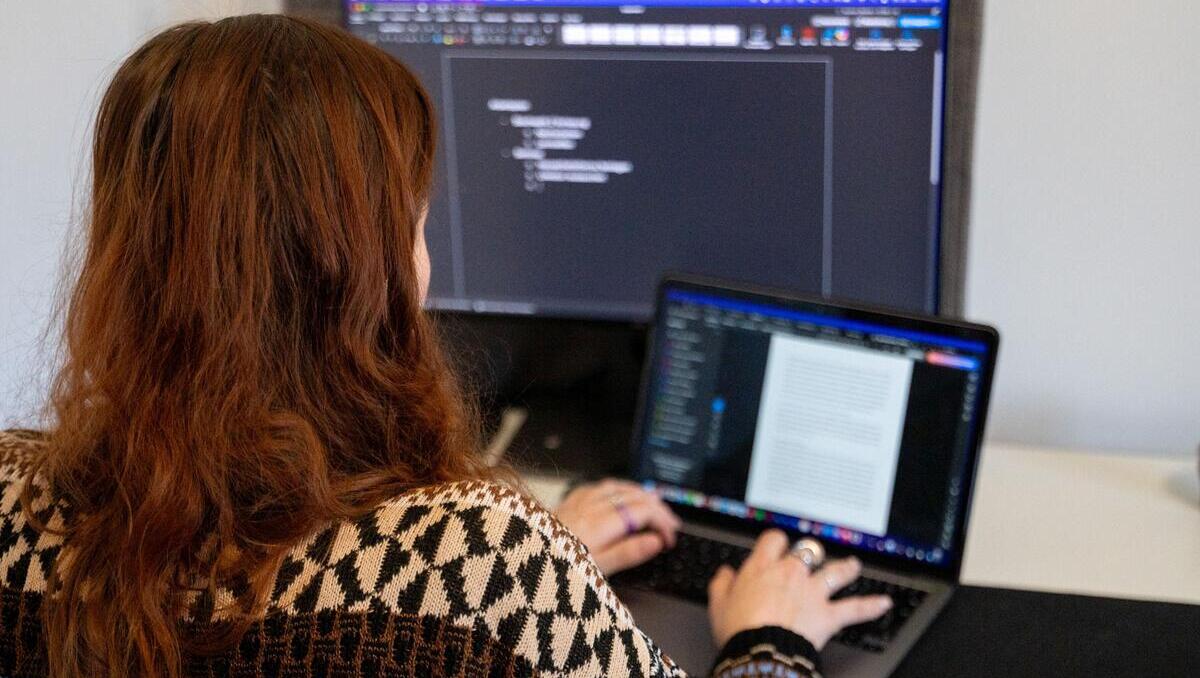Nach Beginn der groß angelegten Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 fanden Millionen von Ukrainern Zuflucht in der Europäischen Union. Allein Deutschland und Polen nahmen jeweils rund eine Million Flüchtlinge auf. Doch war dies immer nur als vorübergehende Lösung gedacht. Der langwierige Abnutzungskrieg, der sich inzwischen in der Ukraine abspielt, erfordert einen anderen Ansatz.
Die Antwort ist nicht eine stärkere Integration in die Aufnahmeländer. Die Ukrainer integrieren sich bereits in Deutschland und anderswo, aber wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij wiederholt betont hat, braucht die Ukraine ihre Bürger zurück – sowohl, um einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen zu leisten, als auch, um sicherzustellen, dass die Bevölkerungszahl des Landes und damit auch seine wirtschaftlichen Aussichten nicht einbrechen. Viele ukrainische Unternehmen berichten schon jetzt, dass der Mangel an Arbeitskräften ihre Aktivitäten in entscheidender Weise beeinträchtige, und die ukrainische Bevölkerung wird drastisch zurückgehen – laut einer Prognose von über 40 Millionen vor dem Krieg auf etwa 31 Millionen im Jahr 2035.
Die einzige Möglichkeit zum Ausgleich dieses Rückgangs besteht darin, mehr ukrainische Flüchtlinge zur Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen. Das wird nicht einfach: Umfragen zeigen, dass sie durch die Ungewissheit über Sicherheit, Wohnraum und Beschäftigung abgeschreckt werden. Zum Glück sind diese Probleme auch unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen lösbar.
Die Sorgen um Sicherheit und Wohnraum sind eng miteinander verknüpft. Im Januar 2024 waren mehr als 8,6 % des ukrainischen Wohnungsbestands aus der Vorkriegszeit vor allem im östlichen Teil des Landes beschädigt oder zerstört. In der Westukraine, wo die Zerstörung relativ gering war, trieb ein massiver Zustrom von Binnenflüchtlingen die Wohnungspreise in die Höhe. Doch selbst im Westen ist Wohnraum in den kleineren Städten noch weitgehend erschwinglich, und es gibt leer stehende Häuser, in denen Rückkehrer untergebracht werden könnten.
Um die Sicherheit und den Wohnraum in der Westukraine nutzen zu können, müssten die Rückkehrer jedoch auch Beschäftigungsmöglichkeiten in der Westukraine haben. Die deutsche Bundesregierung gibt derzeit jährlich etwa 9-10 Milliarden Euro für die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge aus, und auch die Aufwendungen der subnationalen Behörden sind beträchtlich. All diese Ausgaben dienen der Deckung der Grundbedürfnisse der Flüchtlinge sowie der Durchführung von Deutschkursen zur Förderung der Integration, scheinen aber nicht zu einer Beschäftigung zu führen.
Tatsächlich deuten offizielle Daten darauf hin, dass von den 743.000 derzeit in Deutschland lebenden ukrainischen Staatsbürgern im erwerbsfähigen Alter (von insgesamt 1,3 Millionen) etwa 135.000 einer „normalen“ (sozialversicherten) Arbeit nachgehen und weitere 40.000 einen Minijob haben. Das entspricht einer Beschäftigungsquote von etwa 20 %. Die Beschäftigungsquoten sind in EU-Ländern mit weniger großzügigen Sozialversicherungssystemen höher, was darauf hindeutet, dass das Arbeitskräfteangebot dort auf Anreize reagiert.
Statt innerhalb der Aufnahmeländer Geld in Sozialleistungen zu stecken, sollten die EU und ihre Mitgliedstaaten diese Mittel umwidmen, um die Rückkehr der Flüchtlinge in die Ukraine, insbesondere die Westukraine, zu unterstützen. Gut konzipierte EU-finanzierte Wiedereingliederungsprogramme würden nicht nur mehr Ukrainern die Rückkehr ermöglichen und damit den Arbeitsmarkt in ihrem Heimatland stärken, sondern auch europäische Unternehmen ermutigen, in den stabileren Gebieten der Ukraine zu investieren und damit den Grundstein für einen kräftigen Aufschwung für die Zeit nach dem Krieg zu legen.
Die europäischen und insbesondere die deutschen Unternehmen haben eine gewisse Bereitschaft zu derartigen Investitionen gezeigt. Der deutsche Kabelhersteller Leoni beschäftigte in der Westukraine vor dem Krieg mehr als 7000 Mitarbeiter, und das Pharma- und Biomedizinunternehmen Bayer hat 2023 zugesagt, 60 Millionen Euro im ukrainischen Pochuiky zu investieren. Derzeit jedoch behindern die Kriegsrisiken und der Mangel an qualifiziertem deutschsprachigen Personal weitere Investitionen.
Beidem lässt sich abhelfen. Die Logik des Krieges begünstigt eine Produktion, die entweder in befestigten Clustern (am besten für die großmaßstäbliche Produktion) oder dezentral organisiert ist (besser geeignet für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs)). Wenn kleine Fabriken über ein großes Gebiet verstreut sind und sich in einiger Entfernung von der Front befinden, ist das Risiko einer direkten Zerstörung begrenzt.
Um die Kriegsrisiken weiter zu verringern, können deutsche oder EU-Institutionen wie die staatliche deutsche Investitions- und Entwicklungsbank KfW oder die Europäische Investitionsbank eine Art Versicherung anbieten. Kombinieren ließen sich derartige Programme mit einer Umsiedlungshilfe und der Finanzierung betrieblicher Ausbildungsmaßnahmen – einschließlich der erforderlichen Sprachkurse – für ukrainische Flüchtlinge, die in neu errichteten europäischen Fabriken in der Westukraine arbeiten wollen. Die Verknüpfung von Umsiedlungs- und Beschäftigungsmaßnahmen würde sicherstellen, dass die Rückkehrer keine Belastung für die bereits angespannten öffentlichen Finanzen der Ukraine darstellen.
Dieses Programm würde der Ukraine längerfristige Vorteile bringen. Historisch gesehen war die Westukraine weniger entwickelt als andere Teile des Landes. Doch der wirtschaftliche Schwerpunkt der Ukraine hat sich in letzter Zeit gen Westen verlagert. Das liegt teils daran, dass der Großteil der Schwerindustrie im Osten zerstört wurde, aber auch an der Nähe zur EU. Sicherzustellen, dass die Westukraine über eine starke Erwerbsbevölkerung verfügt und viele europäische Investitionen insbesondere in KMUs erhält, würde die Voraussetzungen für die Integration der Ukraine in die europäische Wirtschaft schaffen.
Zudem würden derartige Bemühungen den Grundstein für ein belastbares Entwicklungsmodell legen. Wie der Aufstieg der italienischen Region Venetien nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt hat, kann ein starker, global integrierter KMU-Sektor zu größerer Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Erschütterungen führen.
Mit dem Wiederaufbau des ukrainischen verarbeitenden Gewerbes jetzt (und nicht erst nach Kriegsende) zu beginnen würde sowohl die Fähigkeit des Landes steigern, der russischen Aggression zu widerstehen, als auch die wirtschaftliche Erholung des Landes und seine Integration in die EU unterstützen. Der erste Schritt besteht darin, dafür zu sorgen, dass die Ukrainer, die derzeit in der EU Zuflucht suchen, die Mittel und Anreize erhalten, die sie zur Rückkehr in ihre Heimat benötigen.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Copyright: Project Syndicate, 2024.