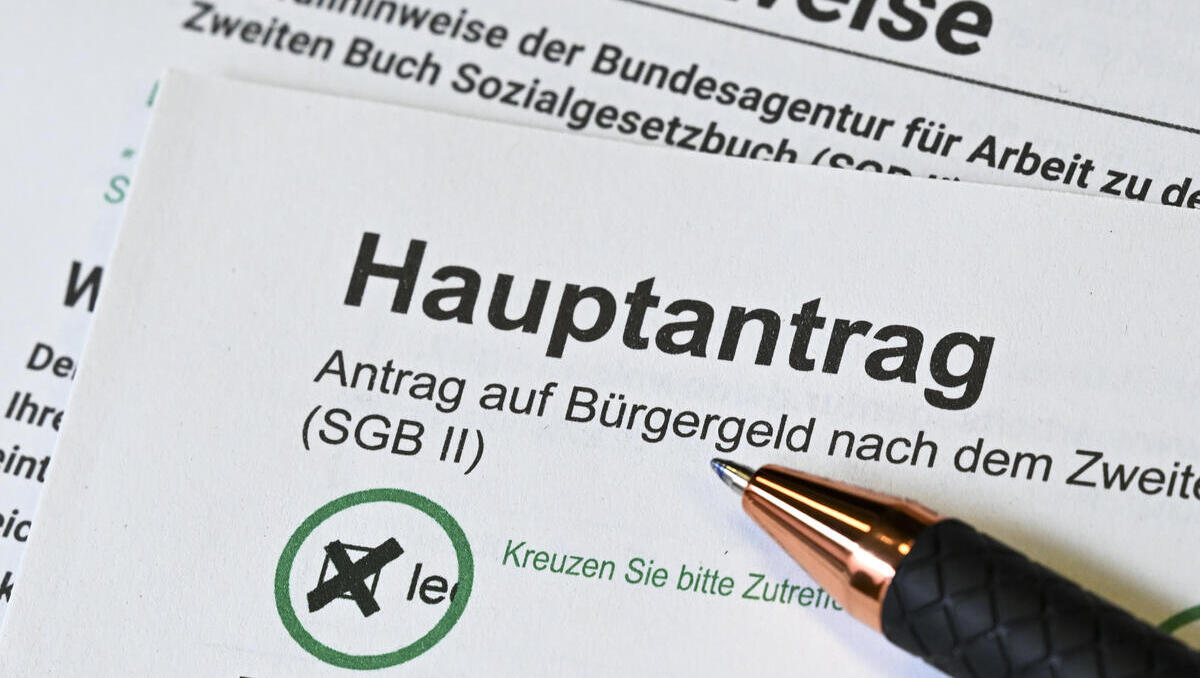DWN: Was ist Biokohle? Wofür lässt sie sich nutzen?
Alfons Kuhles: Biokohle ist grundsätzlich Kohle, die nicht fossilen Ursprungs ist, also nicht aus der Erde kommt, sondern von Menschen gemacht wurde und hat zunächst zwei Unterformen: Hydrokohle und Pyrokohle.
Hydrokohle ist mit genau dem gleichen Verfahren - der Hydrothermalen Karbonisierung (HTC) - unter Druck und Temperatur aus Biomasse entstanden, wie die fossile Kohle auch, allerdings nicht in Millionen von Jahren, sondern in wenigen Stunden. Pyrokohle hingegen wird durch ein von Menschen erfundenes Verfahren - die Pyrolyse - aus vorzugsweise Stammholz hergestellt. Diese Biokohle kann dann genauso genutzt werden, wie die fossile Kohle auch. Da aber nicht historische, also fossile Quellen genutzt werden, sondern mehr oder weniger frische Biomasse, ist die Kohle somit hin CO2-neutral, daher der Name Biokohle.
DWN: Können Sie den Prozess einer hydrothermalen Karbonisierung etwas näher beschreiben?
Alfons Kuhles: Bei ca. 200°C heißem Wasser und einem Druck von ca. 20 bar wird jegliche Form von Pflanzenmasse von ganz allein zu Kohle - und das schon seit Millionen von Jahren in unserer Erde. Wenn man nun stattdessen diesen Druck- und Temperaturzustand einmal anlagentechnisch herstellt, hält sich der Prozess überwiegend selbst in Gang und so kann man kontinuierlich frische Biomasse zu nachhaltigem Torf oder Kohle herstellen.
DWN: Worin unterscheidet sich HTC von einem Pyrolyseverfahren?
Alfons Kuhles: Es handelt sich hier um zwei Verfahren, die beide aus Biomasse Kohle herstellen, die aber vollkommen unterschiedlich sind: HTC ist in Wasser unter Druck und Temperatur mit jeder noch so nassen Biomasse möglich, während die Pyrolyse, ein thermochemischer Vergasungsprozess, bei dem Biomasse ohne Sauerstoffzufuhr bei hohen Temperaturen von 400-900°C zersetzt wird, drucklos abläuft und zwingend absolut trockene Biomasse für den Prozess braucht. Da Biomasse zu Beginn aber immer nass ist, muss sie vor der Pyrolyse meist mit Abwärme getrocknet werden.
DWN: Lassen sich neben verschiedenen Kohlearten auch andere Stoffe über HTC erzeugen und nutzen?
Alfons Kuhles: Tatsächlich kann man je nach Prozessdauer die gesamte Bandbreite von Torf bis Steinkohle in einer Anlage herstellen und aus dem anfallenden Wasser kann man Düngemittel produzieren, nämlich aus den Nährstoffen, die die Pflanzen zuvor für ihr Wachstum aus dem Boden geholt hatten. Des Weiteren können auch Zwischenprodukte im Verlauf des Prozesses abgetrennt oder extrahiert werden, wie z.B. das 5-Hydroxy-Methylfufural (5 HMF), ein sehr teurer Grundstoff für die chemische Industrie.
DWN: Wieviel Prozent des weltweiten Bedarfs an fossilen Energieträgern ließe sich durch Biokohle maximal decken, ohne die Öko-systeme zu belasten und die Lebensmittelversorgung einzuschränken?
Alfons Kuhles: Da der HTC-Prozess jede Form von (Abfall-) Biomassen verarbeiten kann, ist es möglich, mit ca. 5 % der auf der Erde wachsenden Pflanzenmasse, mittels HTC den gesamten Energiebedarf der Menschheit zu decken!
DWN: Das klingt äußerst beeindruckend. Auf welcher Grundlage basieren diese Zahlen? Können Sie nähere Quellen oder Studien nennen, die diese Potenzialabschätzung untermauern?
Alfons Kuhles: Schon vor knapp 20 Jahren hatte Prof. Markus Antonietti (Leiter des MPI (=Max-Planck-Institut, A. d. R.) in Potsdam-Golm) dieses Verfahren, für dessen Entdeckung Friedrich Bergius 1931 den Chemie-Nobelpreis bekommen hatte, wieder entdeckt und mit seinen Kollegen vom Fraunhofer Institut nebenan solche Berechnungen angestellt. Damals waren die Sorgen um den Klimawandel aber noch nicht so weit verbreitet und außerdem steht HTC in direkter Konkurrenz zur fossilen Energieherstellung und die darin weltweit operierenden Unternehmen haben wenig Interesse daran, dass sich hier etwas ändert.
DWN: Erscheint es vor diesem Hintergrund sinnvoll, beispielsweise Erdgas weiter zu nutzen?
Alfons Kuhles: Was das Gas anbelangt, so wäre die Herstellung von Gas aus Kohle, wie sie etwa im Fischer-Tropsch-Verfahren (einem Verfahren, mit dem Kohle in Gas umgewandelt wird und dieses bei Bedarf anschließend zu synthetischen Kraftstoffen weiterverarbeitet werden kann, A. d. R.) geschieht, zwar möglich, aber äußerst ineffizient und energieintensiv und zudem technisch komplex. Im Vergleich dazu ist die Nutzung des bereits vorhandenen Erdgases deutlich ressourcenschonender. Solange Erdgas verfügbar ist, stellt es eine pragmatische Brücke dar, bis die Technologien und Infrastruktur für eine vollständig nachhaltige Energieversorgung ausgereift sind.
DWN: Angenommen, es herrschte Frieden in Europa: Wäre dann eine Energiepartnerschaft mit Russland in Kombination mit einer verstärkten Nutzung von Biokohle nicht ideal für die deutsche Industrie?
Alfons Kuhles: Seit vielen Jahren plädiere ich für eine enge Kooperation in Europa mit billigem Gas aus Russland (was dort gebietsweise einfach so aus der Erde in die Atmosphäre entweicht) und zukunftsweisender Technik aus Deutschland mit einer entmilitarisierten Zone von Moskau bis Brüssel.
Dies ist aber nicht im Interesse der USA und leider ist es nun auch ganz anders gekommen.
DWN: Wie würde es sich auf den CO2-Anteil in der Luft auswirken, sollten wir fossile Kohle durch Biokohle vollständig ersetzen?
Alfons Kuhles: Zunächst einmal: Ich halte die Hysterie in Sachen Nutzung von Öl und Gas für völlig unnötig, wenn wir im Gegenzug nur genug Fotosynthese ermöglichten, statt unsere grüne Lunge der Erde - den Regenwald - immer weiter abzuholzen. Aber solange Umweltzerstörung nicht bestraft und Umweltherstellung nicht gefördert wird, lässt sich an dieser menschlichen Dummheit wohl wenig ändern...
Dies vorausgeschickt, folgendes: Wenn wir die Biokohle energetisch nutzen, wird das CO2 wieder freigesetzt, welches die Pflanzen kurz zuvor durch die Fotosynthese aus der Luft geholt haben – es handelt sich also um einen CO2-neutralen Kreislauf. Damit ist aber noch kein CO2 aus der Luft geholt. Hierfür wird die Biokohle dann nicht energetisch verwertet, sondern mit Sand gemischt und das Gemisch sodann mit effektiven Mikroorganismen (EM) angereichert. Damit kann aus Wüsten fruchtbarer Boden werden, auf dem dann wieder Fotosynthese stattfindet. Das Einbringen von Biokohle in den Boden - also die Fruchtbarmachung - ist dann die eigentliche CO2 Senke, die über die CO2-Zertifikate dann wirtschaftlich wird.
DWN: Zwischen Afrika und der Karibik ist offensichtlich ein riesiger Braunalgenteppich entstanden - der Great Atlantic Sargassum Belt. Stimmt es, dass sich diese Algen zur Herstellung von Biokohle nutzen ließen? Wie würde das konkret ablaufen? Und wie würde die Biokohle zu den Industriestandorten, an denen sie benötigt wird, gelangen? Wäre dies ökonomisch und ökologisch sinnvoll?
Alfons Kuhles: Dieser Algenteppich erzeugt riesige Probleme an den Stränden, aber auch auf hoher See und würde dann von uns mit Förderbändern an Bord geholt und dort an Ort und Stelle karbonisiert. Die Endprodukte (Kohle + Düngemittel) würden dann mit Schiffen an Land transportiert. Dies wäre ökonomisch und ökologisch äußerst sinnvoll, jedoch erfordert das zunächst erhebliche Investitionen und Vorleistungen, die die Weltgemeinschaft offenbar bislang noch nicht bereit ist, aufzubringen. Außerdem ist die sehr viel CO2 ausstoßende Herstellung von Düngemitteln aus Öl und durch Luftzerlegung nicht besteuert, also diese umweltschädliche Herstellung noch viel zu billig!
DWN: Was würde in dem Fall mit dem Plastik passieren, das ja ebenfalls in großen Mengen auf den Ozeanen treibt?
Alfons Kuhles: Für Plastikabfälle haben wir das PTC-Verfahren, das diese Abfälle kocht und aus den Gasen (=> Pyrolyse) sodann u.a. Diesel kondensiert, womit dann die Schiffe angetrieben werden können.
DWN: Wäre die Ernte dieser Algen außerhalb der 12-Meilen Zonen für jedermann möglich?
Alfons Kuhles: In der Tat wäre das durchaus möglich, zumal das für alle Beteiligten eine Win-win-Situation ist, da dieser Algenteppich nur Probleme macht, ebenso wie auch die Plastikinseln in den Ozeanen.
DWN: Hätte die Ernte dieser Algen auch einen ökologischen Nutzen?
Alfons Kuhles: Nun, die Natur braucht den Menschen nicht. Aber wir leben von der Natur und damit meine ich, dass es schon reichen würde, wenn wir die Hand, die uns füttert nicht dauernd weiter zerstören würden! Bestes Beispiel hierfür ist der größte Binnensee der Welt, der Viktoriasee in Afrika: Durch menschliche Abwässer werden immer mehr Nährstoffe in den See geleitet, was dort das Wachstum der Wasserhyazinthe (Eichhornia) erheblich fördert. Unter dem Pflanzenteppich sinkt der Sauerstoffgehalt des Wassers erheblich, was den Fischen zu schaffen macht. Von diesen Fischen leben aber die Menschen in den Staaten rund um den See. Wir könnten auch hier helfen, diese Pflanzen zu karbonisieren und damit den See wieder frei zu legen, aber die Anrainerstaaten haben das Geld nicht, eine solche Technik in Auftrag zu geben. Dafür ist eigentlich mal die Weltbank gegründet worden.
Mit den Braunalgen im Great Atlantic Sargassum Belt verhält es sich genauso: sicherlich hätte hier eine Ernte auch einen ökologischen Nutzen, jedoch ist der globale menschliche Nutzen ungleich höher! Aber eben nur der globale und nicht der individuelle Nutzen…
Info zur Person: Alfons Kuhles ist Geschäftsführer der GRENOL-Gruppe und als solcher auch Vorsitzender des Bundesverbandes der Hydrothermalen Karbonisierung e.V.