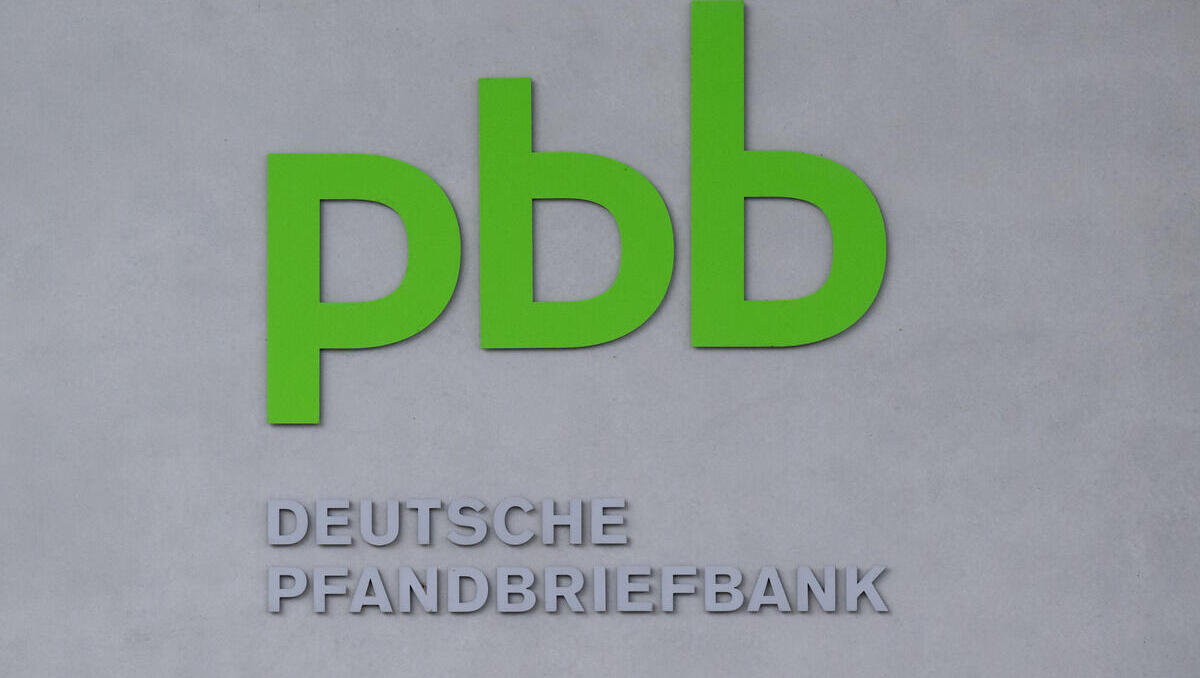Atomkraft: Deutschland geht den Sonderweg - oder doch nicht?
Alle machen es – nur Deutschland stolpert weiter einfältig seinen Sonderweg des Atomausstiegs entlang, importiert dabei für wahnsinnig viel Geld fossile Energien und wird aufgrund seiner hohen Energiekosten wirtschaftlich von den anderen Nationen überholt. Das zumindest postulieren viele. Doch stimmt das? Atomenergie erlebt aktuell laut der Internationalen Energie Agentur (IEA) ein beispielloses Comeback. Nie interessierten sich mehr Länder für den Einstieg, den Ausbau und die Forschung.
Insgesamt werde die Atomstromproduktion 2025 einen Umfang von rund 2.900 Terawattstunden erreichen, prognostiziert die IEA. Dies bedeute einen Anteil von knapp zehn Prozent an der gesamten Stromproduktion. Im Jahr 2023 hatten Atommeiler der Energieagentur zufolge noch 2.742 Terawattstunden erzeugt und 2024 nach vorläufigen Zahlen 2.843. In diesem Jahr werde die Produktion von Atomstrom "die höchste in der Geschichte sein", sagte IEA-Chef Fatih Birol. "Wir treten in eine neue Ära der Kernenergie ein."
Weltweit seien Reaktoren mit Kapazitäten in Höhe von 70 Gigawatt im Bau. Das Interesse an Atomkraft sei so groß wie seit der Ölkrise in den 1970er-Jahren nicht mehr. Über 40 Länder strebten nach einem Ausbau der Kernenergie, teilte die IEA mit. Zum Anstieg des Elektrizitätsbedarfs komme es nicht nur in klassischen Sektoren wie der Industrie, sondern auch in neuen Bereichen wie Elektroautos, Datenzentren und der Nutzung Künstlicher Intelligenz, die allesamt erhebliche Mengen an Strom benötigen.
2025 - Rekordjahr der Kernenergie?
Nachdem sich die Atomkraft nach dem GAU 2011 im japanischen Reaktorkomplex Fukushima international noch auf dem Rückzug befunden hatte, wird die aktuelle Entwicklung insbesondere von China angeführt. Von den 52 Reaktoren, mit deren Bau seit 2017 weltweit begonnen wurde, sind 25 chinesische Konstruktionen.
"Die globale Geografie der Atomindustrie ändert sich", so IEA-Chef Birol. Seit 1970 sei die globale Atomindustrie von den USA und Europa dominiert worden. In Europa stammten in den 1990er-Jahren noch 35 Prozent des Stroms aus Atomkraft. Derzeit sind es weniger als 25 Prozent und in zehn Jahren wird ein Rückgang auf weniger als 15 Prozent erwartet. In den USA ist die Lage ähnlich.
Doch Japan nehme die Produktion wieder auf, in Frankreich seien die Wartungsarbeiten an AKW abgeschlossen und neue Reaktoren unter anderem in China, Indien und Europa gingen in Betrieb. Der Ausbau der Kernkraft stütze sich allerdings stark auf chinesische und russische Technik und Ressourcen wie Uran, was das Risiko künftiger Abhängigkeiten beinhalte, führt die IEA weiter aus: „Unseren jüngsten Prognosen zufolge wird die Stromerzeugung aus der weltweiten Flotte von fast 420 aktiven Kernreaktoren im Jahr 2025 einen Rekordwert erreichen.“
Atomkraftwerke entstehen vor allem in China
Im Moment ist laut IEA das Wachstum jedoch unausgeglichen. Kostenüberschreitungen und Bauverzögerungen belasten die langjährigen Marktführer in Europa und Nordamerika permanent. Die Hälfte der derzeit im Bau befindlichen Projekte befindet sich in China, das auf dem besten Weg ist, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union bis 2030 bei der installierten Kernkraftkapazität zu überholen. Die Vielfalt der Lieferkette stellt ein weiteres Problem dar. Von den 52 Reaktoren, die seit 2017 weltweit in Bau gegangen sind, stammen 25 aus China und 23 aus Russland.
Nur wenige Länder haben bereits Standorte für Atommüll-Endlager gefunden. Konkrete Planungen zum Bau oder zur Erweiterung bestehender Endlager laufen laut IEA in Kanada, Schweden, Finnland, Frankreich und der Schweiz. Aufgrund der wenigen Erfahrungen mit dem Rückbau von ausgedienten Meilern gestaltet es sich zudem schwierig, die voraussichtlichen Kosten für die Stilllegung von Anlagen vorherzusehen. Die IEA geht davon aus, dass dafür 15 Prozent der Gesamtinvestition für ein AKW nötig sind.
Kernkraft-Kritik in Deutschland
Die Internationale Energieagentur wurde Mitte der 1970er-Jahre von 16 Industrienationen gegründet - als Reaktion auf die damalige Ölkrise. Die IEA gilt traditionell als eher atomfreundlich. Die Einschätzungen der IAEA stehen in Kontrast zu den derzeit in Deutschland vorherrschenden Positionen zum Atomausstieg. Wie der "Spiegel" in einer ausführlichen Reportage schreibt, sehen deutsche Politiker und Energieversorger wie RWE, EnBW und E.ON momentan wenig Perspektiven für eine Reaktivierung der letzten abgeschalteten Meiler. Der geforderte Zeitrahmen und die Investitionskosten werden als unrealistisch eingeschätzt.
Allerdings gibt es auch unter deutschen Politikern wie Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz zunehmend Stimmen, die den Atomausstieg als Fehler bezeichnen. Eine Umfrage zeigt, dass 67 Prozent der Deutschen die Nutzung von Atomkraft unterstützen würden. 42 Prozent sprächen sich sogar für den Bau neuer Reaktoren aus, so das Ergebnis einer Umfrage der US-Beratungsfirma Radiant Energy Group.
Atomenergie: Was wird unter den Teppich gekehrt?
Was die IEA postuliert, klingt für Freunde der Atomkraft erstmal toll. Allerdings steckt der Teufel dabei nicht im Detail, sondern unter dem Teppich. Denn unter denselbigen werden einige wesentliche Fakten gekehrt. Zudem handelt es sich auch stark um Prognosen, also mögliche Zukunftsszenarien.
- Geopolitische Abhängigkeiten von Russland: Rosatom ist am Bau vieler Atomkraftwerke beteiligt, Uran kommt zu großen Teilen von Russland und seinen Verbündeten.
- Klimawandel und Kühlung: Zwar sind neue Reaktorkühlungssysteme – etwa mit Salz – in der Forschung (die sogenannte IV. Generation), aber noch werden die Reaktoren durch verschiedene Systeme und Kreisläufe mit Wasser gekühlt. Wenn dann zum Beispiel Flüsse im Sommer Tiefstand haben, müssen die Reaktoren heruntergeregelt werden, weil bei bestimmten Reaktoren und Kühlsystemen beispielsweise Wasser für die Kühlung fehlt, oder aber die Temperatur des abgeleiteten Kühlwassers den Fluss zu heiß macht. In Frankreich wurden deshalb bereits die Grenzwerte für Kühlwasser gelockert.
- Viele der Technologien, die die IEA nennt, wie etwa die Kernfusion, Dual-Fluid-Reaktoren sowie SMR, also kleine, modulare Reaktoren, sind noch nicht einsatzfähig. Es ist sogar fraglich, ob sie jemals funktionieren werden.
- Viele Reaktoren werden abgeschaltet: Ja, es werden neue Reaktoren gebaut – aber es werden auch viele vom Netz genommen. Laut Statista werden bis zum Jahr 2030 in Europa 165 Atomkraftwerke zurückgebaut. Weltweit werden 297 Kernkraftwerke bis zum Jahr 2030 in den Rückbau gehen.
Keine privaten Investoren aufgrund zu hoher Risiken und Kosten
Laut IEA entscheidend im Hinblick auf den zukünftigen Ausbau der Kernenergie ist aber auch die Finanzierung. Traditionell wurde die Kernkraftentwicklung in der Vergangenheit vor allem von staatlichen Geldern getragen. Doch für einen schnellen Ausbau sind laut der IEA auch private Investoren nötig. Ein schneller Ausbau bedeute, dass sich die Investitionen in Kernkraft bis 2030 weltweit auf rund 117 Milliarden Euro verdoppeln müssten. Die allerdings scheuen das Risiko. GAU und Super-GAU lassen sich nicht adäquat versichern. Dass es für den Bau von Atomkraftwerken mit dem hohen Risiko keine privaten Investoren gibt, sollte eigentlich CDU/CSU und FDP aufhorchen lassen. Atomkraft rechnet sich nach wie vor nicht wirklich und für private Unternehmen nur mit massiven staatlichen Subventionen, die Staaten vor allem dann leisten, wenn sie Atommacht sind oder sein möchten und dafür genügend Know-How, Technik, Material und Personal brauchen.
Erneuerbare Energie spielen eine wesentlich größere Rolle
Zudem kann man bei den Zahlen der IEA leicht vergessen, wie sehr erneuerbare Energien wuchsen – und Kernenergie dabei massiv in den Schatten stellen.
Im World Industry Status Report 2024 (WISR) finden sich weitere spannende Fakten zum Thema. Dieser Bericht unter anderem gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Dahinter stehen steht ein Forscherteam aus verschiedenen Ländern und Hintergründen. Ins Leben gerufen hat den WISR der Kernergie-Skeptiker Mycle Schneider.
Einige erhellende Erkenntnisse des Reports von 2024
- Im Jahr 2023 wurden weltweit 5 neue Kernreaktoren (5 GW) in Betrieb genommen und 5 stillgelegt (6 GW), was einen Netto-Rückgang um 1 GW bedeutet.
- Die weltweite Atomstromerzeugung stieg gegenüber dem Vorjahr leicht um 2,2 Prozent, blieb aber unter den Werten für 2021 und 2019.
- Der Anteil der Kernenergie an der weltweiten kommerziellen Bruttostromerzeugung sank von 9,2 Prozent auf 9,1 Prozent, das ist nur noch etwas mehr als die Hälfte des Spitzenwerts von 17,5 Prozent im Jahr 1996.
- Mitte 2024 waren weltweit 408 Reaktoren mit 367 GW in Betrieb, einer mehr als ein Jahr zuvor, aber 30 unter dem Höchststand von 2002 – 34 Blöcke befanden sich in Langzeitstillstand.
- Zwischen 2004 und 2023 gab es weltweit 102 Inbetriebnahmen und 104 Schließungen von Atomkraftwerken: ein Anstieg von 49 Atomkraftwerken in China; außerhalb Chinas ein Netto-Rückgang um 51 Anlagen.
- China baute mehr als 200 GW Solarkapazität und nur 1 GW an Kernkraft; die Solarenergie produzierte insgesamt 578 TWh und überholte damit die Kernkraft um 40 Prozent. Insgesamt erzeugten in China die Erneuerbaren Energien sogar ohne Wasserkraft viermal so viel Strom wie die Atomenergie.
- Der globale Ausbau Erneuerbare Energien steigt steil an, der globale Ausbau Atomenergie dagegen schrumpft. Im Jahr 2023 wurden die Gesamtinvestitionen in Erneuerbare Energien auf einen Rekordwert von 623 Milliarden US-Dollar gesteigert, 27mal mehr als für den Bau von Kernkraftwerken ausgegeben wurde. Solarenergie und Windkraft stiegen um 73 Prozent bzw. 51 Prozent, was zu 460 GW an neuer Kapazität führte gegenüber einem Rückgang von 1 GW bei der Kernkraftkapazität. Globale Wind- und Solaranlagen erzeugten 50 Prozent mehr Strom als die Kernkraft.
- In der Europäischen Union erreichte der Anteil der Erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung 44 Prozent. Solar- und Windkraftanlagen produzierten zusammen 721 TWh, fast ein Viertel mehr als die Kernenergie mit 588 TWh. Ebenfalls zum ersten Mal erzeugten Erneuerbare Energien mehr Strom als alle fossilen Brennstoffe zusammen. Die Windkraft allein übertraf die Stromproduktion aus Erdgas. Atomkraft hatte 2024 einen Anteil von fast 24 Prozent am Strommix.
- Die Kosten für Solarenergie plus Speicherung sind in den meisten Märkten deutlich niedriger und äußerst wettbewerbsfähig mit anderen emissionsarmen Stromquellen, die heute kommerziell verfügbar sind.
Geopolitische Abhängigkeiten
Im WISR-Bericht heißt es: "Russland spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Brennstoffdienstleistungen, die den Uranabbau, die Umwandlung und die Herstellung von Brennelementen für Druckwasserreaktoren sowjetischer Bauart (WWER) umfassen, von denen es 19 in der EU und 15 in der Ukraine gibt. Die internationalen Sanktionen haben sich kaum auf das Geschäft ausgewirkt. Im Gegenteil: Der Anteil der russischen Lieferungen von Natururan, Konversions- und Anreicherungsdienstleistungen an die EU ist zwischen dem Vorkriegsjahr 2021 und 2023 gestiegen; die Importe von WWER-Brennstoff haben sich verdoppelt."
Wichtige nationale Entwicklungen im Jahr 2023
In der Europäischen Union (EU) werden in 12 der 27 Mitgliedstaaten Kernreaktoren betrieben. In den vergangenen 30 Jahren gingen gerade mal zwei Atomkraftwerke in Bau, die sogenannten Druckwasserreaktoren der dritten Generation (EPR) Olkiluoto-3 in Finnland und Flamanville-3 in Frankreich. Der finnische Reaktor ging nach 17 Jahren Bauzeit ans Netz, der französische vergangenes Jahr. Den weltweit größten prozentualen Anteil am Strommix stellt auch ohne Flamanville-3 die Kernenergie in Frankreich. 2023 waren es 65 Prozent. In den vergangenen Sommern stand allerdings teils die Hälfte der französischen AKW-Flotte still, wegen technischer Defekte, Inspektionen, Reparaturen, oder weil die Flüsse nicht genug Wasser zur Kühlung der Reaktoren führten.
- Polen startet offiziell ein Atomprogramm, um den Kohleausstieg zu bewerkstelligen. 2033 soll der erste Meiler ans Netz gehen, laut Experten ein unrealistischer Zeitplan.
- In Ungarn sollen zwei zusätzliche Reaktorblöcke russischer Bauart entstehen, und Rumänien plant ein Mini-AKW mithilfe von US-Technik.
- Schweden betreibt Reaktoren, die gemeinsam etwa 30 Prozent der landesweiten Stromerzeugung abdecken.
- In der Türkei wird seit 2015 das erste AKW namens Akkuyu gebaut – finanziert und errichtet vom russischen Staatsunternehmen Rosatom.
- Auch Großbritannien setzt nach wie vor auf Atomkraft. Aktuell werden noch neun Reaktorblöcke betrieben, 36 befinden sich im Rückbau. Aktuell sind zwei neue EPR-Reaktoren im Bau (Hinkley Point C-1 und -2), zwei weitere sind für den Standort Sizewell C geplant.
- In Japan wurden zwei weitere Reaktoren in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 wieder in Betrieb genommen, sodass insgesamt zwölf Reaktorblöcke in Betrieb sind, während 21 Reaktoren weiterhin im Langzeitstillstand sind. Die Stromerzeugung aus Kernenergie stieg um 49 Prozent, aber der Anteil der Kernenergie am Gesamtstrom sank erneut von 6,1 Prozent auf 5,6 Prozent.
Den Ausstieg aus der Kernenergie geplant haben – neben Belgien – derzeit die Schweiz und Spanien: Die vier Reaktoren in der Schweiz (Anteil am Strommix 36,4 Prozent, Durchschnittsalter 48 Jahre) dürfen bis zu ihrem altersbedingten Ende laufen, aber nicht durch neue ersetzt werden. Ein Datum für die Abschaltung gibt es nicht. Die sieben spanischen Reaktoren sollen bis 2035 sukzessive vom Netz genommen werden, die erste Abschaltung ist für 2027 geplant. Belgien verschiebt die letzte Etappe des beschlossenen Ausstiegs, als Reaktion auf die energiepolitischen Turbulenzen infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Statt in 2025 sollen zwei der fünf verbliebenen Reaktoren erst 2035 vom Netz gehen.
Kleine modulare Reaktoren (SMR) noch in Entwicklung
Die Kluft zwischen dem Hype um SMRs und der industriellen Realität wird immer größer. Die Atomindustrie und mehrere Regierungen verdoppeln ihre finanziellen und politischen Investitionen in SMR. Bisher spiegelt die Realität vor Ort diese Bemühungen nicht wider: Es gibt keine Konstruktionszertifizierungen, keine Bauten im Westen, und SMR-Projekte werden weiterhin verzögert oder gestrichen.
Atomkraftwerke laufen in 32 Staaten
Laut WISR waren Mitte 2024 weltweit 408 Reaktoren mit 367 GW in Betrieb, einer mehr als ein Jahr zuvor, aber 30 Reaktoren weniger als zum Höchststand im Jahr 2002. 34 Kernkraftwerke befanden sich in einem Langzeit-Stillstand. Spitzenreiter sind die USA mit 94 Reaktoren, gefolgt von China und Frankreich, beide mit 56 Blöcken. Im vorderen Feld finden sich zudem Russland (36), Japan (12), Südkorea (25) und Indien (20).
2023 gingen weltweit insgesamt fünf neue Reaktorblöcke ans Netz. Fünf Reaktoren wurden 2023 stillgelegt, darunter die letzten deutschen Anlagen Emsland, Isar-2 und Neckarwestheim-2. Das Leistungssaldo der fünf abgestellten und fünf neuen AKW ist um ein Gigawatt negativ.
China nutzt Atomenergie, um Kohle zu ersetzen - setzt aber langfristig auf erneuerbare Energien
In den letzten 20 Jahren, zwischen 2004 und 2023, sind mehr AKW stillgelegt worden, als neue in Betrieb genommen wurden. Außerdem sind fast die Hälfte der neuen Reaktoren – 49 von 102 – in China ans Netz gegangen. Außerhalb Chinas ergibt das einen Negativsaldo von 51 Blöcken, ein erheblicher Einbruch. In den letzten vier Jahren, von 2020 bis 2023, sind 31 Reaktoren weltweit in Bau gegangen, darunter 20 in China und 11 von der russischen Atomindustrie vor allem in Drittländern vorgenommen – zum Beispiel in Bangladesch, Indien und der Türkei.
"Die einzige Form der Stromerzeugung, die zurzeit einen Siegeszug hinlegt, sind die Erneuerbaren", betonte der Technik- und Wirtschaftsjournalist Christian Stöcker neulich im SWR. Atomkraft sei in aller Regel nicht rentabel - das FDP-Wahlvorhaben, sich für subventionsfreie Atomkraft einzusetzen, habe den Wahrheitsgehalt "von Feenstaub".
Das einzige Land, das tatsächlich Atomkraftwerke im großen Stil baue, sei China. Die wenigen neuen AKW in Europa machten vor allem durch die explodierten Baukosten von sich reden. Dazu komme die weiter ungelöste Endlager-Frage. Stöcker weiter: „Was China vor allem ausbaut, und zwar in viel, viel größerem Ausmaß als die Atomkraft, sind erneuerbare Energien. China wird dieses Jahr vermutlich mehr erneuerbare Energien zubauen als der ganze Rest der Welt. Das ist der eigentlich gigantische Boom und mit den Atomkraftwerken wollen sie vor allem mittelfristig die Kohlekraftwerke ersetzen.“