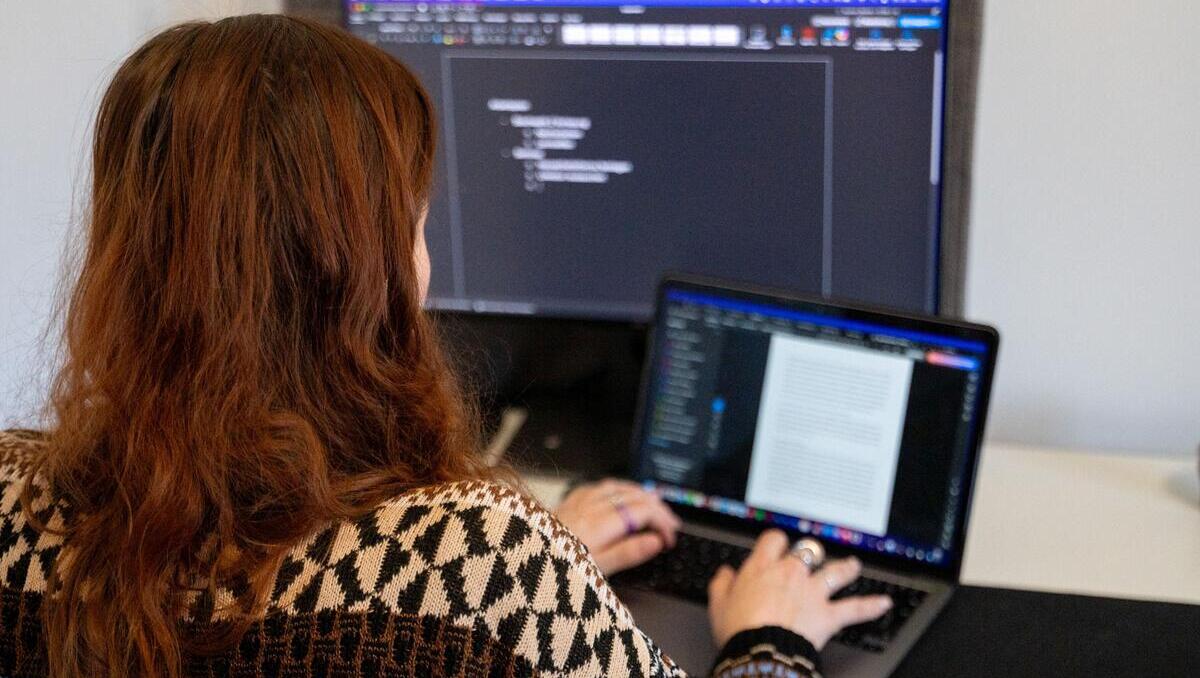Wie Spezialisten des THW in New Orleans nach Hurrikan Katrina die USA aus der Patsche holten
Es passiert eher selten, dass die USA als Weltmacht so ratlos sind, dass sie sogar auf Nothilfe aus dem Ausland zurückgreifen. Anno 2005 passierte es erstmals, als das Technische Hilfswerk zu einem Einsatz in die USA entsandt wurde. Hurricane Katrina hatte damals gut 80 Prozent der Großstadt New Orleans mit Wasser aus dem Golf von Mexiko überflutet und die Geburtsstadt des Jazz fast vollständig verwüstet. Kanzler Gerhard Schröder (SPD) bot den Amerikanern Hilfe an. Über die US-Airbase Ramstein 40 THW-Helfer samt ihrer gesamten Technik in einer 4 C17 Globemaster eingeflogen. Im Sommer jährt sich die Hilfsaktion zum 20. Mal.
Das Angebot des Bundeskanzlers umfasste die Luft-Evakuierung samt fliegenden Bundeswehrkrankenhaus, die Bergung von Opfern, Notverpflegung und truppenmedizinische Unterstützung sowie die Hilfe mit Impfstoffen, Medikamenten und Wasseraufbereitung. George W. Bushs (damals erst frisch in Berlin akkreditierter) US-Botschafter William Timken nahm die Hilfe dankend an. Vor allem das THW hat bei diesem Einsatz ordentlich Eindruck hinterlassen und die Amerikaner mit ihrer Schnelligkeit und dem technischen Knowhow überrascht. Die THW-Helfer brachten Spezial-Equipment zum Abpumpen des Wassers ins Land und errichteten eine Aufbereitungsanlage für Frischwasser.
Deshalb wurden 2011 erstmals sogar THW-Helfer zur jährlichen traditionellen Steuben-Parade durch Manhattan in den Big Apple eingeladen – als Dankeschön für deren Verdienste. Das THW stellte eine Gruppe aus 50 Teilnehmern, die aus bundesweit 25 Ortsverbänden mit anreisten. Begleitet wurden diese vom 70 Mitglieder starken THW-Musikzug aus Hermeskeil. Die Steuben-Parade in New York findet jedes Jahr am dritten Samstag im September statt und erinnert an Friedrich Wilhelm von Steuben (1730-1794), einst preußischer Offizier und dann US-amerikanischer General, der die Kontinentalarmee im Unabhängigkeitskrieg angeführt hatte. Die Veranstaltung feiert deutsche Kultur und ehrt Erfolge deutschsprachiger Einwanderer in den USA. Die „Helden in Blau“ haben ihre Visitenkarte hinterlassen, falls es mal wieder pressiert.
Warum das THW weltweit einmalig ist – selbst im Kriegsfall den Schutz der Genfer Konvention genießt
So was kommt von so was, könnte man stolz sagen. Das THW ist längst zum Aushängeschild der Deutschen in aller Welt avanciert. Wenn mal wieder Not am Mann ist, rückt das THW bereitwillig und zügig aus. So auch in den Südwesten Mexikos, als im September 2017 ein schweres Erdbeben vor allem die Region Oaxaca erschütterte. Dort kann es deutschen Touristen auf der Fahrt und bei einer Polizeikontrolle noch heute passieren, dass man aus Dankbarkeit für die Hilfe von den „Federales“ mit einem silbernen Stecker der Bundespolizei ausgezeichnet und dem Gruß „Que tengas un buen viaje!“ zur Weiterfahrt aufgefordert wird.
Auch vor einem Jahr war schnelle Hilfe gefordert, unmittelbar nach den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Das THW entsandte ihre „Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland“ (SEEBA) ins Erdbebengebiet in der Türkei. „Die 50 THW-Experten der SEEBA haben in der Türkei gemeinsam mit anderen Rettungskräften zwei Frauen nach über 130 Stunden aus den Trümmern befreit. Ihre schnelle Reaktion und ihr unermüdlicher Einsatz haben dazu beigetragen, Leben zu retten und Hoffnung zu schenken“, sagt THW-Präsidentin Sabine Lackner. Weiter unterstützte das THW mit gut 650 Tonnen Hilfsgütern die betroffenen Gebiete. Die Bilder in den Medien sind noch präsent.
Wie der Pionier Ernst Lummitzsch das Technische Hilfswerk nach dem Krieg neu aufstellte
Das Technische Hilfswerk (THW) ist in seiner Struktur weltweit einmalig, denn 98 Prozent der Angehörigen engagieren sich ehrenamtlich, rund zwei Prozent sind hauptamtlich Beschäftigte. Das Technische Hilfswerk gibt es seit dem 22. August 1950. An diesem Tag vereinbarte der damalige Bundesinnenminister (und spätere Bundespräsident der SPD) Gustav Heinemann mit bereits im Kaiserreich als Pionieroffizier tätigen Otto Lummitzsch (1886-1962) den Beginn der Aufstellung eines zivilen Ordnungsdienstes. Der gebürtige Leipziger hatte schon 1919 die Technische Abteilung (TA), die aus ehemaligen Angehörigen der Kaiserlichen Marine und des Heeres sowie Freiwilligen bestand, aus der Taufe gehoben. Weil die TA und andere militärische Nothilfen aufgrund der Bestimmungen des Versailler Vertrages nicht fortbestehen durften, schuf Lummitzsch die später dem Reichsinnenministerium untergeordnete zivile Technische Nothilfe – die nach 1945 als Blaupause beim Wiederaufbau diente.
Lummitzsch wurde betraut, weil er 1934 von den Nazis (wegen seiner jüdischen Ehefrau) aus dem Amt entfernt worden war und insofern als unverdächtig und Idealbesetzung für die junge Bundesrepublik Deutschland galt. Als Architekt und Bauingenieur überstand er den Krieg als Direktor in der Zentralverwaltung des AEG-Konzerns in Berlin. Er wusste von daher sehr genau, warum es in besonders kniffligen Situationen des Zivilschutzes immer wieder auf technisches Knowhow ankommt – weit mehr als auf militärische Werte wie Disziplin und Gehorsam. Kreativität, Einfallsreichtum und einen guten Riecher bringen die Helfer – ganz wörtlich betrachtet – regelmäßig viel weiter. Die Reparaturarbeiten nach der Sturmflut 1953 in den Niederlanden markierten den Beginn der THW-Auslandseinsätze.
Als Bundesanstalt gehört es organisatorisch zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Inneren und für Heimat. Sogar im Verteidigungsfall stehen die THW-Helfer unter besonderem Schutz der Genfer Konvention. Sie gelten als zivile Nichtkombattanten. Das heißt, sie dürfen nicht kämpfen, aber auch nicht angegriffen werden – ähnlich zu den Sanitätstruppen der Streitkräfte oder dem Roten Kreuz.
Was nur wenige überhaupt wissen: Neben den im THW-Gesetz geregelten gesetzlichen Aufgaben und der Amtshilfe kann prinzipiell jede Person oder Firma das THW anfordern, wenn sich für das THW dadurch eine Ausbildungsmöglichkeit ergibt. Es kommt dann ein privatrechtlicher Vertrag zustande, wobei der Auftraggeber Gebühren leisten muss. Erforderlich ist die Zustimmung von IHK oder Handwerkskammer, die eine Unbedenklichkeitserklärung erteilen und bestätigen müssen, dass keine Konkurrenz mit der Privatwirtschaft besteht. Schnöde Baumfällarbeiten oder Schneeräumeinsätze für Hausverwaltungen wären mithin keine Rechtfertigung für einen THW-Einsatz. Es kann aber auch ein gebührenpflichtiger Einsatz für Dritte erfolgen, wenn das THW im Rahmen der Amtshilfe an der Einsatzstelle tätig war und sich somit ein privater Bedarf an der Hilfeleistung ergibt – bei Aufräum-, Abstützungs- oder anderen Sicherungsarbeiten nach einem Brand etwa. In diesem Fall ist keine Unbedenklichkeitsbescheinigung erforderlich, sofern ein unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Zusammenhang besteht.
Was das THW alles kann und wofür bundesweit eigend Technik und Fahrzeuge vorgehalten werden
Das Technische Hilfswerk ist kompetenter Partner im deutschen Zivil- und Katastrophenschutz – vor allem wenn es um technisch aufwendige und hochspezialisierte Lösungsansätze geht oder schweres Gerät nötig ist. Egal, ob es um Sturmschäden, Überschwemmungen, Erdrutsche, Stromausfälle, Pandemien oder andere Gefahrenlagen geht – das THW ist vorbereitet und hilft Menschen bundes- und weltweit. In Kooperation mit Feuerwehr, Polizei, kommunalen Behörden, Hilfsorganisationen und vielen anderen beseitigt das THW regelmäßig die Folgen von Unfällen und Katastrophen. Dabei geht das THW nur auf Anforderung beispielsweise von Behörden und Organisationen in Einsätze.
Kaum jemand anderes steht noch heute – pars pro toto – als Galionsfigur für den THW wie deren langjähriger Chef Albrecht Broemme aus Berlin. Bereits während seines Wehrersatzdienstes mit 17 Jahren fand er in seiner alten Heimatstadt Darmstadt zu den ehrenamtlichen Pionieren. Nach einer langen Karriere bei der Berliner Feuerwehr war es deshalb nur folgerichtig, wieder genau dorthin zurückkehren und das Technische Hilfswerk zu dem zu machen, wofür es heute steht: Deutschlands freundliches Gesicht, wenn andernorts die Erde bebt, die Wälder lodern oder die Menschen vor Naturkatastrophen geschützt werden.
Das freundiche Gesicht Deutschlands: Wie Albrecht Broemme das THW in alle Welt schickte
Anno 2006 wurde Albrecht Broemme vom damaligen Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) zum Präsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk berufen. Albrecht Broemme war schon 1970 bis 1975 als ehrenamtlicher Helfer im THW-Ortsverband Darmstadt dabei und von daher bestens vernetzt und mit den Aufgaben vertraut. Ende 2019, als Broemme in den Ruhestand verabschiedet wurde, prägte er gewissermaßen als „technischer Sonderbotschafter“ die Auslandseinsätze der Bundesrepublik.
Er mischt noch heute mit, kennt keinen Ruhestand: Als Folge der Katastrophe im Ahrtal warf er etwa dem Bund vor „nicht genug für den Schutz der Zivilbevölkerung“ zu tun. Gut eine Milliarde Euro hält Broemme für erforderlich, um beispielsweise „Schutzräume und Bereitschaftskliniken zu schaffen“. Während der Corona-Krise hatte er in Berlin Impfzentren aufgebaut und leitet seither das Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit (ZOES). Über 30 Jahre habe Deutschland geschlafen und das „Thema Zivilschutz vernachlässigt“, kritisiert er. Nachdem die Bundeswehr jüngst erst eine Division des Heeres für den Heimatschutz geschaffen hat, indem Soldaten bei Bedrohungen und in Krisensituationen die Infrastruktur im Inland schützen, müsse angesichts der regelmäßig eintretenden Naturkatastrophen der Zivilschutz gestärkt werden. Das THW könnte in dieser Hinsicht sogar ein Exportschlager für andere Länder sein – sogar um den neuen US-Präsidenten vom verlässlichen Partnerland Deutschland zu überzeugen.
Bei einer Feuerwehrübung in Havelberg (Sachsen-Anhalt) sagte er einmal stolz, dass Deutschland mit Hilfe des THW „notfalls sogar im Ausland mit Panzern anrücken kann“. Zum Beispiel zum Löschen von Waldbränden, wo alte ABC-Panzer aus Bundeswehrbeständen, zu Löschpanzern umfunktioniert, mit Wasserdampf schießen könnten statt mit ihrem Kanonenrohr. Die hätte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom zum Beispiel im Januar gut gebrauchen können, als es wegen der böenartigen Santa-Ana-Winde nordöstlich von Los Angeles kaum möglich war, Löschflugzeuge aus der Luft einzusetzen und das Fire Department der Millionen-Metropole mit ihren Gummi-Reifen natürlich nicht durch die Glutnester von Pacific Palisades und dem Topanga-Canyon in Malibu fahren konnte.
Ob bei der Sturmflut in Hamburg 1962, das Grubenunglück in Lengede 1963, das Jahrhunderthochwasser 2002 an Oder und Elbe – auf die THW-Kräfte war und ist Verlass. 2021 fand der bisher größte Einsatz des THW statt. Alle 668 Ortsverbände halfen im Einsatz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal und weiteren Teilen Rheinland-Pfalz‘ und Nordrhein-Westfalens und räumten Straßen, bauten Brücken, sicherten Häuser und kümmerten sich um die Menschen vor Ort. Auch 2024 spielte das Wetter verrückt und forderte das THW bei Einsätzen in Folge der Sturmtiefs Zoltan, Katinka, Orinoco und Anett. Darüber hinaus war das THW auch bei der Absicherung von Großveranstaltungen, wie der Fußball-Europameisterschaft 2024, im Einsatz. Immer gut sichtbar in ihren blauen Outfits, um den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten. Der Bundestag bedankte sich und stockte für 2025 den Etat um zehn Millionen Euro auf, für sogenannte Selbstbewirtschaftungsmittel der Ortsverbände bundesweit, aber auch um weitere junge Leute für den Freiwilligen-Dienst der THW-Jugend zu begeistern.
Umdenken nach Flut im Ahrtal: Bürger erkennen, dass der Staat nicht alle Probleme allein löst
Die stetige Präsenz in den Medien zeigt dabei Wirkung. Der Zulauf ist enorm. Nach den verheerenden Überschwemmungen interessieren sich viele Menschen für ein Ehrenamt in der Katastrophenhilfe – besonders natürlich in Rheinland-Pfalz und in NRW. Viele der damals spontan als Fluthelfer ins Ahrtal gepilgerten Bürger haben sich im Nachhinein über das THW informiert und teilweise entschieden, dort Freizeit für die gute Sache zu investieren. So wächst gerade in Krisen das Bürgertum häufig über sich selbst hinaus und packt mit an. Eine Haltung, die eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass die Bürger nicht immer nur nach Vater Staat rufen, sondern erkennen, welche Extrakräfte im Notfall freiwillig zum Einsatz kommen. Frei nach dem Motto des US-Präsidenten John F. Kennedy, der 1961 bei seinem Amtsantritt den Mitbürgern und der Welt ins Stammbuch schrieb: „Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country!” („Frage nicht, was Dein Land für Dich tun kann – frage, was Du für dein Land tun kannst!“)
Es scheint, dass immer mehr Bürger, gerade mit solider technischer Ausbildung und ihrer handwerklichen Kompetenz erkennen, dass das THW eine überaus sinnvolle Adresse ist, um sich für das Gemeinwohl zu engagieren und auch dem eigenen Land etwas zurückzugeben. „In vielen Vereinen gibt es Nachwuchsprobleme. Beim THW sieht das allerdings anders aus“, heißt es etwa im Saarland, wo im Jahr 2023 gleich 235 neue Mitglieder aufgenommen worden sind, darunter (als klarer Trend) auch viele Frauen. Derlei positive Rückmeldungen sind überall zu verzeichnen. So etwa im sächsischen Pirna, wo die Grundausbildungsgruppe „prall gefüllt“ ist. „Mit 15 Helferanwärtern ist sie so voll, wie seit Jahren nicht mehr“, heißt es. „Durch unsere Präsenz bei Einsätzen, Amtshilfen und Veranstaltungen in den letzten Monaten, die durch Öffentlichkeitsarbeit auch immer gut nach außen getragen wurde, hat es viele neue Interessierte zu uns geführt.“