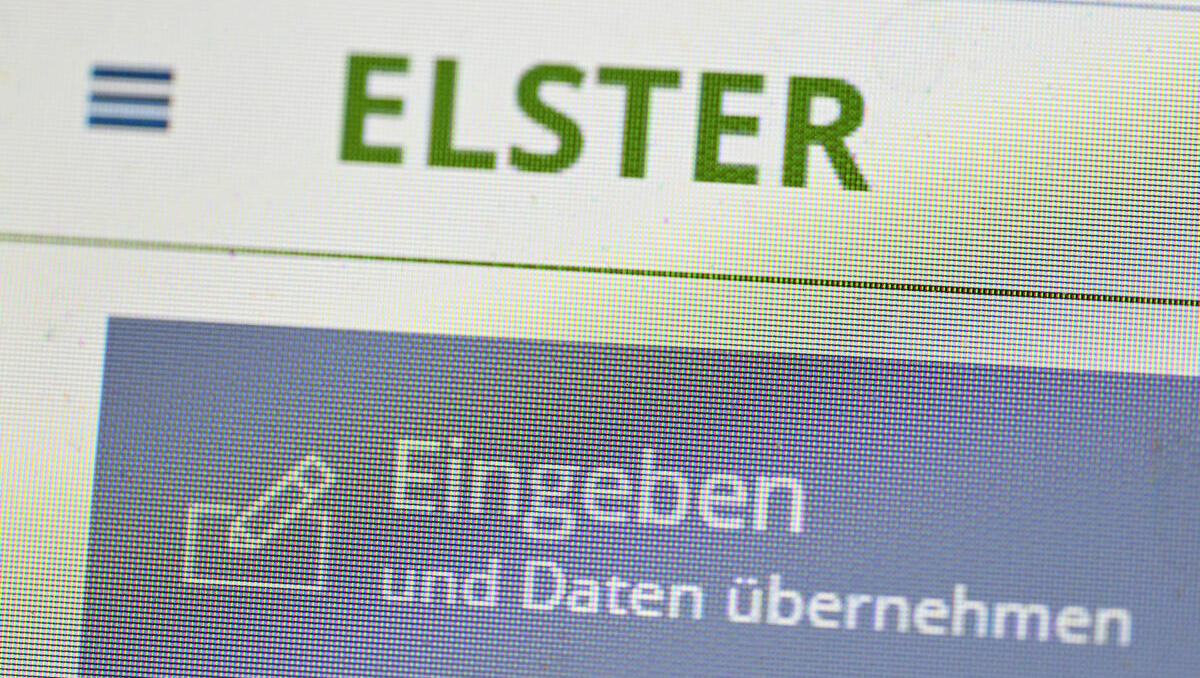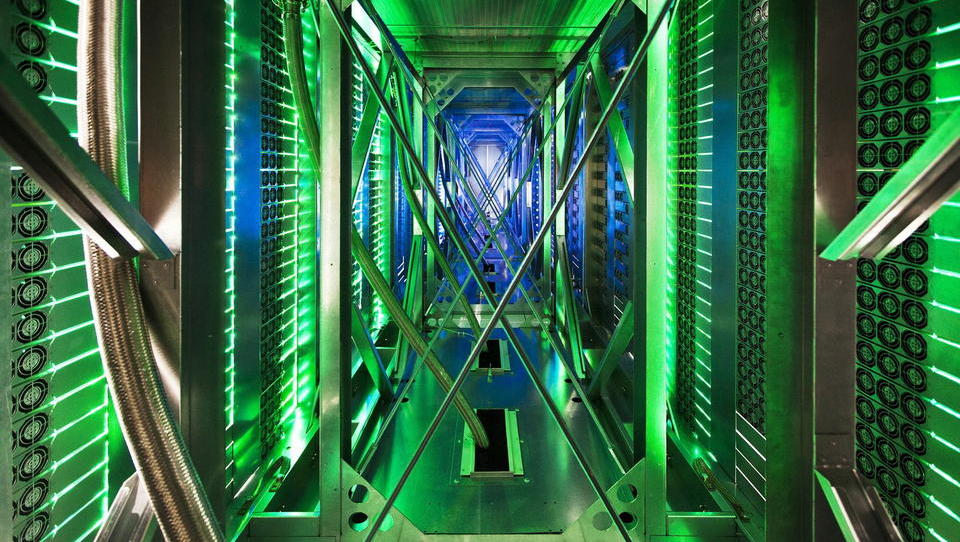ROI: Was ist das?
Eine hohe Kapitalrendite ist ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen und Investoren. Sie beschreibt letztlich, wie gut ein Unternehmen oder ein Projekt das eingesetzte Kapital nutzt, um Gewinne bzw. Erfolge zu erzielen. Die Kapitalrendite dient dabei nicht nur als Indikator für die Rentabilität von Investitionen, sondern vor allem als Maß für die Effizienz des Kapitaleinsatzes. Im weiteren Gedankengang erfüllt sie aber auch eine überaus wichtige volkswirtschaftliche Funktion: die Lenkung der Mittel und Ressourcen in die jeweils sinnvollste Verwendung, womit am Ende die Wohlfahrt oder der Nutzen der Gesellschaft erhöht wird. Das fängt bereits auf kleinster Unternehmensebene an.
Doch warum ist der Wert dieser betriebswirtschaftlichen Kennzahl so entscheidend und mit welchen Strategien können Unternehmer und Manager die Kapitalrendite steigern? Diesen Fragen wollen wir uns heute widmen, um ein besseres Verständnis für den doch sehr komplexen Prozess der Kapitalrenditegenerierung zu erlangen.
ROI Rechner: Wie Sie die Kapitalrendite berechnen
In diesem Zusammenhang ist es zunächst wichtig, den Begriff der Kapitalrendite zu verstehen. Rein betriebswirtschaftlich wird die Kennzahl dabei als Quotient aus Erfolg und eingesetztem Kapital definiert. In der Literatur findet man häufig den angelsächsischen Begriff des Return on Investment (ROI). Er setzt den in einer Periode erzielten Gewinn ins Verhältnis zum eingesetzten Kapital. Wie Sie die Kapitalrendite berechnen können? Eine einfache Berechnungsformel lautet:
ROI = (Gewinn / Investitionskosten) × 100
Investiert ein Unternehmen beispielsweise 100.000 Euro und erzielt damit einen Gewinn von 20.000 Euro, beträgt der ROI 20 Prozent. Je höher dieser Prozentsatz ist, desto effizienter wird das Kapital eingesetzt und desto attraktiver erscheint die Investition.
Mit dieser einfachen Kennzahl haben wir bereits wichtige Inputfaktoren erhalten, die Aufschluss darüber geben, wie die Kapitalrendite gesteigert werden kann – nämlich durch die Erhöhung des Gewinns oder durch eine Verringerung des Kapitaleinsatzes. Da diese beiden Größen in der Regel auch voneinander abhängen, ist das Geschick des Managements gefragt, das für eine optimale Umsetzung sorgen muss.
Wer es noch genauer wissen will, kann einen Blick auf das ebenfalls weltweit bekannte DuPont-Kennzahlenschema werfen. Es bietet eine wesentlich detailliertere Möglichkeit, den ROI zu analysieren und seine Einflussfaktoren besser zu verstehen. Dieses Schema zerlegt den ROI nochmals in verschiedene Komponenten und macht transparent, an welchen Stellschrauben Unternehmenslenker drehen können, um ihre Rentabilität zu steigern. Die Grundformel des DuPont-Schemas lautet:
ROI = (Umsatzrendite) × (Kapitalumschlag)
Die Umsatzrendite gibt dabei an, welcher Anteil des Umsatzes als Gewinn verbleibt. Sie wird berechnet, indem das Periodenergebnis durch den Umsatz dividiert wird. Eine hohe Umsatzrendite signalisiert dabei, dass ein Unternehmen effizient wirtschaftet und eine hohe Rentabilität aufweist. Auch hier gilt: je höher, desto besser. Hohe Umsatzrenditen zeugen primär von Preissetzungsmacht. Sie zeigen aber auch, dass Risikopuffer vorhanden sind: Wer nur 3 Prozent Gewinn vom Umsatz übrig hat, hat wenig Möglichkeiten, Schwankungen abzufedern und kann leichter in die Verlustzone rutschen. Anders sieht es bei 30 Prozent aus.
ROI Investing: Kosten runter, Umsatz rauf
Die Umsatzrendite zu verbessern, indem man die Kosten senkt oder die Verkaufspreise erhöht, ist meist leichter gesagt als getan. Hier kommt es auf viel mehr an: Marktposition, Wettbewerbssituation oder Marktmacht durch Patente oder Marken.
Doch schaut man zunächst auf die Kostenseite, so lässt sich die Kostenstruktur mitunter optimieren. Unternehmensentscheider sollten hier mit ihren Controllern überprüfen, ob ihre Produktions- und Betriebskosten effizient gestaltet sind. Dies kann durch den Einsatz moderner Technologien, die Optimierung von Lieferketten oder die Automatisierung von Prozessen erreicht werden. Die regelmäßige Überprüfung der Lieferantenverträge und das Aushandeln besserer Konditionen bieten ebenso Potenzial wie ein aktives Bestandsmanagement, das die Kapitalbindungskosten durch überflüssige Lagerbestände reduzieren kann. Eine Zentralisierung des Einkaufs sollte erwogen werden, um durch größere Volumina bessere Einkaufskonditionen aushandeln zu können. Aber auch durch eine Optimierung des Personalmanagements können Kosten gesenkt werden, beispielsweise durch die Einführung flexibler Arbeitszeitmodelle. Die Einführung digitaler Tools zur Automatisierung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung oder im Rechnungswesen senkt langfristig die Kosten. Kostensenkungen erhöhen tendenziell schnell den Gewinn, was sich direkt positiv auf den ROI auswirkt.
Aber auch eine Erhöhung des Umsatzes hat positiven Einfluss auf den ROI. Unternehmen sollten hier danach streben, ihre Marktanteile zu erhöhen und neue Absatzmärkte zu erschließen – gerne auch im Ausland und digital. Dies erfordert zunächst immer auch eine gezielte Marktanalyse, innovative Produktentwicklungen und effektive Marketingstrategien. Eine stärkere Personalisierung des Marketings mit Hilfe datengestützter Ansätze ermöglicht beispielsweise eine gezieltere Kundenansprache. Ebenso der Ausbau digitaler Vertriebskanäle, die einen ortsunabhängigen Verkauf rund um die Uhr ermöglichen. Nicht zu vergessen ist ein exzellenter Kundenservice, der Kunden langfristig bindet und den Umsatz durch Wiederholungskäufe und Weiterempfehlungen steigert. Die Idee dahinter ist recht simpel: Durch die Erzielung höherer Erlöse bei gleichbleibenden oder nur moderat steigenden Kosten können die Gewinne erhöht und damit die Kapitalrendite verbessert werden. In der Ökonomie spricht man auch von Skaleneffekten.
Genau hier spielen Innovationen eine zentrale Rolle. Unternehmen, die sich durch kontinuierliche Weiterentwicklungen auszeichnen, können nämlich Wettbewerbsvorteile erzielen und neue Marktpotenziale erschließen. Ein Beispiel sind Unternehmen der Technologiebranche, die durch bahnbrechende Entwicklungen neue Standards setzen und so ihre Marktposition ausbauen und nachhaltig sichern – echte Burggräben. Auch klein- und mittelständische Unternehmen wenden solche gezielten Innovationsstrategien an, um ihre Kapitalrendite zu steigern. Hidden Champions sind wahre Meister darin, im Vergleich zum Wettbewerb deutlich bessere Kapitalrenditen zu erzielen.
Kapitalumschlag erhöhen
Die Kapitalumschlagshäufigkeit hingegen beschreibt, wie effizient ein Unternehmen sein eingesetztes Kapital zur Generierung von Umsätzen nutzt. Sie errechnet sich aus dem Umsatz dividiert durch das eingesetzte Kapital. Eine hohe Kapitalumschlagshäufigkeit deutet zunächst nüchtern darauf hin, dass das Unternehmen in der Lage ist, mit relativ wenig Kapital einen hohen Umsatz zu erzielen.
Eine besondere Rolle spielt dabei das sogenannte Working Capital – also Vorräte, Forderungen und Verbindlichkeiten oder liquide Mittel. Unternehmen können ihre Kapitalumschlagshäufigkeit also verbessern, indem sie beispielsweise Lagerbestände optimieren, Produktionszeiten verkürzen, Zahlungen strecken bzw. Zahlungsziele verkürzen oder ihre Vertriebskanäle effizienter gestalten. Die Erhöhung der Produktion und des Verkaufsvolumens bei gleichbleibendem Anlagevermögen verbessert die Kapitalumschlagshäufigkeit.
Die ewige Frage nach dem nicht betriebsnotwendigen Kapital
Betrachtet man die Unternehmensebene, gewinnt die Frage nach dem nicht betriebsnotwendigen Kapital an Bedeutung. Beispiele hierfür sind überschüssige Liquiditätsreserven oder Beteiligungen an anderen Unternehmen, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Aber auch wertvolle Kunstgegenstände im Betriebsvermögen, andere Wertanlagen oder nicht betrieblich genutzte Immobilien gehören dazu.
Sie führen dazu, dass die Bilanz des Unternehmens länger und damit kapitalintensiver wird. Stehen ihnen aber keine entsprechend höheren Gewinne gegenüber, verschlechtern sie die Kennzahl des ROI. Eine relativ einfache Möglichkeit, den ROI zu erhöhen, besteht nun darin, sich von Teilen des nicht betriebsnotwendigen Vermögens zu trennen. Der Verkauf von Tafelsilber oder auch eine Asset-Light-Strategie, bei der man sich auf die Kernkompetenzen beschränkt, kann Wunder wirken. Leider können solche Strategien auch die Unabhängigkeit gefährden. Langfristig kann dies auch zu Kostensteigerungen oder zum Verlust strategischer Optionen führen. Hier gilt es abzuwägen, was strategisch sinnvoll ist.
Abhängigkeit vom Leverage-Effekt
Aber auch die Höhe der Verschuldung hat einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Kapitalrendite eines Unternehmens. Fremdkapital beeinflusst den ROI, da es das Gesamtkapital und damit den Nenner der ROI-Formel erhöht. Hier muss jedoch differenziert werden: Wird das aufgenommene Fremdkapital zu einer Rendite investiert, die über den Zinskosten liegt, wirkt der Leverage-Effekt positiv und erhöht den ROI, andernfalls sinkt er.
Allerdings steigt mit einem höheren Fremdkapitalanteil auch das finanzielle Risiko durch zusätzliche Zins- und Tilgungsverpflichtungen. Nicht zu vergessen sind der Verlust an Flexibilität und die Verschlechterung des Kreditratings. Es ist also auch hier abzuwägen, ob eine Erhöhung des ROI unter Inkaufnahme von Risiken sinnvoll erscheint.
Management in der Verantwortung
Nicht zuletzt ist – wie eingangs schon einmal angedeutet – die Qualität des Managements der entscheidende Faktor für eine hohe Kapitalrendite, denn es ist letztlich dafür verantwortlich, dass die entscheidenden Maßnahmen im Unternehmen auch umgesetzt werden. Ein kompetentes und erfahrenes Management kann Marktchancen besser erkennen und Risiken effektiver managen.
ROI: Return on Investment - warum ist eine hohe Kapitalrendite so wichtig?
Kommen wir zur zweiten Ausgangsfrage: die Bedeutung einer hohen Kapitalrendite. Für Unternehmen im freien Markt ist eine hohe Kapitalrendite von immenser Bedeutung. Sie signalisiert, dass ein Unternehmen in der Lage ist, seine Ressourcen effizient einzusetzen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das ist besonders wichtig, denn in einer Welt mit zunehmendem Kostendruck und sich dynamisch verändernden Marktbedingungen, wie sie für freie Märkte typisch sind, ist eine höhere Effizienz am Ende ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Dabei zeigt sich, dass Unternehmen mit einer hohen Kapitalrendite sich langfristig besser entwickeln, bessere Gewinne erwirtschaften, mehr Innovationen vorantreiben und sich im Wettbewerb überaus gut behaupten. Sie schaffen Arbeitsplätze, wachsen und sorgen für eine Stabilität der Region.
Letztlich geht es aber nicht nur darum, mehr zu haben oder besser zu sein als die Konkurrenz. Es geht meist darum, frisches institutionelles Kapital von außen zu bekommen. Gerade in kapitalintensiven Branchen ist dies überlebenswichtig. Günstiges Kapital ist das Zünglein an der Waage, wenn es um Wachstumsoptionen geht. Und genau hier zeigt sich, dass Unternehmen, die eine hohe Kapitalrendite erzielen, tendenziell häufiger von Investoren bevorzugt werden. Nicht grundlos: Ein hoher ROI erhöht für Anleger die Wahrscheinlichkeit, eine langfristig gute Investitionsmöglichkeit gefunden zu haben. Der ROI ist somit ein von Investoren geschätztes Instrument zur Beurteilung von Investitionen. Wer also externes Kapital benötigt, sollte auf eine hohe Kapitalrendite achten.
Hohe Kapitalrendite wichtig für Investoren und Unternehmen
Eine hohe Kapitalrendite ist für Unternehmen und Investoren gleichermaßen wichtig. Sie signalisiert einen effizienten Kapitaleinsatz und bildet die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und Wettbewerbsvorteile.
Um den ROI zu steigern, sind sowohl Kostensenkungsmaßnahmen als auch Umsatzsteigerungen notwendig. Produktivitätssteigernd wirkt sich auch eine Erhöhung des Kapitalumschlags aus, zum Beispiel durch die Optimierung des Working Capital oder eine Verbesserung der Betriebsprozesse. Mit weniger Mitteln mehr erreichen, lautet die Devise. Letztlich kommt es aber auf das Management an, diese Maßnahmen richtig umzusetzen. Wer diese Faktoren erfolgreich berücksichtigt, wird langfristig von einer hohen Kapitalrendite und finanziellem Erfolg profitieren.