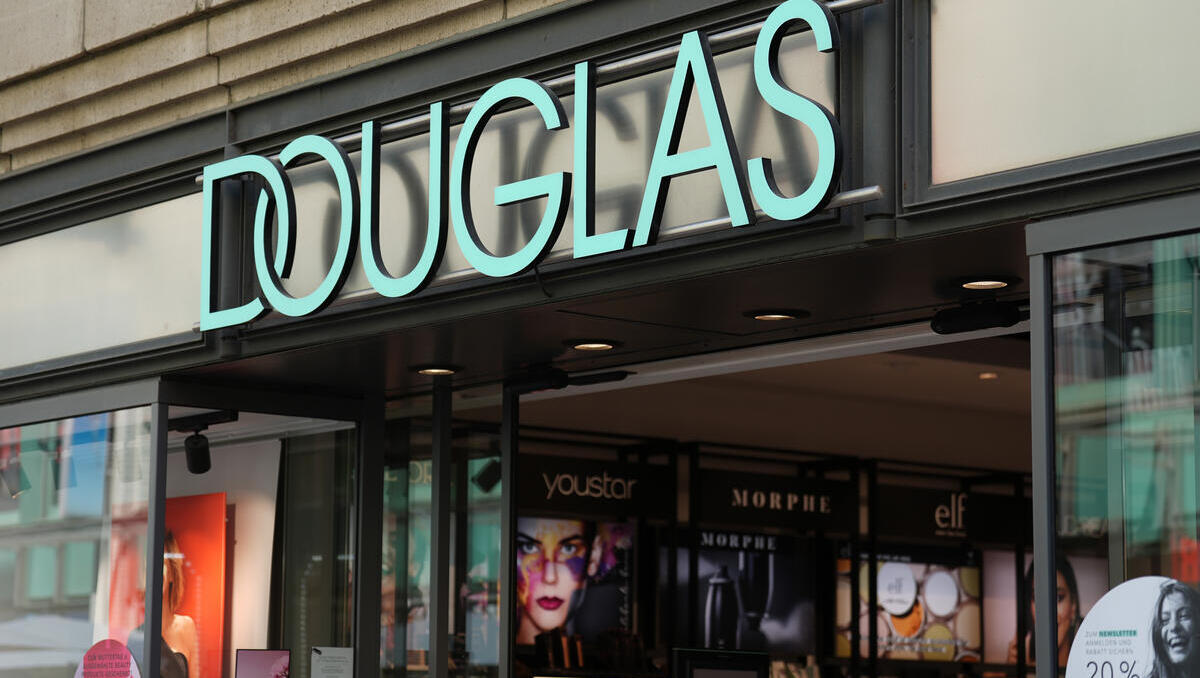Herr Gros, Sie haben die von der Europäischen Union verhängten hohen Zölle auf Elektrofahrzeuge aus China kritisiert und argumentiert, es widerspräche dem gesunden Menschenverstand, den Zugang zu kostengünstigen grünen Technologien zu erschweren. Jetzt sorgt eine weitere kostengünstige chinesische Innovation für Schlagzeilen: Die Plattform für künstliche Intelligenz von DeepSeek. Wie könnte die „effizientere“ KI von DeepSeek Europas Bemühungen um Wiederherstellung seiner globalen Wettbewerbsfähigkeit beeinflussen?
Daniel Gros: Auch wenn Europa gut daran täte, chinesische Elektrofahrzeuge zu begrüßen, um die ökologische Wende zu unterstützen, ist nicht zu leugnen, dass das auch mit Nachteilen verbunden wäre. Schließlich hat Europa eine riesige Automobilindustrie, die Millionen von Arbeitnehmern beschäftigt, und deren Arbeitsplätze wären gefährdet, wenn chinesische Autos den europäischen Markt erobern würden. Allerdings wird dieses Risiko tendenziell übertrieben; es ist unwahrscheinlich, dass billige chinesische Elektroautos die europäischen Autohersteller in den Ruin treiben würden. Aber es stimmt, dass chinesische Importe direkt mit der europäischen Produktion konkurrieren.
Im Gegensatz dazu stellt Europa keine fortschrittlichen KI-Modelle wie DeepSeek her. Das chinesische Start-up könnte zwar mit dominanten US-Unternehmen konkurrieren (falls sich seine Technologie bewährt), bedroht aber nicht die europäische KI-Industrie. Im Gegenteil: Wenn DeepSeek eine Ära der billigeren KI einläutet, könnte es der europäischen Industrie die Einführung von KI erleichtern und ihrer Wettbewerbsfähigkeit damit einen dringend benötigten Impuls geben. Das ist eine Chance, die Europa nicht verspielen sollte.
Im Jahr 2013, als Deutschlands Wirtschaft als „Vorbild“ für die notleidenden Volkswirtschaften der Eurozone angepriesen wurde, warnten Sie, es gäbe viel, was „um eine Produktivitätssteigerung kämpfende Volkswirtschaften ignorieren sollten“, statt es nachzuahmen. Welche Lehren aus seiner damaligen „Kehrtwende“ sollte Deutschland angesichts seiner jetzigen, anhaltenden wirtschaftlichen Malaise beherzigen, und was muss es anders machen?
Daniel Gros: Wenn sich Deutschland von seiner derzeitigen Malaise erholen will, muss es erkennen, dass, wie es so schön heißt, diesmal alles anders ist.
Deutschland erholte sich von seinem auf die Wiedervereinigung folgenden Konjunktureinbruch Anfang der 2000er Jahre, indem es seine Arbeitsmärkte so reformierte, dass weniger produktive Arbeitnehmer in Lohn und Brot kamen. Da es sich dabei um Niedriglohnjobs handelte, leistete die Regierung dabei zusätzliche Unterstützung, um einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. Die Ausweitung der Erwerbsbevölkerung half der deutschen Industrie, ihre Wettbewerbsfähigkeit in ihren traditionellen Industriezweigen wiederzuerlangen und vom Aufstieg Chinas zu profitieren.
Dieses Modell kann heute nicht mehr funktionieren, da chinesische Unternehmen in diesen Sektoren äußerst wettbewerbsfähig sind und sie zunehmend dominieren. Diesmal muss sich die Bundesregierung auf die Förderung von Investitionen in neue Sektoren konzentrieren und dabei zugleich der Versuchung widerstehen, die alten Sektoren zu schützen.
Sie argumentieren, dass Europa von Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus profitieren kann – zumindest was den Handel betrifft –, indem es als geschlossene Einheit auftritt und einen diplomatischen Ansatz verfolgt, der Trumps Fokus auf Gegenseitigkeit widerspiegelt. Während Trumps erster Amtszeit haben Sie allerdings darauf hingewiesen, dass Trump lieber mit einzelnen Mitgliedstaaten als mit der EU verhandele und versuche, „Werkzeuge“ zu finden, mit denen er die EU politisch spalten könne (z. B. Zölle auf Autos). Welche europäischen Trennlinien oder Schwächen lassen sich heute ausnutzen?
Daniel Gros: Auch wenn die EU zweifellos ihre Schwachstellen hat, wird Trump diese während seiner zweiten Präsidentschaft wahrscheinlich nicht für bilaterale Abkommen ausnutzen können.
Trump wird beim Handel nicht mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten verhandeln können, da die EU eine gemeinsame Handelspolitik verfolgt. Niemand würde die EU verlassen, nur um mit Trump ein besseres Handelsabkommen zu schließen, egal, welch spaltendes Zuckerbrot er offeriert. Dies gilt umso mehr, als offensichtlich sein sollte, dass ein gutes bilaterales Handelsabkommen, was Verhandlungen mit der Trump-Regierung angeht, eine Schimäre ist. Das Vereinigte Königreich, das kurz vor Beginn von Trumps erster Präsidentschaft für den Austritt aus der EU gestimmt hat, hat kein derartiges Abkommen bekommen.
Allgemeiner ausgedrückt: Es ist inzwischen ganz offensichtlich, dass man Trump nicht trauen kann. Allein diese Feststellung wird Trumps Macht, die EU in irgendeiner Frage zu spalten, erheblich schmälern. Die einflussreichen EU-Mitgliedstaaten haben wenig Lust, ihre Partner zu verärgern, nur um von einem launenhaften US-Präsidenten einen flüchtigen Vorteil zu erhaschen.
Nebenbei …
Trump will Grönland. Kann die EU mit den USA über andere Themen verhandeln, wenn Trumps Bestreben, die Souveränität über Grönland zu erlangen, die bilateralen Beziehungen dominiert?
Daniel Gros: Zum Glück wird Trumps Wunsch, Grönland zu übernehmen, weder vom politischen Establishment der USA noch von der amerikanischen Öffentlichkeit in größerem Umfang geteilt. Angesichts des von Trump in Bezug auf Grönland ausgeübten Drucks muss die EU auf Zeit spielen, während sie sich mit den USA über andere, substanziellere Themen auseinandersetzt. Gleichzeitig jedoch müssen die EU und ihre Mitgliedsstaaten viel mehr in ihre eigene Sicherheit investieren. Dänemark steht haushaltsmäßig in der EU mit am besten da und sollte in der Lage sein, seine Militärpräsenz in Grönland schnell erheblich zu verstärken.
Der viel gelobte, im vergangenen September veröffentlichte Bericht des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank und früheren italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit ist Ihrer Meinung nach in wichtigen Punkten unzureichend. Zum Beispiel gebe es trotz einer „impliziten Aufforderung, jährlich 300 Milliarden Euro für Digitalisierung und Innovation auszugeben“, „keinen Hinweis darauf, welche Art von Projekten oder Programmen finanziert werden sollte.“ Ist das empfohlene Finanzierungsniveau angemessen, und wie würden Sie es zuteilen?
Daniel Gros: Man kann das Investitionsvolumen im Draghi-Bericht nur als Wunschvorstellung bezeichnen. Eine Übersetzung aus der rosigen Politikersprache könnte lauten: „Dieses Investitionsniveau wäre sehr schön, aber wir haben keine Ahnung, wie wir es erreichen können.“ Der Bericht legt nicht einmal dar, ob das Geld von der EU, aus den nationalen Haushalten oder aus dem Privatsektor kommen soll. Das ist jedoch ein entscheidender Unterschied.
Es wäre nicht sinnvoll, dass der öffentliche Sektor Hunderte Milliarden Euro für Innovation ausgibt; die muss in erster Linie von privaten Akteuren vorangetrieben werden. Es wäre jedoch weit hergeholt, zu glauben, dass die europäische Industrie, die ihre Investitionen lange Zeit vor allem in Mid-Tech-Branchen gelenkt hat, plötzlich anfangen würde, enorme Summen in bahnbrechende Innovationen zu investieren, oder dass in Europa plötzlich Millionen von Innovatoren auftauchen würden – es sei denn, die Bedingungen ändern sich. Was Europa braucht, ist kein Plan, wie es Hunderte Milliarden Euro ausgeben soll, sondern eine Strategie zur Verbesserung seiner Rahmenbedingungen für Innovation von unten nach oben. In dieser Hinsicht der enthält Draghi-Bericht einige gute Ideen.
Draghis Bericht wurde jedoch „in der Brüsseler Blase gut aufgenommen“, auch von der Europäischen Kommission, die ihn angefordert hatte. Was kommt als Nächstes? Wie realistisch ist der gerade von der Kommission vorgestellte „Kompass für Wettbewerbsfähigkeit“?
Daniel Gros: Der Draghi-Bericht enthält Hunderte detaillierter politischer Empfehlungen, von denen viele sehr nützlich wären. Leider dürften die produktivsten davon ignoriert werden. Zu den Änderungen, die sehr gut aufgenommen wurden, gehören diejenigen, die der Kommission mehr Ermessensbefugnisse einräumen würden. So könnte die Kommission zum Beispiel die Befugnis erhalten, bestimmte Unternehmen von den geltenden Wettbewerbsregeln auszunehmen, damit sie den europäischen Markt beherrschen können – und, so hofft man, weltweit wettbewerbsfähiger werden.
Was den Wettbewerbskompass betrifft, so enthält er viele lobenswerte Ziele, aber es fehlt an Details, wie diese erreicht werden sollen. In diesem Sinne ähnelt er der so genannten Lissabon-Strategie aus dem Jahr 2000, die die EU innerhalb eines Jahrzehnts zum wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt machen sollte – was sie aber eindeutig nicht tat.