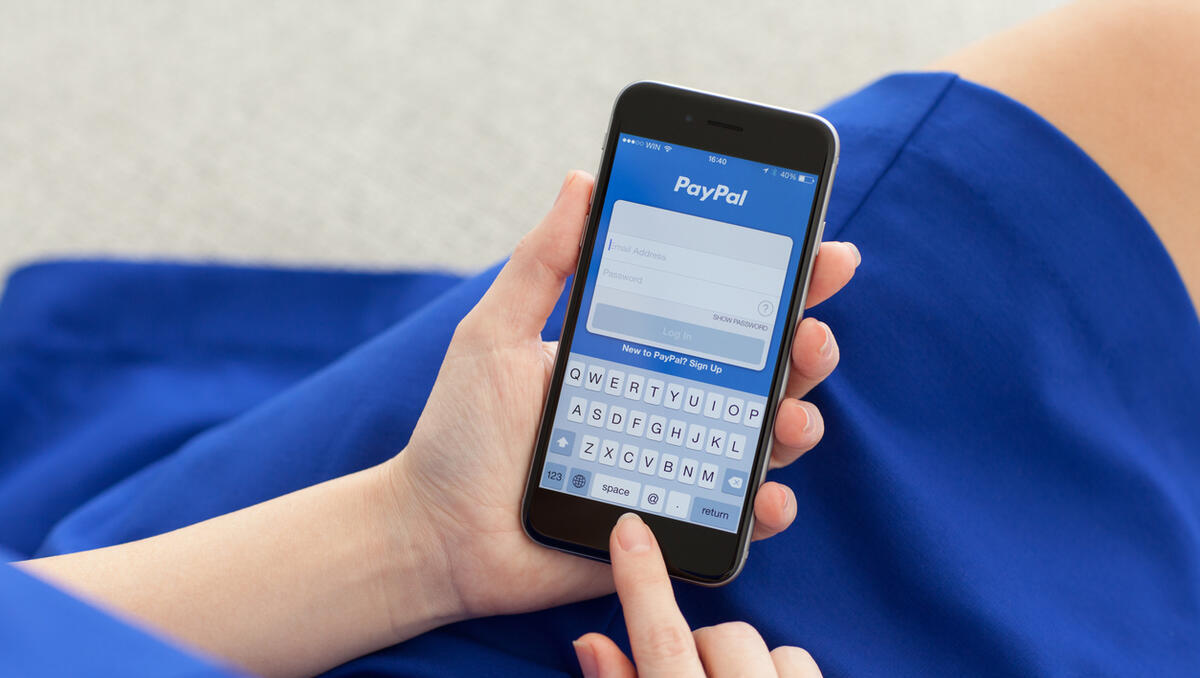Mit dem digitalen Euro soll eine elektronische Form des Euro geschaffen werden, die die Europäische Zentralbank (EZB) herausgegeben will. Als offizielles Zahlungsmittel soll er dann neben Bargeld und anderen Bezahlmethoden als Alternative existieren. Ziel ist es, eine europäisch kontrollierte Bezahlfunktion zu bieten, die sicher und stabil sein soll und andere digitale Zahlungsmethoden, wie die Bezahldienste oder Kreditkarten von Banken und Tech-Unternehmen ergänzen soll. Wird er eingeführt, soll er Zahlungen über eine App oder ein digitales Wallet schnell und unkompliziert ermöglichen.
Aktuell befindet sich der digitale Euro in einer Testphase, in der es darum geht, die technischen Lösungen für den Bezahlverkehr zu optimieren, eine Zusammenarbeit mit den Banken und anderen Zahlungsdienstleistern zu organisieren und die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Diese Entwicklungsphase soll noch bis Oktober 2025 andauern.
Ob der digitale Euro dann ab 2026 kommt, wird von der Politik auf EU-Ebene entschieden. Die EU-Verordnung zum digitalen Euro wurde 2023 vorgeschlagen und wird derzeit vom Rat der Europäischen Union und dem Europaparlament verhandelt. Noch müssen sich die Regierungen der Mitgliedstaaten und das europäische Parlament darüber einigen und eine Verordnung beschließen. Die neue deutsche Regierung aus Union und SPD hat jedoch in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen, dass sie die Einführung des digitalen Euros unterstützt.
Kritik am digitalen Euro: Kommt die Totalüberwachung?
Der digitale Euro steht bei vielen in der Kritik. Die Gegner der europäischen digitalen Währung befürchten, dass durch den digitale Euro auch eine Abschaffung des Bargeldes vorangetrieben werden soll. Außerdem wird die Transparenz der Zahlungen angemahnt – da alle Zahlungen dann jederzeit nachvollziehbar sind. Bei einer Abschaffung des Bargeldes wäre es zudem auch einfach, bürgerliches Fehlverhalten direkt zu sanktionieren, da das digitale Portemonaie jederzeit abgeschaltet werden könnte. Auch könnten Sparguthaben dann leicht mit Negativzinsen sanktioniert werden.
Allerdings ist es bereits heute schon so, dass jede digitale Zahlung, ob über Zahlungsdienstleister, Giro- oder Kreditkarte oder eine App, immer einen Datenabdruck hinterlässt, den man nachvollziehen kann. Diese liegen heute allerdings noch nicht bei einer staatlichen Institution, sondern bei privaten Unternehmen. Laut EZB soll der digitale Euro jedoch genauso anonym werden wie das Bargeld, das nach ihrer Aussage auch auf jeden Fall erhalten bleiben soll.
Die Banken stehen jedoch dem digitalen Euro sehr skeptisch gegenüber, da er sicherer sein wird als eine Bankeinlage. Die EZB kann im Gegensatz zu einer Bank nicht pleitegehen. Deshalb befürchten die Banken, dass die Bürger ihr Geld dann vornehmlich in digitale Euros anlegen werden. Dies wäre für die Banken fatal. Die EZB entkräftet diese Befürchtungen allerdings mit dem Plan, dass jeder Bürger nur einen bestimmten Betrag von wenigen tausend Euro in digitalen Euros halten soll. Diese werden außerdem ebenso wenig verzinst wie das Bargeld.
Der digitale Euro als Machtinstrument
Der digitale Euro würde eine neue Dimension des Zahlungsverkehrs einläuten, als vollständig zentralisierte Form des Zentralbankgelds. Er wäre programmierbar und vollständig kontrollierbar. Jede Zahlung könnte an Bedingungen geknüpft werden und jede Transaktion zentral gesteuert werden. Die EZB wäre dann die einzige Betreiberin der digitalen Wallets und der gesamten Konteninfrastruktur. Die Trennung von Staat und Geldsystem wird hier aufgehoben. Damit ist der digitale Euro auch kein neutrales Zahlungssystem. Die EZB erweitert durch den digitalen Euro auch ihre Funktion als Zentralbank und wird zu einer zentralen technologischen Infrastrukturbetreiberin für den Zahlungsverkehr in Europa. Sie hätte dadurch direkten Zugriff auf die gesamte monetäre Infrastruktur im Euroraum. Dies würde ihr nicht nur Einblick in das gesamte Finanzgeschehen ermöglichen, sondern ihr auch weitreichende Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten geben.
Testphase läuft: Interaktionsplattform zum Meinungsaustausch ist online
Gerade erst vor Kurzem hat die EZB eine Interaktionsplattform in Betrieb genommen, auf der 70 Händler und Zahlungsdienstleister, die das neue Bezahlsystem derzeit testen, ihre Meinungen und Anregungen veröffentlichen können, sich austauschen können und Problembereiche identifizieren können. Auf der Plattform werden auch neue Zahlungsdienste erprobt, wie bedingte Zahlungen und die Integration digitaler Wallets in Postfilialen. Der Zeitplan bis Ende 2025 erscheint beim aktuellen Stand der Dinge jedoch als überambitioniert, denn die Herausforderung ist einerseits technisch komplex, andererseits ist auch die Sicherheitsstruktur noch lange nicht ausgereift. Dies ist in Anbetracht der realen Gefahr durch internationale Hackerangriffe sehr bedenklich.
Warum die Eile?
Fraglich bleibt, warum die EZB ausgerechnet jetzt die Einführung des digitalen Euros so vehement vorantreibt, denn die Eurozone steckt bereits seit längerer Zeit in einer strukturellen Wirtschafts- und Schuldenkrise. Das ehemals wirtschaftlich starke Deutschland befindet sich nun im dritten Jahr in einer anhaltenden Rezession und viele südeuropäische Länder haben keine Kontrolle mehr über ihre Staatsverschuldung. Mitten in dieser problematischen Lage soll nun mit der Einführung des digitalen Euros die Architektur des europäischen Finanzsystems auf den Kopf gestellt werden. Italien mit einer Staatsverschuldung von 140 Prozent und Frankreich mit 120 Prozent werden sich nicht mehr ohne umfangreiche geldpolitische Interventionen der EZB aus ihrer Schuldenspirale befreien können.
Staatsbankrotte sind keine Option, denn sie würden das Aus für den gesamten Euroraum bedeuten. Weitet sich die Schuldenkrise aus und wächst der Schuldenberg weiter, müsste die Kreditbasis zur Rettung überschuldeter Staaten massiv ausgeweitet werden. Potenzielle Investoren würden dann die Stabilität der Währung infrage stellen. Der digitale Euro könnte dann durch entsprechende Programmierungen auch der Marktabschottung dienen, um eine Kapitalflucht aus der Eurozone zu verhindern und dem endgültigen Kollaps des Euros vorzubeugen. Für den Fall, dass eine derartige Politik der Abschottung an den europäischen Finanzplätzen befürchtet wird, könnte sich die bereits einsetzende Kapitalflucht aus der Eurozone dramatisch beschleunigen. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, die derzeit auf eine marktwirtschaftliche Ordnungspolitik und Deregulierung setzen sowie ein digitales Zentralbankgeld ablehnen, wirkt der digitale Euro wie ein monströses und intransparentes Machtinstrument der Überwachung und Steuerung.
Was spricht für den digitalen Euro?
Die Befürworter des digitalen Euros führen jedoch die Bedeutung der digitalen Souveränität Europas ins Feld. Und in der Tat – beim bargeldlosen Bezahlen sind die meisten europäischen Länder von großen US-Unternehmen abhängig. Ein eigenes Karten-Bezahlsystem gibt es nur in 7 der insgesamt 20 Länder der Eurozone, alle anderen Länder sind abhängig von amerikanischen Anbietern wie Visa und Mastercard. Knapp zwei Drittel aller Kartenzahlungen im Euroraum werden von nicht-europäischen Anbietern abgewickelt. Es ist also eine große Abhängigkeit vorhanden, die angesichts des politischen Richtungswechsels in den USA nicht ungefährlich sein könnte. Der digitale Euro könnte hier Abhilfe schaffen.
Generell gewinnen Kryptowährungen auch in der Wirtschaft an Bedeutung, denn sie können eine Reihe von Aufgaben übernehmen, insbesondere in Verbindung mit sogenannten „intelligenten Verträgen“ (Smart Contracts), die automatisierte Zahlungen möglich machen. Hierunter versteht man spezielle Programme, die beispielsweise Zahlungs- und Lieferbedingungen definieren und abwickeln. Diese können so angelegt werden, dass bei einer Vertragserfüllung die Bezahlung automatisch ausgelöst wird. Durch den digitalen Euro müssten diese Prozesse nicht mehr mit Kryptowährungen externer Anbieter abgewickelt werden. Dies bietet Vorteile in Bezug auf Datensicherheit und minimiert das Ausfallrisiko der Kryptoanbieter bei einer Insolvenz.