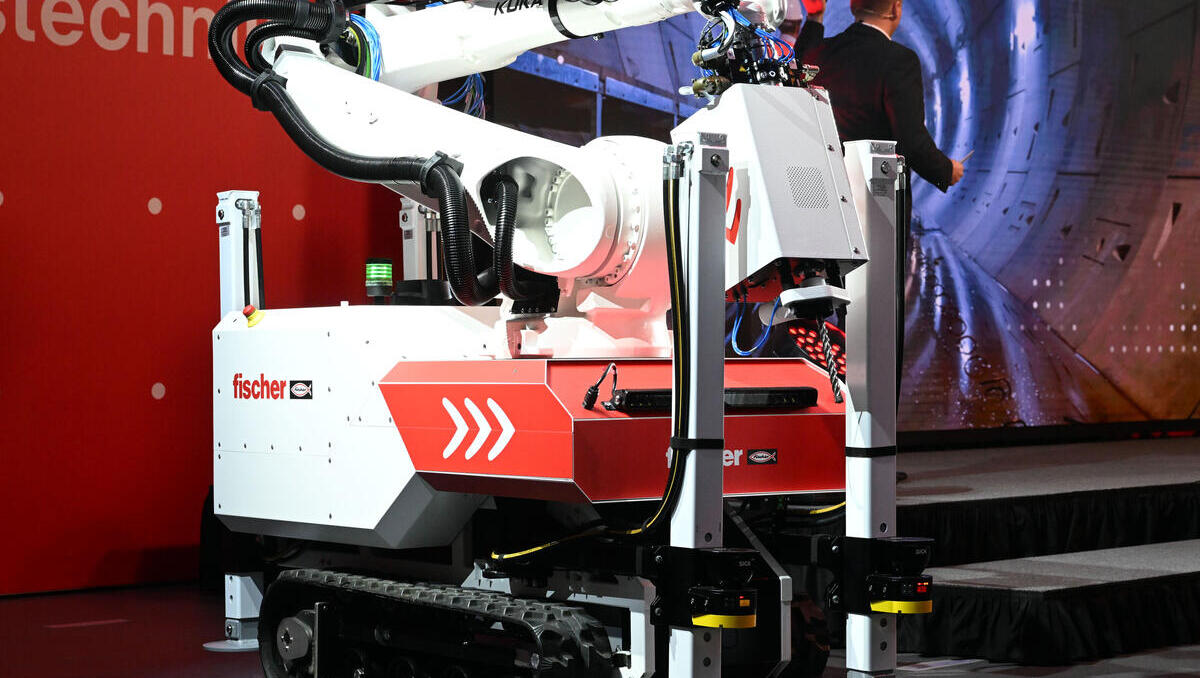Berlin trotzt Brüssel: Milliarden für die Industrie geplant
Deutschlands Plan, energieintensiven Unternehmen staatlich vergünstigten Strom zu gewähren, könnte gegen die EU-Beihilferegeln verstoßen – doch niemand rechnet ernsthaft damit, dass Brüssel den Berliner Vorstoß blockiert.
Laut einem Bericht von Politico will die Bundesregierung besonders stromintensiven Industriebetrieben günstige Strompreise garantieren. Die Differenz zum Marktpreis soll der Staat tragen – Kostenpunkt: rund 10 Milliarden Euro bis 2030. Für viele angeschlagene Branchen könnte dies einem Rettungsanker gleichkommen.
Beihilferecht kontra Industriepolitik
Grundsätzlich verbieten die EU-Regeln eine derartige staatliche Unterstützung, um Wettbewerbsverzerrungen zwischen wohlhabenden Ländern wie Deutschland und finanzschwächeren Mitgliedsstaaten zu verhindern. Doch der politische Druck wächst.
„Brüssel wird das keinesfalls kampflos hinnehmen“, sagte Oliver Bretz, Gründer der Kanzlei Euclid Law und Berater eines Verbands der energieintensiven Industrie Rumäniens.
Gleichzeitig zeigt sich die EU seit der Pandemie zunehmend bereit, ihre Vorgaben im Sinne der Wirtschaftspolitik zu lockern – auch um mit den USA und China Schritt zu halten. Viele Experten erwarten daher einen politischen Kompromiss.
„Die EU-Kommission wird eine dauerhafte Stromsubvention als klassische staatliche Beihilfe werten“, so Bretz weiter. Solche Maßnahmen seien Brüssel ein Dorn im Auge, da sie aus Sicht der Kommission strukturell ineffiziente Industrien künstlich am Leben hielten.
Ein durchgesickertes Dokument des Bundeswirtschaftsministeriums offenbart, dass Berlin sich der rechtlichen Probleme bewusst ist. Dort heißt es, die Pläne seien „rechtlich sehr fragwürdig“ und die Genehmigungsaussichten „höchst umstritten“.
Der Schatten des Gaspreisdeckels
Neben juristischen Fragen stellt sich auch die politische: Was bedeutet der Alleingang Deutschlands für die EU-weite Industriepolitik? Kritiker erinnern an das Jahr 2022, als Berlin ein 200-Milliarden-Euro-Programm zur Gaspreisstützung auflegte – eine Maßnahme, die damals in Brüssel für erheblichen Unmut sorgte.
Gleichzeitig scheint die EU heute kompromissbereiter – selbst bei Fragen, die die Grundprinzipien der Union betreffen. Ende Juni sollen neue Leitlinien zur Industriesubventionierung vorgestellt werden. Diese sollen es Mitgliedsstaaten erleichtern, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der klimafreundlichen Technologien zu fördern.
Deutschlands Industrie unter Preisdruck
Die Stromkosten für Unternehmen variieren stark – je nach Größe, Branche und Verbrauch. 2022 lagen die industriellen Strompreise in Deutschland laut einer Studie des bayerischen Unternehmensverbands etwa im EU-Durchschnitt. Doch seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich die Energiemärkte massiv verändert – und mit ihnen die Vergleichbarkeit.
Laut aktuellen EU-Daten liegt Deutschland inzwischen an dritter Stelle bei den Strompreisen für Nicht-Haushaltskunden – eine Kategorie, die Industrieunternehmen ebenso wie öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Behörden umfasst. Die Aussagekraft für einzelne Branchen ist daher begrenzt.
Im internationalen Vergleich steht Deutschland beim Strompreis (vor Steuern und Abgaben) im Mittelfeld, erklärt Energieexperte Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut gegenüber der Frankfurter Rundschau. Klar ist aber: Unternehmen in den USA und China zahlen deutlich weniger.
Nach Angaben des ifo Instituts betrugen die industriellen Stromkosten 2023 in den USA rund 7 Cent pro Kilowattstunde, in China etwa 8 Cent. In Deutschland dagegen zahlen Industrieunternehmen im Schnitt rund 20 Cent.
Der deutsche Strompreis setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen: dem Großhandelspreis, der Stromsteuer, Netzentgelten und verschiedenen Umlagen zur Finanzierung politischer Programme. Die Bundesregierung plant nun, diese Komponenten deutlich zu senken – konkret soll der Strompreis für Unternehmen um 5 Cent pro Kilowattstunde sinken.
Klimaziel kontra Marktverzerrung?
Zusätzlich will Berlin das bestehende Entlastungsprogramm für CO₂-Kosten verlängern und ausweiten. Dieses sieht Kompensationen für energieintensive Betriebe vor, die durch die CO₂-Bepreisung belastet werden. Diese Preisaufschläge sollen klimaschädliche Emissionen verteuern und zum Umstieg auf saubere Energie motivieren.
Doch Kritiker halten wenig von den Berliner Plänen: Die Subventionen würden laut ihnen nicht zur Energieeffizienz anregen und den Binnenmarkt der EU verzerren.