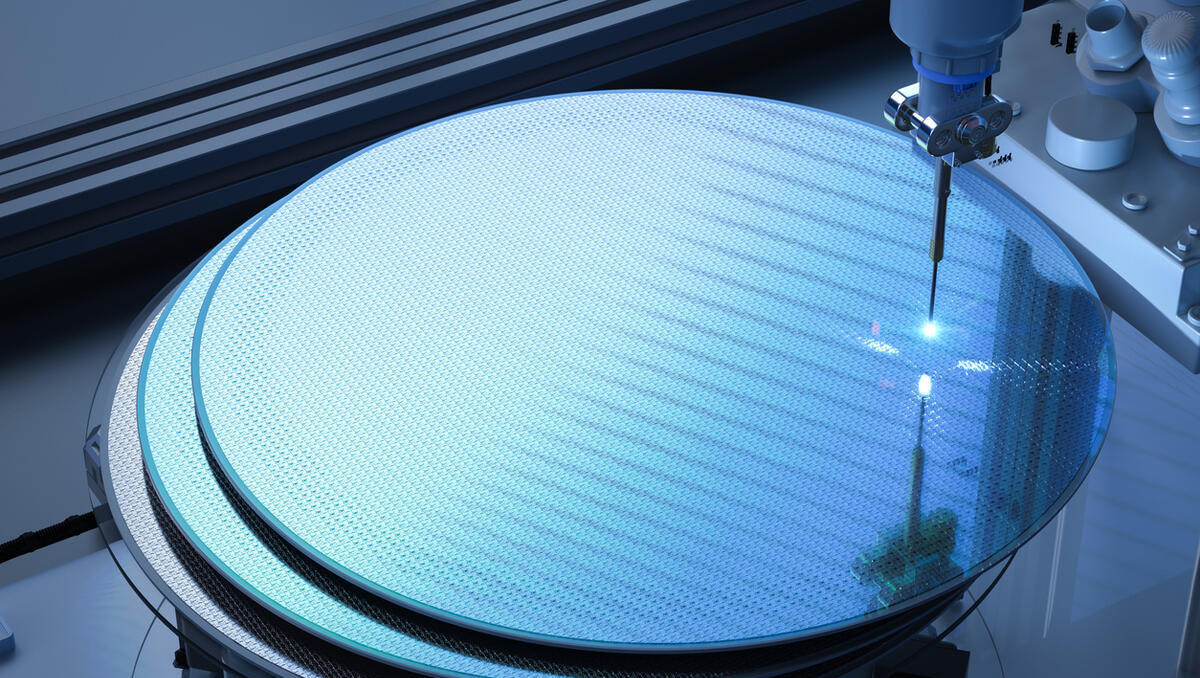Zinsdruck aus dem Weißen Haus – doch die Fed stellt sich quer
Die US-Notenbank Fed hat auf ihrer Sitzung im Juli die Leitzinsen nicht verändert. Sie bleiben vorerst im Korridor zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Damit liegen die Dollarzinsen weiterhin deutlich über dem Euro-Niveau – der maßgebliche Einlagensatz der EZB beträgt derzeit zwei Prozent.
Die Juli-Entscheidung der Fed wird Trump nicht gefallen. US-Präsident Donald Trump übt seit Langem Druck auf die Fed und deren Chef Jerome Powell aus, die Zinsen zu senken. Bei einem kürzlichen Besuch im Fed-Hauptquartier, wo Powell ihm die Renovierungsarbeiten an zwei historischen Gebäuden zeigte, sagte Trump, die Fed solle die Zinsen „drastisch um drei Prozentpunkte senken“. Trump geht sogar so weit, dass er immer wieder andeutet, Powell entlassen und durch jemanden ersetzen zu wollen, der die Zinsen senkt.
Zur Erinnerung: Über die Zinshöhe entscheidet nicht der Fed-Präsident allein, sondern das zwölfköpfige FOMC-Komitee. Powell betont, dass die Fed bei geldpolitischen Entscheidungen keine „fiskalischen Bedürfnisse“ der Regierung berücksichtigt. Vielmehr orientiere man sich am Doppelmandat der US-Notenbank: Preisstabilität – mit einem Inflationsziel von zwei Prozent – und maximale Beschäftigung. „Wir berücksichtigen keine fiskalischen Bedürfnisse der Regierung. Keine Zentralbank in der entwickelten Welt tut das. Das wäre schlecht für die Glaubwürdigkeit – sowohl der Zentralbank als auch der US-Fiskalpolitik“, so Powell.
Die Entscheidung im Juli fiel nicht einstimmig. Solche „Abweichungen“ sind im FOMC selten. Neun Mitglieder des FOMC stimmten gegen eine Änderung: Jerome H. Powell, John C. Williams, Michael S. Barr, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem und Jeffrey R. Schmid. Für eine Senkung um 0,25 Prozentpunkte votierten Michelle W. Bowman und Christopher J. Waller. Adriana D. Kugler war abwesend. US-Medien weisen darauf hin, dass beide Zinssenkungsbefürworter auf der Liste möglicher Nachfolger Powells stehen.
Die Entscheidung entsprach den Markterwartungen
Dass die Fed im Juli nicht senkt, war am Markt bereits erwartet worden. Schon nach der Juni-Sitzung war klar: Ein baldiger Zinsschritt wird von den meisten FOMC-Mitgliedern nicht unterstützt. Eine wichtige Minderheit rechnet sogar mit gar keiner Zinssenkung in diesem Jahr, die Mehrheit hingegen mit maximal einer bis Jahresende. Was die Märkte nun erwarten: Laut Bloomberg rechneten Marktteilnehmer vor der Sitzung noch mit einer 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September – laut Terminmärkten. Die „Financial Times“ berichtet jetzt von nur noch 44 Prozent. Erwartet wird inzwischen ein – höchstens zwei – Zinsschritte. Bis Jahresende stehen noch drei Fed-Sitzungen an: im September, Oktober und Dezember.
Powell betont erneut, dass sich die US-Wirtschaft in guter Verfassung befindet. Das sagte er auch Trump bei dessen Fed-Besuch. Doch Powell meint das anders, als Trump es interpretiert. Trump wertete es als Lob seiner Wirtschaftspolitik. Doch für die Fed ist es ein Analysebefund – und ein Argument, die Zinsen nicht zu ändern. Niedrigere Zinsen wirken konjunkturstützend. Wenn die Lage robust ist, braucht es keine Impulse.
Die Fed will abwarten, bis die Lage klarer ist
Die Fed beobachtet die Risiken genau – besonders jene, die aus der Unsicherheit rund um Trumps Handelszölle entstehen: Inflation, Arbeitsmarkt, Konjunktur. Powell sprach von einer komplexen Lage: Die Konjunktur zeigt erste Schwächesignale, der Inflationspfad ist unklar, zugleich bleibt der Arbeitsmarkt stabil. Ökonomen stellen generell fest, dass die Statistik aktuell ein verzerrtes Bild zeigt – wegen der vielen Unsicherheiten. Deshalb will die Fed zuwarten. Powell sagte auf der Pressekonferenz, man sei „in einer guten Position“, um auf mehr Daten zu warten, bevor man handle. Man könne schnell reagieren. Er wiederholte: „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen.“ Die derzeitige Geldpolitik sei, so Powell, „moderat restriktiv“ und geeignet, um Inflationsrisiken abzufedern.
Das US-BIP wuchs im zweiten Quartal um drei Prozent – doch Vorsicht ist geboten. Bis zur September-Sitzung wird es noch zwei Inflations- und zwei Arbeitsmarktberichte geben. Ein BIP-Wert wurde bereits veröffentlicht – er lag über den Erwartungen. Doch die Details zeigen, dass es unter der Oberfläche brodelt. Zur Erinnerung: Im ersten Quartal schrumpfte das BIP um 0,5 Prozent – zum ersten Mal seit drei Jahren. Viele warnten damals vor einer Rezession. Das zweite Quartal brachte dann starkes Wachstum. Doch was steckt hinter dem Anstieg? „Im Vergleich zum ersten Quartal war das BIP-Wachstum im zweiten Quartal vor allem auf den Rückgang der Importe und die stärkere Konsumnachfrage zurückzuführen, was durch sinkende Investitionen teilweise ausgeglichen wurde“, so die US-Statistiker. Die Konsumausgaben stiegen von nur 0,5 Prozent im ersten Quartal auf 1,4 Prozent im zweiten. Am wenigsten – um 1,1 Prozent – stieg der Dienstleistungsverbrauch. Der Konsum langlebiger Güter stieg deutlich: um 3,7 Prozent. Auch Verbrauchsgüter legten um 1,3 Prozent zu. Grund: Die Zollunsicherheit der Trump-Regierung veranlasste viele Haushalte, Anschaffungen vorzuziehen oder Vorräte anzulegen. Nicht vergessen: Die privaten Konsumausgaben machen drei Viertel des US-BIP aus.
Eine Santander-Studie zeigt, dass Mittelklasse-Amerikaner im zweiten Quartal gezielt einkauften – aus Angst vor höheren Preisen. Jeder Fünfte tätigte wichtige Käufe, 41 Prozent davon kauften ein Auto. Private Investitionen gingen zurück – aufs Jahr hochgerechnet um 15,6 Prozent. Im Vorjahresquartal waren sie noch um 8,3 Prozent gestiegen. Auch Im- und Export nahmen ab – vor allem die Importe. Der Außenbeitrag (Nettoexport) wirkte sich positiv aus: Exporte sanken um 1,8 Prozent, Importe um 30,3 Prozent. Die US-Inflation ist „etwas erhöht“, heißt es im Fed-Statement. Der Arbeitsmarkt sei robust. Bis zur September-Sitzung werden neue Daten zur Wirtschaftslage erwartet. Zum Thema Inflation äußerte sich Powell mit „hawkischem“ Ton: Sie bleibe erhöht. Im Juni lag die Gesamtinflation laut Statistikamt bei 2,7 Prozent.
Ein Strukturwandel zeichnet sich ab
Lange war die Dienstleistungsinflation das Hauptproblem. Doch Powell stellte nun fest: Sie kühlt ab.
Dafür steigen nun wieder die Preise einzelner Waren – ein Effekt der neuen Zollpolitik. „Die Wirkung höherer Zölle zeigt sich zunehmend bei bestimmten Produkten. Doch wir müssen abwarten, bevor wir deren Gesamteinfluss auf Konjunktur, Inflation und Arbeitsmarkt abschätzen können“, so Powell. Man werde bei der Fed genau beobachten, wie sich die Zölle auf die Preise auswirken. Auf eine Frage sagte er: Es werde Unternehmen geben, die Zölle als Vorwand für Preiserhöhungen nutzen – selbst wenn sie gar nicht betroffen sind. Letztlich aber, so Powell, würden die Kosten der Zölle zum Teil bei den US-Unternehmen hängen bleiben – sicher aber auch bei den Verbrauchern, durch höhere Preise.