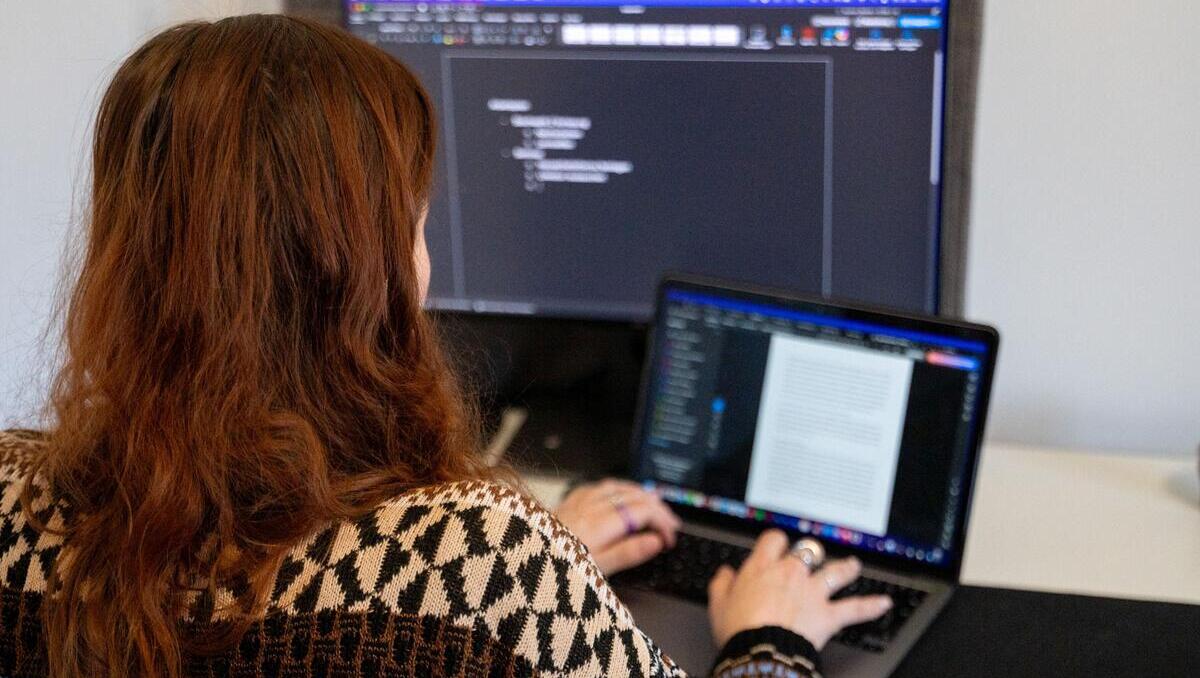In Deutschland klafft die Vermögensschere weiter auseinander: Ältere Generationen, vor allem Paare, verfügen über deutlich höhere Ersparnisse und Immobilienwerte als junge Menschen. Eine aktuelle Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, wie stark Erbe, Immobilienbesitz und Beziehungsstatus den finanziellen Spielraum bestimmen – und warum der Weg zum Vermögen für viele immer steiniger wird.
Vermögensaufbau: Wie sind die Vermögen in Deutschland verteilt?
Hauptsächlich Personen aus der Altersgruppe von 50 Jahren aufwärts haben in Deutschland ein nennenswertes Vermögen aufbauen oder erhalten können. Die Generation Babyboomer ist nominal die reichste Generation in der Geschichte. Demgegenüber wird es für junge Menschen – vor allem solche, die auf kein Erbe zurückgreifen können – immer schwieriger, Vermögen aufzubauen. Paare haben es dabei leichter als Singles.
Dies lassen die Zahlen erkennen, die das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) jüngst präsentiert hat. Die Wirtschaftsforscher stützen sich auf eine Befragung von Haushalten im Auftrag der Deutschen Bundesbank. Diese hatte zwischen Mai 2023 und Februar 2024 stattgefunden.
IW weist deutliche Unterschiede zwischen Bevölkerungssegmenten aus
Wie das IW mitteilt, sind es zumeist jene Personen, die kurz vor der Rente stehen, die das vergleichsweise höchste Vermögen aufweisen.
Vermögen wächst mit dem Alter
Wer wie viel besitzt, hängt stark mit dem Alter zusammen. Die Auswertung zeigt, dass 2023 das Haushaltsnettovermögen der unter 35-Jährigen mit 17.300 Euro im Median deutlich niedriger lag. Zum Vergleich: In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen lag der Median bei 241.100 Euro, in keiner anderen Altersgruppe war er höher. Ein wesentlicher Grund: Vermögensaufbau dauert lange, häufig ein ganzes Arbeitsleben. Erst im Ruhestand wird das Vermögen wieder schrittweise aufgebraucht. Wer 75 oder älter war, hatte im Median noch ein Vermögen von 172.500 Euro.
Zur Ermittlung des Nettovermögens zog die Bundesbank die Summe aller Vermögenswerte voran. Dazu zählten nicht nur das verfügbare Guthaben auf dem Konto, sondern auch Immobilien, Betriebsvermögen, Wertpapiere aller Klassen, Edelmetalle oder Kryptobestände.
Herkunft, Alter, Familienstand: Ungleiche Wohlstandsverteilung in Deutschland
Das Medianvermögen in Ostdeutschland liegt unter 40.000 Euro. Damit liegt es deutlich unter dem Vermögen der Westdeutschen, wo es bei rund 143.000 Euro liegt. Die Region Süddeutschland, also Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, weist dabei mit knapp 190.000 Euro das höchste Medianvermögen auf. Im Norden der Bundesrepublik sind es immerhin rund 129.000 Euro.
Die Untersuchung zeigt auch, dass in der jüngeren Altersgruppe das Vermögen sehr ungleich verteilt ist. Es gibt einige Haushalte mit recht hohem Vermögen und viele mit eher geringem Vermögen. Dadurch herrscht eine recht große Ungleichheit im Vergleich zu anderen Altersgruppen. Viele der jungen Haushalte mit sehr hohem Vermögen haben bereits von einer größeren Erbschaft oder Schenkung profitiert.
Wie ist ein Vermögensaufbau auch ohne Erbschaft möglich?
Dennoch gelingt es einigen auch, ohne geerbten Vermögen ein substanzielles Vermögen aufzubauen. Der Schlüssel dazu kann eine Partnerschaft sein und der gemeinsame Erwerb von Wohneigentum. Auf Haushaltsebene betrachtet, kommt es häufig bereits zu einem Vermögensaufstieg, wenn sich zwei Single-Haushalte zu einem gemeinsamen zusammenschießen:
- Vor allem Singles unter 35 Jahren verfügten im Median nur über ein zusammengespartes Vermögen von 9.800 Euro. Demgegenüber lag der Referenzwert bei zusammenlebenden Paaren dieser Altersgruppe immerhin bei etwa 42.300 Euro.
- In der Altersgruppe der 55- bis 64-Jährigen betrugen die Werte im Mittel 79.800 Euro bei Singles und bei Paaren sogar 361.800 Euro!
Wohneigentum als Schlüssel zum Wohlstand
Eine weitere Erkenntnis: Während jeder Zweite der 55- bis 64-Jährigen in selbstgenutztem Wohneigentum lebte, waren es bei den unter 35-Jährigen nur etwa 10 Prozent der Befragten. Das ist nicht unwesentlich, den Immobilieneigentum führt zum größten Vermögenszuwachs. In der Gruppe der über 50-Jährigen macht das selbst genutzte Wohneigentum knapp die Hälfte des Bruttovermögens aus. In der reichsten Gruppe von 55 bis 64 liegt die Quote bei 56 Prozent.
Um zu den obersten 10 Prozent dieser Spitzengruppe zu gehören, reichte jedoch schon eine Summe an Vermögensbeständen im Wert von 1,06 Millionen Euro aus. Das ist in wohlhabenderen Gegenden des Landes wie dem Umland von München oder Stuttgart ein üblicher Preis für nicht außergewöhnlich mondäne Einfamilienhäuser.
Auch zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen Wohneigentümern und Mietern. Eigentümer verfügen über ein Medianvermögen von etwa 231.000 Euro, bei Mietern liegt es lediglich bei etwa 57.300 Euro.
Wie Alter und Anlageverhalten zusammenhängen
Die Besitzer von Aktien, ETFs und Fonds sind in Deutschland immer noch klar in der Minderheit. Das Gros der erwachsenen Bevölkerung macht um Wertpapiere einen Bogen – oder hat schlicht keine Mittel übrig, um zu investieren. Seit Aufziehen der Corona-Pandemie zum Anfang des Jahres 2020 ist jedoch eine Veränderung spürbar. Vor allem die jüngere Generation zeigt seitdem ein gesteigertes Interesse an Aktien & Co. Und auch die älteren Jahrgänge handelten im starken Auf und Ab der Märkte der zurückliegenden drei Jahre intensiver als zuvor.
Jüngere sparen eher in Form von Wertpapieren
Im Unterschied zur Generation der Babyboomer, zeigen jüngeren Menschen in Deutschland eine ausgeprägtere Aktienkultur, wie eine Generationenstudie der Consorsbank von 2023 zeigt. Während der Anteil des Wertpapiervermögens in der Generation 65+ bei 35 bis 39 Prozent lag, waren es bei den unter 35-Jährigen 2023 fast 50 Prozent.
Die jüngsten Anleger setzen dabei vor allem auf ETFs. In der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen machen sie mit durchschnittlich 41,2 % den größten Anteil des Depotvolumens aus. Bei den ältesten Anlegern ab 66 Jahren liegt der ETF-Anteil nur bei 16 Prozent. Sie verbuchen mit 67 Prozent dagegen den höchsten Aktienanteil am Depotvolumen.
Bei den Zahlen der Älteren ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei um seit längerer Zeit besparte Fonds oder im Portfolio gehaltene Aktien handelt. Deshalb ist es wenig verwunderlich, dass die ältere Generation trotz geringerer Anteile an Wertpapieren, mit zunehmendem Alter über mehr Vermögen verfügen. Die Unterschiede sind erheblich: So belief sich der Depotwert 2023 im Durchschnitt in der Altersgruppe ab 66 Jahren mit knapp 100.000 Euro auf mehr als das Fünffache des Durchschnitts in der Gruppe der 18- bis 25-Jährigen (18.500 Euro).
IW mahnt Politik zur Entlastung der Arbeitseinkommen
Die Zahlen illustrieren, dass die Vorstellung von reichem Deutschland immer weniger der tatsächlichen Realität entspricht. Der Aufbau von Ersparnissen nimmt immer mehr Zeit in Anspruch und wird durch immer stärkere laufende Belastungen schwieriger. Höhere Lebenshaltungskosten, höhere Sozialabgaben, stagnierende Löhne, teurere Kredite und höhere Immobilienpreise engen den Spielraum jüngerer Generationen ein.
Bei vielen der älteren Vermögenden, die über Immobilieneigentum verfügen, spielen zudem geerbte Immobilien eine Rolle. Das IW mahnt die Politik: „Will die Politik den Bundesbürgern den Vermögensaufbau erleichtern, sollte sie die Arbeitseinkommen entlasten.“
Fazit: Kommt Zeit, kommt Reichtum? Nein.
Die Studie unterstreicht die alles entscheidende Rolle der Erwerbsphase für den Vermögensaufbau. Da aber Krisen, Krieg und Inflationen sowie die hohe Steuerlast zu weniger Einkommen führen, muss der Staat die Vermögensbildung unterstützen. Nur wenn der Staat die Arbeitseinkommen gezielt entlastet, sodass die Beschäftigten mehr Netto vom Brutto haben, erlangen sie mehr Spielraum für die eigene Vermögensbildung und Altersvorsorge – etwa durch die Finanzierung einer Immobilie oder Anlagen am Kapitalmarkt.
Zusätzlich sollte der Staat die private Eigentumsbildung durch staatliche Förderung unterstützen. Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland deutlich hinterher. Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien, Niederlande, Estland und die südlichen EU‑Staaten heben sich mit attraktiveren Fördermodellen hervor. Die politischen Möglichkeiten, um der ungleichen Vermögensentwicklung entgegenzuwirken sind also da, warum sind sie nicht gewollt?