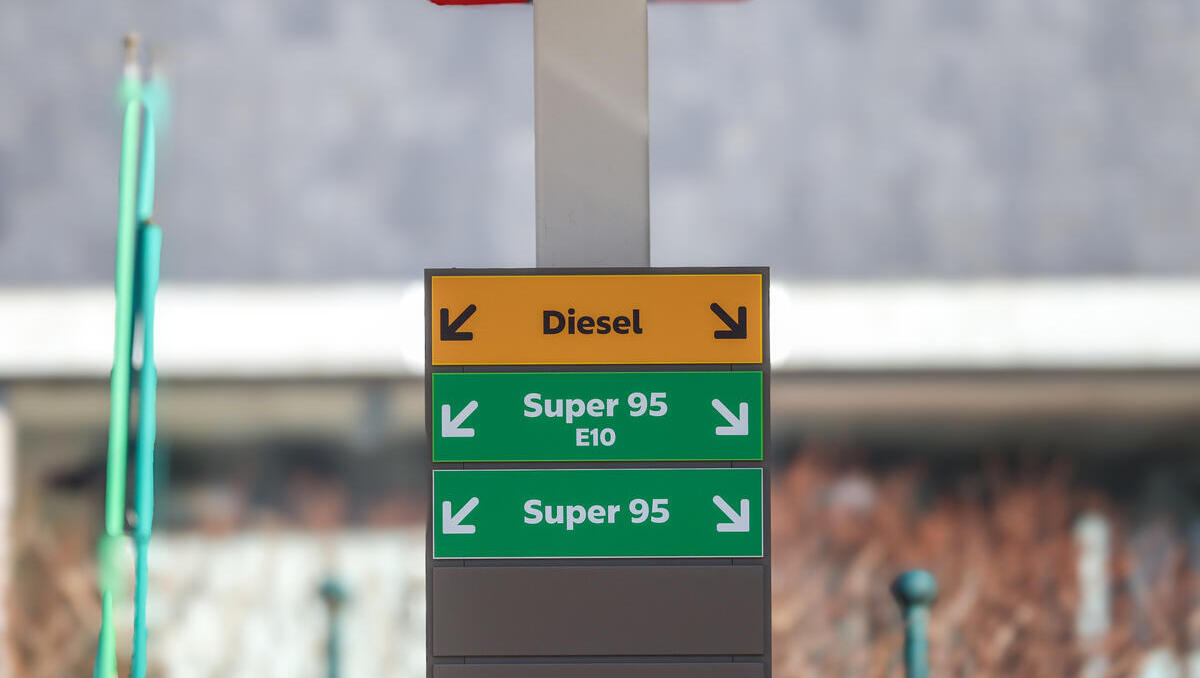Als die Eurokrise 2010 ausbrach, war plötzlich Undenkbares denkbar: Der Zerfall der Währungsunion. Staaten wie Griechenland, Portugal und später Italien verloren innerhalb weniger Wochen das Vertrauen der Finanzmärkte. Die Zinsen explodierten, Banken gerieten ins Wanken und Rettungspakete mussten im Eiltempo geschnürt werden.
Erst Mario Draghis berühmtes „whatever it takes“ stoppte die Panik. Doch der Preis war hoch: Jahrelange Sparprogramme, Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa, politische Spaltungen, die bis heute nachwirken. Und auch wenn diese Zeit weit entfernt scheint – sie rückt wieder ins Bewusstsein, weil nun ausgerechnet Frankreich ins Straucheln gerät.
Frankreich als neuer Krisenherd: Vom Kernland zum Sorgenkind
Frankreichs Schuldenstand liegt bei rund 3,3 Billionen Euro, die Quote bei rund 115-Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Das Haushaltsdefizit beträgt 5,8-Prozent – klar außerhalb der Vorgaben des Stabilitätspakts. Die EU hat bereits ein Defizitverfahren eingeleitet.
Doch die Zahlen sind nur ein Teil des Problems. Politisch steckt das Land in einer Dauerkrise. Regierungen stolpern von Vertrauensabstimmungen zu Neuwahlen, wichtige Reformen scheitern an Protesten und der gesellschaftliche Widerstand gegen Einschnitte ist ungebrochen.
Die Finanzmärkte reagieren zunehmend skeptisch. Die Ratingagentur Fitch hat Frankreich von AA– auf A+ herabgestuft, Moody’s korrigierte den Ausblick auf negativ.
Besonders symbolträchtig war der September 2025: Erstmals rentierten französische Zehnjahresanleihen höher als italienische – ein Signal, das Analysten als „historischen Wendepunkt“ einstuften. Frankreich, einst verlässlicher Anker der Eurozone, wird von Investoren nicht mehr automatisch als sicher bewertet. Das ist brisant: Als zweitgrößte Volkswirtschaft Europas ist Frankreich systemrelevant. Gerät Paris ins Wanken, wären die Folgen weit gravierender als während der Griechenland-Krise.
Das Ende des billigen Geldes: Wie steigende Zinsen Europa verwundbar machen
Die Lage verschärft sich, weil die geldpolitischen Rahmenbedingungen ungemütlicher geworden sind. Nach den drastischen Zinserhöhungen der Jahre 2022 bis 2024 hat die EZB zwar leicht gelockert – doch von einer Rückkehr zur Nullzinswelt kann keine Rede sein. Die Zinsen bleiben hoch genug, um verschuldete Staaten spürbar zu belasten. Gleichzeitig ist die Inflation zwar wieder nahe 2-Prozent, aber das Zeitalter des nahezu kostenlosen Geldes ist vorbei. Besonders gefährlich: Viele Staaten haben während der Niedrigzinsphase langfristige Anleihen zu extrem niedrigen Zinsen ausgegeben. Diese Altpapiere laufen jetzt nach und nach aus – und müssen durch deutlich teurere ersetzt werden.
Was für private Haushalte ein bekanntes Problem ist – der günstige Kredit läuft aus, der neue ist teurer – gilt für Staaten in Milliardenhöhe. Das führt zu einem Dominoeffekt: Steigende Finanzierungskosten, weniger Spielraum in den Haushalten, wachsende Skepsis der Märkte, noch höhere Refinanzierungskosten.
Ein System unter Stress: Mehrere Länder könnten kippen
Genau diese Dynamik macht die Lage der Eurozone so gefährlich – und sie geht weit über Frankreich hinaus. Denn die EU-Schuldenbasis ist heute deutlich größer als 2010. Damals lag die durchschnittliche Quote bei rund 85-Prozent des BIP, heute sind es knapp 90-Prozent.
Neben Frankreich (115-Prozent) gibt es weitere Schwergewichte: Griechenland mit rund 150-Prozent, Italien mit 140-Prozent, Belgien mit gut 106-Prozent – alles Länder, die bei steigenden Zinsen besonders unter Druck geraten. Jeder zusätzliche Prozentpunkt Zinssteigerung trifft dadurch auf eine viel höhere Schuldenlast als früher. Die Folge: Nicht nur Frankreich wird verwundbarer, sondern das gesamte Gefüge der Eurozone.
Droht eine neue Eurokrise? Was Experten sagen
Kein Wunder, dass Begriffe wie „Eurokrise 2.0“ und „Schuldenkrise Reloaded“ wieder durch die Debatte geistern. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt in einem aktuellen Bericht, Europa könne ohne „mutige Entscheidungen“ „bald von einer neuen Staatsschuldenkrise erfasst werden“. Für Unternehmen und Verbraucher wäre das alles andere als abstrakt: Kredite würden teurer, Investitionen verschoben, Arbeitslosigkeit könnte steigen – und das Vertrauen in die Stabilität Europas bekäme einen empfindlichen Schlag.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hingegen zeichnet ein weniger dramatisches Bild. Die Lage sei angespannt, aber nicht mit 2010 vergleichbar. Zwar belastet die Mischung aus hohen Zinskosten, schwachem Wachstum und politischer Blockade die Eurozone spürbar – und Frankreich bleibt ein Risikofaktor, den niemand ignorieren kann.
Doch die institutionellen Schutzmechanismen sind heute deutlich stärker als vor 15 Jahren.
Entsprechend widerspricht die EZB dem zugespitzten Krisennarrativ – zumindest vorerst. Die Finanzmärkte seien „ruhig und geordnet“, erklärte jüngst ein Sprecher; die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen im Euro-Raum seien „derzeit kein Anlass zur Sorge“.
Warum die Eurozone heute widerstandsfähiger ist
Was stimmt: Die Eurozone ist heute besser vorbereitet, weil die Schutzmechanismen stärker sind. Das wichtigste Werkzeug: Das Transmission Protection Instrument (TPI). Wenn die Zinsen einzelner Länder plötzlich stark steigen, kann die EZB direkt eingreifen und deren Anleihen kaufen. Die Bundesbank nennt das die Sicherung der „effektiven Transmission der Geldpolitik“. Übersetzt heißt das: Die EZB verhindert, dass einzelne Länder durch spekulative Marktbewegungen an die Wand gedrückt werden.
Auch die gemeinsame Schuldenaufnahme der EU macht die Eurozone stabiler. Mit Next Generation EU hat Brüssel erstmals Anleihen ausgegeben, für die alle Mitgliedstaaten gemeinsam haften. Diese Papiere gelten bei Investoren als besonders sicher und halten Kapital im europäischen Markt.
Der Bankensektor ist ebenfalls robuster: Mehr Eigenkapital, strengere Aufsicht, regelmäßige Stresstests. Das reduziert die Gefahr, dass Staatsschuldenkrisen automatisch Bankenkrisen auslösen – der gefährlichste Mechanismus der Eurokrise von 2010.
Kehrt die Eurokrise zurück? Nicht wie damals – aber vielleicht anders
Doch verschwunden sind die Risiken damit nicht – sie wandeln sich – und sie steigen teilweise sogar. Die Schuldenstände sind höher als 2010, die politischen Konflikte tiefer, die Zinsen belastender. Für die Eurozone bedeutet das: Je länger Regierungen Strukturreformen aufschieben, desto unruhiger werden die Märkte – und desto stärker nähert sich die Dynamik der alten Eurokrise an.
Gleichzeitig ist die Architektur des Euroraums stabiler geworden. Mit TPI und gemeinsamen Anleihen steht ein Instrumentenkasten bereit, der eine abrupte Eskalation wie 2010–2012 weniger wahrscheinlich macht. Realistischer als der große Knall ist daher ein anderes Szenario: Eine Phase dauerhafter Spannung – ein Europa im Zustand permanenter Krisenbereitschaft. Ein Kontinent, der zwischen Reformdruck, politischer Blockade und nervösen Märkten pendelt. Ein Schuldenniveau, das immer wieder aufflammt, ohne zu explodieren.
Die eigentliche Gefahr wäre dann kein plötzlicher Eurozerfall – sondern ein verlorenes Jahrzehnt: Geringes Wachstum, hohe Zinsen, politische Blockaden wären für Bürger und Unternehmen kaum weniger belastend.
Welchen Weg Europa einschlägt, entscheidet sich maßgeblich in Paris. Wenn sich Frankreich stabilisiert, kann Europa durchkommen. Wenn nicht, könnte die Schlagzeile „Eurokrise 2.0“ schnell zur Realität werden.