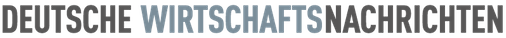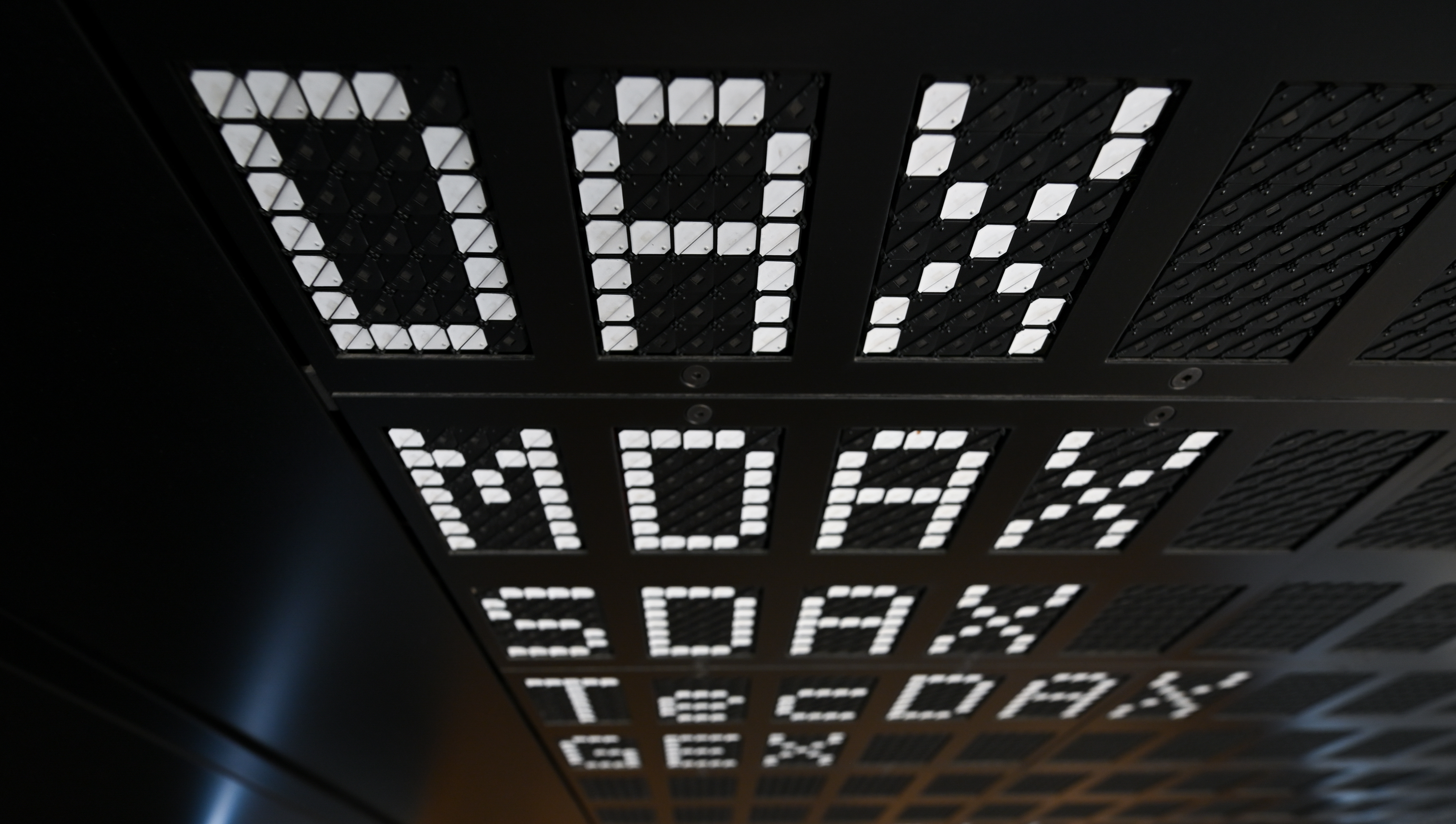Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie lange waren Sie in Afghanistan, in welcher Funktion und welche Erfahrungen haben Sie dort gesammelt?
Thomas Sarholz: Von November 2005 bis April 2006 war ich im Rahmen des 9. und beginnenden 10. Deutschen Einsatzkontingents Kommandant von Camp Warehouse, dem damals größten internationalen Camp in Kabul. Ich war, gemeinsam mit meinen beiden Mitarbeitern, mit der Organisation des Camps für circa 2.400 Soldatinnen und Soldaten aus mehr als 20 Nationen betraut. Operative Aufgaben, so der Einsatz von Soldaten außerhalb des Camps, gehörten nicht zu meinen Aufgaben.
Die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Soldaten aus unterschiedlichen Nationen stellte hohe Anforderungen an menschliches Einfühlungsvermögen, diplomatisches Geschick, zuweilen waren aber auch klare Ansagen an Unbelehrbare vonnöten. Dass ich diesen Anforderungen aus der Sicht meiner Vorgesetzten offenbar gerecht wurde, davon zeugen ein Beurteilungsbeitrag aus der Feder des damaligen Chefs des Stabes des Deutschen Einsatzkontingents, eine Förmliche Anerkennung durch den Kontingentführer sowie ein "Letter of Application" durch den Kommandeur der "Kabul International Brigade", ein italiensicher Brigadegeneral (Alpini), der später zum Chef des Generalstabs des Italienischen Heeres aufsteigen sollte.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie beurteilen Sie den Einsatz der Bundeswehr? Was hat sie erreicht und was hätte sie realistischerweise erreichen können?
Thomas Sarholz: Vorausschicken muss ich, dass meine persönlichen Erfahrungen die Situation von vor 16 Jahre widerspiegeln. Was nach meiner Verwendung dort geschehen ist und mit welchen Intentionen, entzieht sich meiner persönlichen Kenntnis. Hier bin ich, wie viele andere auch, auf allgemein zugängliche Quellen angewiesen.
Die weit überwiegende Mehrheit der damals dort eingesetzten Soldatinnen und Soldaten hat diesen Einsatz mit einem hohen Grad an Professionalität, Engagement und Idealismus durchgeführt. Wir haben einen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitslage geleistet und uns bemüht, dass gerade wir deutschen Soldaten nicht als Besatzer, sondern als Helfer agieren und als solche angesehen wurden.
Nach den Jahren der Talibanherrschaft erschien es zunächst nicht aussichtslos, zumindest in bescheidenem Umfang auf die Bevölkerung einzuwirken mit dem Ziel, eine demokratische Ordnung vorzubereiten. Nicht nur letzteres hat sich leider als Wunschdenken herausgestellt, was ich damals nicht vorausgesehen habe. Darin dürfte ich nicht der Einzige gewesen sein. Mein Fazit: Der internationalen Gemeinschaft ist es nicht einmal ansatzweise gelungen, auf weite Teile der afghanischen Gesellschaften einzuwirken oder gar einzudringen. Dass eine hauchdünne Oberschicht dies möglicherweise - äußerst dosiert - erlaubt hat, ändert nichts an der grundsätzlichen Beschreibung.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: War die Kontaktaufnahme zu der einheimischen Bevölkerung erfolgreich? Oder herrschte auf Seiten der einheimischen Bevölkerung Angst und Misstrauen vor?
Thomas Sarholz: In Leserbriefen an die FAZ sind mir von zwei Ärzten mit Afghanistan-Erfahrungen Vorwürfe ob meiner Einschätzung von Ortskräften gemacht wurden. Darüber hinaus wird mir vorgehalten, wegen meines Verweilens in der „Wagenburg“ Camp Warehouse keine Ahnung von der örtlichen Bevölkerung zu haben – geschweige denn mit dieser in Kontakt gekommen zu sein.
Darauf möchte ich wie folgt antworten: Obwohl ich als Kommandant im Dienstgrad Oberst überwiegend vor Ort zu sein hatte, habe ich dennoch jede Gelegenheit genutzt, um u.a. als „normaler“ Soldat Patrouillen mitzulaufen. So konnte ich dem Camp-Einerlei zumindest für einige Stunden, manchmal auch einen Tag entkommen. Nach anfänglicher Reserve unserer jungen deutschen Infanterie-Soldaten, einen in die Jahre geratenen Oberst offenbar bespaßen zu sollen, drehte sich diese Reserve in Sympathie. Warum? Dem Alter wird in Afghanistan überwiegend mit Respekt begegnet. Auf Grund meines Alters, meiner grauen Haare etc. hatte ich leichteren Zugang zur Bevölkerung.
Ein Beispiel: Wir kommen an ein Gehöft. Das Familienoberhaupt, ein würdiger älterer Herr, wird aus dem Haus geholt, um den fremden Soldaten gegenüber zu treten. Ich wende mich, Helm ab und ohne Sonnenbrille, Gewehr auf dem Rücken dem Herrn zu. Mit Händen und Füßen gelingt die Kommunikation. Er wird neugierig und er versucht herauszufinden, ob ich so sei wie er. Dazu fasst er mich an, schiebt einen Ärmel meiner Jacke hoch, tastet meinen Arm ab und zieht, ich bin stark behaart, an den Haaren meines Unterarms. Jetzt ist er überzeugt, ich bin ein Mensch wie er. Daraufhin wird alles ganz einfach: Er führt mich herum, zeigt mir seine Tiere sowie die um das Haus gelegenen kleinen Felder inklusive Bewässerungsanlagen, auf denen Gemüse etc. angebaut wird. (Von den Frauen der Familie haben wir natürlich keine zu sehen bekommen; das wäre auch zu viel Erwartungshaltung gewesen.)
Fast hätte ich vergessen, das Abnehmen der Sonnenbrille zu erklären. Warum? In unserem Kulturkreis gilt es als unhöflich, bei persönlichen Gesprächen eine Sonnenbrille zu tragen. In Afghanistan hatte das Abnehmen der Sonnenbrille noch eine weitaus wichtigere Bedeutung. Weiten Teilen der Bevölkerung war von spezifischen Interessengruppen (Taliban, Kriminelle etc.) eingeredet worden, wenn Soldaten die bekannten verspiegelten Sonnenbrillen trügen, könnten sie den Frauen unter die Bekleidung schauen. Dieser haarsträubende Unsinn wurde von der Bevölkerung allen Ernstes geglaubt. Wir haben dann vor allem die afghanischen Kinder, die sich damals neugierig um uns Soldaten scharten, durch die Brillen schauen lassen. Diese haben dann ihren Familien davon erzählt und zur Aufklärung beigetragen.
Eine andere Episode ist mir unvergesslich: Ich hatte mich einer Patrouille mit KFZ angeschlossen, die sich in ostwärtige Richtung - nach Pakistan - bewegte. Bei einem Halt begegneten wir einem Jungen, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt. Er konnte wohl ein wenig Englisch oder der uns begleitende Dolmetscher half bei der Kommunikation. Er berichtete, er komme aus dem Gebirge und bringe mit seinen vier kleinen Eseln Heu ins Tal. Wir unterhielten uns weiter über Land und Leute, die Bevölkerungsstruktur der Gegend, aus der er stamme, etc.
Zum Abschied gab ich ihm als Dank eine Tafel Schokolade. Dort eine Kostbarkeit. Er akzeptierte dieses Geschenk mit einer Würde, die mir auch heute noch den Atem stocken lässt. Aus jeder Pore war spürbar, er gehörte einer Volksgruppe an, die über ihre eigene, festgefügte Tradition verfügte, für die sie Anerkennung und Respekt erwarteten und auch erwarten konnten.
Mein Fazit: zum damaligen Zeitpunkt war es möglich, mit der Bevölkerung in Kontakt zu treten, sofern man ihre Traditionen respektierte und ihre Würde wahrte.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie verlief die Zusammenarbeit mit den einheimischen Helfern?
Thomas Sarholz: Die Zusammenarbeit vollzog sich in der Regel problemlos. Zuweilen gab es Nachfragen zur Verlegung von Arbeitszeiten, da der ein oder andere sich an den Ausbildungsstätten in Kabul z.B. in Sprachen weiterbilden wollte.
Von deutscher Seite wurde alles getan, um ihnen zu helfen, was ich in einem Leserbrief an die FAZ auch zum Ausdruck gebracht habe. Ergänzend sei erwähnt: Afghanistan ist ein äußerst energiearmes Land. Ich habe in Kenntnis dieser Situation Holz, das z.B. als Verpackungsmaterial angefallen war, sammeln lassen, um es unseren Helfern zu überlassen. Wenn eine entsprechende Menge zusammengekommen war, erschienen diese mit einem Kleinlaster, um es abzuholen: eine wertvolle Hilfe als Heizmaterial und zum Kochen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Haben sich die einheimischen Helfer darauf verlassen, nach ihrer Tätigkeit nach Deutschland einreisen zu können?
Thomas Sarholz: In dem von mir zu übersehenden Zeitabschnitt, November 2005 bis April 2006, war festgelegt: "Wir machen nur Zusagen, die wir vor Ort und mit eigenen Mitteln umsetzen konnten." Alles andere hätte unsere Glaubwürdigkeit erschüttert. Exakt dies galt es zu vermeiden. Wer, auf welcher Rechtsgrundlage, wem, wann, die Bundesrepublik Deutschland bindende Zusicherungen zur Verbringung von Ortskräften nach Deutschland abgegeben hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Was und wie könnte die deutsche Politik aus dem Scheitern ihres Afghanistan- Einsatzes lernen?
Thomas Sarholz: Afghanistan ist eine Stammesgesellschaft. Das Überleben des Einzelnen ist von seiner Familie, seinem Stamm, seinem Clan abhängig. Dem ist alles unterzuordnen. Und das unterscheidet Afghanistan grundlegend von unseren „westlichen Gesellschaften“. Das Ziel, eine Ordnung nach westlichem Vorbild zu etablieren, war also nicht zu erreichen. Ich räume jedoch ein, dass auch ich hier einer Fehleinschätzung erlegen bin. Nach dem Ende der Taliban (Schreckens-) Herrschaft hatte ich die Hoffnung, dass die Afghanen einer Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse aufgeschlossen gegenüberstehen würden.
Samuel P. Huntington hat in seinem ebenso vielbeachteten, wie auch heftig umstritten Werk „Clash of Civilazations“ darauf hingewiesen, dass die westlichen Gesellschaften aufgrund ihrer technischen Überlegenheit nicht davon ausgehen könnten, dass andere Kulturen nicht nur die Technik, sondern auch deren Kultur übernehmen würden.
Auch Peter Scholl-Latour wurde nicht müde zu betonen, dass der Westen einer Fehleinschätzung erliege, wenn er glaube, seine Kultur werde sich langfristig durchsetzen. Das Gegenteil ist, wie wir schmerzlich erleben mussten, geschehen: Nach einer gewissen Phase der Aufgeschlossenheit gegenüber Veränderungen in der islamischen Welt erfolgte die Rückkehr zur alten, vertrauten Ordnung.
Künftig sollten wir darauf achten, realistische Ziele zu formulieren und uns von der Illusion zu verabschieden, anderen Kulturen die unsere überstülpen zu können.
*****
Info zur Person: Oberst a. D. Dr. Thomas Sarholz ist promovierter Historiker und war in den Jahren 2005 / 2006 Kommandant im afghanischen „Camp Warehouse“. Es folgten Einsätze in der Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan.