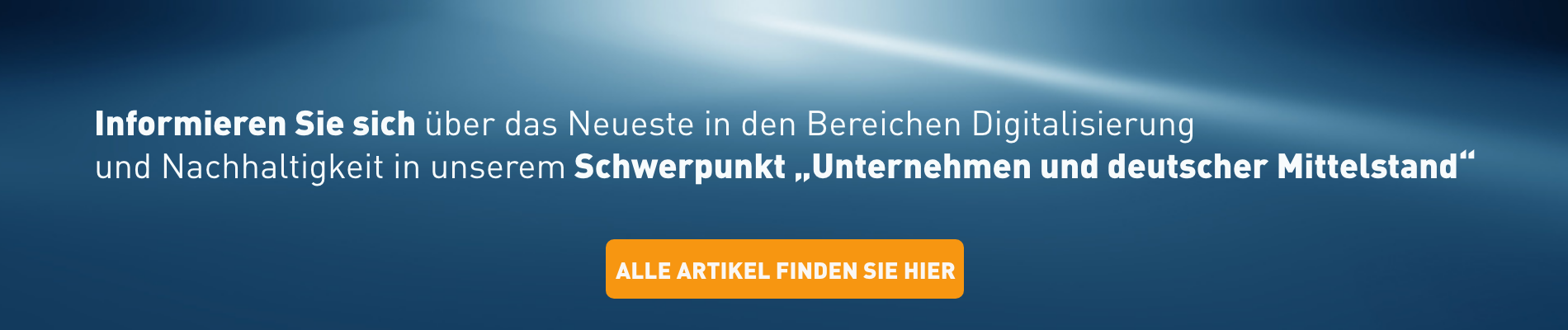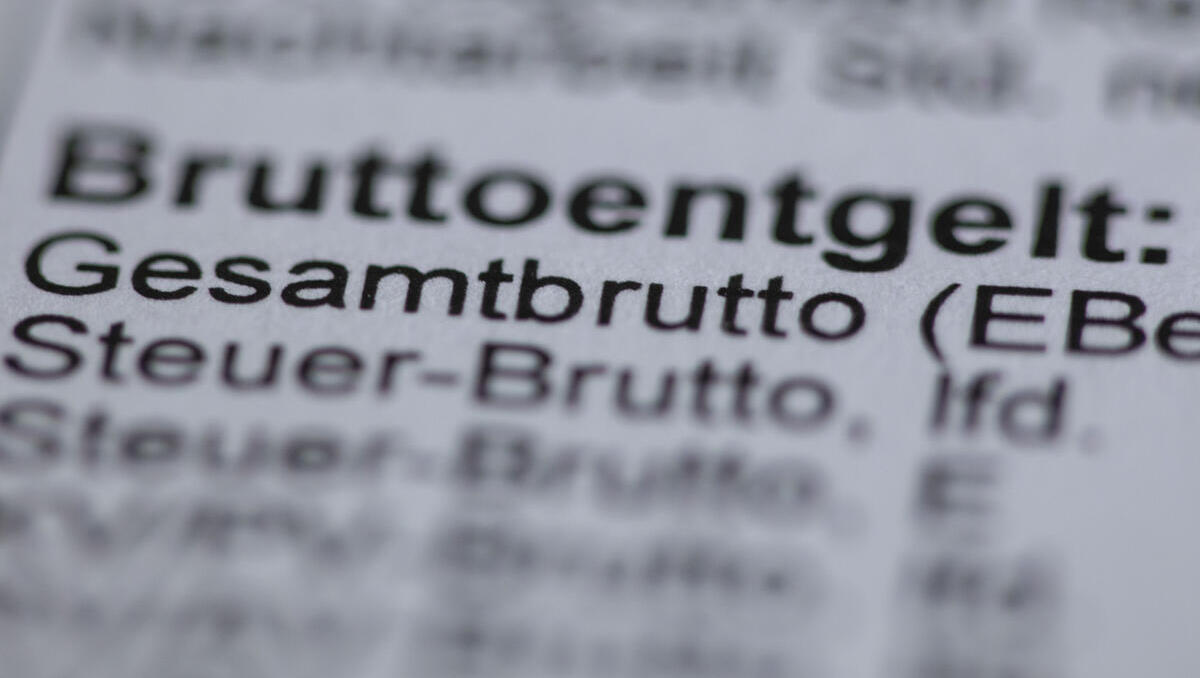Windkraft Deutschland
AfD-Frontfrau Alice Weidel tönte kürzlich auf dem Parteitag in Riesa, "alle Windräder niederreißen" zu wollen. "Nieder mit diesen Windmühlen der Schande", rief sie unter johlendem Applaus. Später erklärte Weidel, diese Aussage ausschließlich auf Windräder im Reinhardswald bezogen zu haben.
Fakt ist, dass die Energiewende und damit auch Windkraftanlagen einigen Menschen nicht passen. Manchmal gibt es dafür gute Gründe, oft stehen sie aber auch symbolisch für den Feind, die "linksgrünversifften" Gutmenschen, infiziert vom woken Mindvirus. Klingt etwas sehr an den Haaren herbeigezogen, führt aber zu Wahlerfolgen, denn Menschen mögen keine Veränderungen, und noch weniger mögen sie Vorschriften bürokratischer Natur, und eine Veränderung durch Vorschriften scheint ihnen aktuell wohl als das Schlimmste, Verachtenswerteste und Übelste auf Gottes weiter Welt - noch vor Folter, Krieg und Mord.
Von daher hat Windkraft es schwer. Dabei ist sie besser als ihr Ruf. Davon hat beispielsweise der neue US-Präsident noch nichts gehört.
Trump hasst Windkraft
Mit dem Slogan "Drill, Baby, drill" (zu Deutsch: Bohr, Baby, bohr) führte Donald Trump Wahlkampf - und gewann. Damit bekräftigte der neue, alte US-Präsident seine Ansicht, das Land benötige mehr fossile Energie und müsse weiter nach Öl und Gas bohren. Von erneuerbaren Energien hält Trump wenig – vor kurzem forderte er europäische Länder auf, ihre Windanlagen in der Nordsee abzubauen - die kommen nämlich amerikanischen Ölförderunternehmen in die Quere.
Nach eigenen Angaben will Trump in seiner Amtszeit den Bau neuer Windräder in den USA komplett untersagen. Windturbinen seien ein "ökonomisches und ökologisches Desaster", schrieb er in seinem Netzwerk "Truth Social". "Ich will nicht einmal eine einzige während meiner Regierung gebaut sehen", so Trump. Er behauptete außerdem, Wind sei "die teuerste Energie" und funktioniere nur "mit massiven Staatssubventionen, die wir nicht weiter zahlen werden". Diese Aussagen sind jedoch falsch. Tatsächlich sind Wind- und Solarenergie über die Lebensdauer der Anlagen gerechnet günstiger herzustellen als Energie aus fossilen Quellen. Und sie spielen selbst in den USA schon eine große Rolle.
Wieviel Sinn ergibt es, Windkraftanlagen abzureißen?
Laut dem US-Energieministerium gab es 2023 mehr als 90.000 Windräder auf US-Staatsgebiet. Die Windkraft wird weiterhin von der US-Bundesregierung gefördert, vor allem durch Steuervorteile. Ein Bericht des US-Kongresses zeigt, dass sich die Kosten dieser Förderung zwischen 2019 und 2023 auf 17,9 Milliarden Dollar (nach aktuellem Kurs 17,4 Milliarden Euro) beliefen. Von Investitionen in erneuerbare Energien profitieren auch Regionen, die von Trumps Verbündeten kontrolliert werden. Besonders in republikanisch regierten Staaten wie Texas entstanden durch die Erneuerbaren zahlreiche Arbeitsplätze. Der wirtschaftliche Nutzen ist dort erheblich. 2023 produzierte Texas fast 30 Prozent des in den USA erzeugten Windstroms.
Tausende defekte oder stillgelegte Anlagen sollten "so schnell wie möglich abgerissen werden", sagte Trump. Erneuerbare Energien waren in den USA zuletzt die am schnellsten wachsenden Segmente des Stromnetzes, so das Energieministerium. Neben staatlichen Vorgaben und technologischem Fortschritt trugen auch Steuervergünstigungen unter der Biden-Regierung entscheidend zum Ausbau von Solar- und Windenergie bei. Schneidet sich Trump womöglich ins eigene Fleisch?
Windenergie in Deutschland
Die Bedeutung der Windenergie geht weit über ihren Anteil am Strommix hinaus, betont BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek: "Wir tragen die Verantwortung für das Gesamtsystem, und die Frage ist: Wie können wir dem gerecht werden?" Denn Windenergie an Land ist de facto das Rückgrat einer klimaneutralen Stromversorgung in Deutschland. Im Jahr 2024 erzeugten Onshore-Windkraftanlagen 111,9 TWh, was 25,9 Prozent der gesamten Stromerzeugung entsprach. Damit war Windenergie der stärkste einzelne Energieträger im deutschen Strommix, wie die Fachagentur Wind und Solar berichtet.
"Von der rechtlichen Frage des Eigentums einmal abgesehen: 2024 kam knapp ein Drittel der gesamten Stromerzeugung Deutschlands aus Windkraftanlagen. Auch der AfD würde ein Blick auf die Fakten guttun", sagt Vattenfall-Chef Zurawski. Windkraft genieße eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung.
"Jede Abkehr von der Windkraft und ihrem Ausbau führt in eine Energiesackgasse", sagte VDMA-Geschäftsführer Rendschmidt mit Blick auf CDU-Chef Friedrich Merz, der die Windenergie als "Übergangstechnologie" bezeichnete. Vom Abriss aller deutschen Windkraftanlagen ganz zu schweigen. "Wir müssen Unsicherheiten im Markt vermeiden", betonte er.
Akzeptanz der Windenergie
Menschen schätzen es im Allgemeinen nicht, wenn man Ihnen etwas vors Haus baut, ohne sie vorher zu fragen - auch keine Windkraftanlagen. Zwar befürworten die meisten Deutschen den Ausbau von Windkraft. Laut einer Forsa-im Auftrag der Fachagentur Wind und Solar e. V. (FA Wind und Solar) sind 79 Prozent der 1.002 Befragten mit den Anlagen einverstanden. Über zwei Drittel (67 Prozent) haben keine oder nur geringe Bedenken gegenüber Windkraftanlagen, wenn diese im eigenen Wohnumfeld gebaut werden sollten. Aber so ganz einverstanden sind dann letztlich doch nicht alle. Die teilweise mangelnde Akzeptanz von Windkraftanlagen rührt möglicherweise auch daher, dass aktuell die Kommunen und Bürger nicht an den Gewinnen der Anlagen beteiligt werden müssen – außer in Sachsen, wo Mitte 2024 das „Gesetz zur Ertragsbeteiligung von Kommunen an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen“ (Drs 7/15920) beschlossen wurde. Dadurch werden die Kommunen in Sachsen künftig an den Gewinnen von Windkraft- und PV-Anlagen beteiligt. Dr. Daniel Gerber, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Sächsischen Landtag, sagt dazu: „Mit dem Beteiligungsgesetz sorgen wir dafür, dass künftig überall dort, wo Windkraft- und PV-Anlagen gebaut werden, auch die Kommunen und ihre Bürgerinnen und Bürger von den Gewinnen profitieren. So kann beispielsweise jedes Windrad Jahr für Jahr rund 30.000 Euro in die Gemeindekassen spülen. Diese Gelder entlasten die Kommunen und schaffen neue Spielräume: So können zum Beispiel Schwimmbäder eine neue Perspektive bekommen, Sportvereine stärker unterstützt und die Kommunen als Lebensorte aufgewertet werden.“
Ursprünglich war in dem Gesetz auch eine direkte Beteiligung der Bürger vorgesehen gewesen, wurde durch heftigen Gegenwind der Opposition aber wieder herausgestrichen. Die Windkraftbetreiber können die Kommunen und Bürger freiwillig beteiligen, was nach Ansicht der FDP auch vollkommen ausreicht. Die Frage ist, wieviel Beteiligung dadurch entsteht, das große Konzerne kleinen Kommunen etwas abgeben dürfen. Ein bundesweites Beteiligungsgesetz wäre da schon praktisch: Man stelle sich vor, dass die blinkenden, lauten und rotierenden Dinger nicht mehr irgendeinem fernen Investor gehörten, sondern jede Drehung des Rades einem selbst mehr Geld in die Taschen weht.
Was das wohl für die Akzeptanz der Energiewende täte?
Windkraftanlage Privat
Viele Menschen interessieren sich auch für private Windkraftanlagen für zuhause. Mit einer privaten Windkraftanlage lässt sich Energie für die Selbstversorgung und Einspeisung ins öffentliche Stromnetz erzeugen. Man unterscheidet zwischen Windkraftanlagen mit vertikalen und horizontalen Rotorachsen. Die Rotorblätter haben meist eine Spannweite zwischen zwei und drei Metern. Privat genutzte Windkraftanlagen haben meist eine Nennleistung von rund fünf Kilowatt, maximal 30 Kilowatt. Sie sind üblicherweise zehn bis 20 Meter hoch. In Deutschland gibt es Vorschriften und maximale Größen für private Windkraftanlagen, die je nach Bundesland und lokalen Gesetzen variieren.
Lohnt sich das?
Da die Technik sich noch nicht etabliert hat, ist sie verhältnismäßig teuer. Pro Kilowatt installierter Leistung ist mit Kosten von durchschnittlich 5.000 Euro zu rechnen. Hinzu kommen jährliche Instandhaltungs- und Wartungskosten von etwa drei Prozent der Investitionssumme. Eine private Windkraftanlage mittlerer Größe von 5 Kilowatt amortisiert sich somit oft erst nach 15 oder mehr Jahren. Wann genau und ob überhaupt, hängt von mehreren Faktoren ab:
- Wie windintensiv ist der Aufstellungsort? Möglich sind bis zu 1000 Kilowattstunden pro Jahr.
- Wie hoch sind die Kosten für den üblichen Haushaltsstrom in der Region?
- Was muss man für Installations-, Betriebs- und Wartungskosten bezahlen?
Es lohnt sich also nur bedingt für manche Menschen. Wer mit einem Miniwindkraftwerk privat Strom erzeugen will, stellt schnell fest: Die Wirtschaftlichkeit ist schwer messbar und hängt stark vom Standort ab.
Warum stört die Windkraft?
Aktuell jedenfalls kursieren noch viele Halbwahrheiten darüber – vom Thema Vogelsterben über Infraschall bis zur Umweltfreundlichkeit der verwendeten Materialien. Eine Liste davon, verbunden mit Antworten auf die Frage: Was steckt da Wahres drin?
Vogelsterben: Windkraftanlagen töten Vögel
Die Flügelspitzen von 50-Meter-Rotoren erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 340 Kilometern pro Stunde. Das ist so schnell, dass Vögel nur schwer reagieren können. Während des Flugs haben Vögel ihren Blick nach unten gerichtet, etwa auf der Suche nach Beute. Besonders gefährdet sind dabei Greifvögel wie Rotmilan, Mäusebussard oder Seeadler.
Wie viele Vögel jedes Jahr durch Windkraft getötet werden, lässt sich allerdings nicht genau sagen. Es kursieren teils unbelegte Zahlen. Beispielsweise schätzt der Naturschutzbund Deutschland (NABU), dass jährlich etwa 100.000 Vögel durch Windkraftanlagen sterben. Doch die genaue Zahl der Todesfälle und deren Ursachen sind schwer messbar. Denn die Schätzungen beruhen auf Zufallsfunden. Sie zeigen nicht die tatsächliche Anzahl der getöteten Vögel, sondern nur die, die von Forschern gefunden wurden – sofern die Vogelleiche nicht zuvor von einem anderen Tier gefressen oder von Menschen beseitigt wurde.
Vergleiche, wie viele Vögel durch Windkraftanlagen im Vergleich zu Glasscheiben oder Strommasten sterben, halten Experten daher nicht für zielführend. Die Schätzungen sind zu wenig belastbar, und je nach Gefahrenquelle sind unterschiedliche Arten betroffen. Gerne wird etwa ins Feld geführt, dass jährlich rund 70 Millionen Vögel dem Bahn- und Straßenverkehr zum Opfer fallen, weitere 20 bis 100 Millionen Vögel durch Hauskatzen getötet werden und 18 Millionen Vögel daran sterben, dass sie gegen Glasscheiben fliegen – Bushaltestellen nicht eingerechnet. Derlei Schätzungen sind aber, wie gesagt, wenig belastbar. Klar ist aber: Windräder sind tatsächlich eine Gefahr für einige Vogelarten.
Auch Vogelschützer für Windkraft
Dennoch sprechen sich inzwischen auch Vogelschützer für diese erneuerbare Energiequelle aus, etwa der Landesbund für Vogelschutz (LBV). Diese Interessengruppe war früher gegen Windräder, plädiert heute aber für Windkraft. Denn die Klimakrise ist eine noch viel größere Gefahr für die Artenvielfalt. Modellrechnungen zeigen, dass der Klimawandel zu einem Artensterben führen wird, das die Verluste durch Windräder bei weitem übertrifft. Für viele Arten werde es durch den Klimawandel schlicht zu trocken oder zu heiß, sodass sie nicht mehr genug Nahrung finden oder in andere Regionen ziehen müssen.
Ein Beispiel ist die Bekassine: Diese Vogelart hat einen langen Schnabel, um damit in feuchten Böden nach Nahrung zu bohren. Wenn der Boden austrocknet, fehlt ihr die Nahrungsquelle. Andere Arten leiden darunter, dass Baumarten bei steigenden Temperaturen absterben, wodurch Lebensräume verschwinden.
Es macht daher wenig Sinn, Klimaschutz und Artenschutz gegeneinander auszuspielen. Vielmehr sei der Standort der Windräder entscheidend, sagt Andreas von Lindeiner vom LBV. So könne man schon bei der Planung prüfen, ob ein Windrad in den Flugbahnen bestimmter Vogelarten liege. Welche Kriterien das genau sind, ist je nach Art sehr unterschiedlich, so von Lindeiner. Doch dazu gebe es zahlreiche Studien. So lasse sich etwa belegen, dass der Rotmilan sich meist nicht weiter als 1,5 Kilometer von seinem Horst entfernt. Wird beim Windradbau dieser Mindestabstand eingehalten, sinkt das Risiko bereits erheblich.
Platz für Windkraft trotz Artenschutz?
Doch macht die Einhaltung solcher, teils spezifischer Abstände es schwierig, ausreichend Fläche für Windkraft zu finden? Flächen, die Artenschutz-Kriterien erfüllen, gibt es in Deutschland genug, sagt von Lindeiner. Zumindest, wenn man nicht über ganz Deutschland verstreut einzelne Windräder baut, sondern auf geeigneten Flächen konzentriert ganze Windparks errichtet.
Das sieht auch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) so: Um Beeinträchtigungen für den Bestand von Vogel- oder Fledermausarten zu minimieren, sind entsprechende Gutachten vorgeschrieben. Einige Landschaftsarten sollten nach Ansicht des BfN grundsätzlich windkraftfrei bleiben:
- Naturnahe Wälder mit altem Baumbestand
- Bestimmte Schutzgebiete (Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten)
- Schutzzonen um bekannte Vogelhorste
- Gesetzlich geschützte Biotope
- Flusstäler und Wiesen, die als Lebensräume für Wiesenbrüter dienen
- Zugkorridore von Vögeln und Fledermäusen (zwischen Brut- und Nahrungsplätzen sowie zwischen Winter- und Sommerquartieren)
Das BRUMMEN: Problem Infraschall
Infraschall bezeichnet Töne, die unterhalb einer Frequenz von 20 Hertz liegen und die wir mit unserem Gehör nicht wahrnehmen können. Infraschall ist ein fester Bestandteil unserer Umwelt und kann sowohl aus natürlichen als auch technischen Quellen stammen. Zu den natürlichen Quellen zählen etwa Wind, Gewitter, Vulkane und Meteoriten. Klima- und Lüftungsanlagen, Kraftfahrzeuge, Kühlschränke sowie Windkraftanlagen sind Beispiele für technische Ursprünge von Infraschall.
Genau dieser Schall soll uns gesundheitlich beeinträchtigen, zu Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit führen. Hauptgrund für diese Annahme: Im Jahr 2009 veröffentlichte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) eine Studie, die Windrädern hohe Infraschallwerte zuschrieb. Diese Studie nahmen viele Windkraftgegner zum Anlass, um gegen die Stromerzeugung durch Windenergie zu protestieren. 2021 räumte die BGR jedoch ein, Rechenfehler gemacht zu haben. Durch eine fehlerhafte Umrechnung des Drucksignals in Schalldruckpegel wurden die Infraschallwerte von Windenergieanlagen etwa 4000-mal höher eingeschätzt als sie tatsächlich waren. Der heutige wissenschaftliche Konsens lautet: Windenergieanlagen haben keinen nennenswerten Einfluss auf die Infraschallbelastung der umliegenden Gebiete. Der Infraschall wird zudem meist von anderen natürlichen Umgebungsgeräuschen überdeckt und hat eine geringe Intensität, sodass wir ihn schon wenige hundert Meter entfernt nicht mehr wahrnehmen können.
Gefahr für die Natur durch Bau und Materialien?
Eine Windkraftanlage hat eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren, bis sie wieder abgebaut wird. Und was passiert dann mit den einzelnen Komponenten? Grundsätzlich müssen Windkraftanlagen nicht nach 20 oder 30 Jahren abgebaut werden wenn die finanzielle Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz abläuft. Sie können weiterhin betrieben werden. Ist dies nicht der Fall und eine Anlage muss abgebaut werden, können bis zu 90 Prozent der Komponenten in Recyclingkreisläufe zurückgeführt werden – beispielsweise metallhaltige Anlagenteile, die Elektrik, die Fundamente und der Turm. Hinzu kommt, dass immer mehr alte Anlagen aufgrund des technologischen Fortschritts durch neue, effizientere Anlagen ersetzt werden. Da moderne Anlagen wesentlich höhere Stromerträge liefern als ältere Modelle, kann künftig auf gleicher Fläche mit weniger, dafür leistungsfähigeren Anlagen deutlich mehr Strom erzeugt werden. Die Anzahl der Windkraftanlagen dürfte perspektivisch also nicht übermäßig steigen.
Problematisch war in der Vergangenheit das Recycling der Flügel, die aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehen. Doch auch diese lassen sich heute mit einem speziellen Verfahren wiederverwenden. Eine mobile Wasserstrahllanze zerteilt den Flügel in mehrere Teile, die anschließend in einer sogenannten Prallmühle in ihre Bestandteile zerlegt werden. So lassen sich aus einem Rotorblatt bis zu 15 Kubikmeter Holz zurückgewinnen.
Windenergie bringt doch nichts
Warum stehen Windkraftanlagen manchmal still? Mögliche Gründe sind natürlich eine Flaute - gegebenenfalls sogar eine Dunkelflaute. Aber auch Wartungs- und Reparaturarbeiten, Rücksichtnahme auf Brut- und Ausflugszeiten von Vögeln oder zu starker Wind, durch den zu viel Strom ins Netz eingespeist wird, können zum Stillstand führen. Auch zum Schutz der umliegenden Anwohner stehen Windkraftanlagen gelegentlich still. Zum Beispiel, wenn sie bei tiefstehender Sonne länger als 30 Minuten Schatten auf die umliegenden Häuser werfen.
Sind Windkraftanlagen überhaupt effizient? Die Antwort lautet: ja. Eine Windkraftanlage erzeugt nach etwa sieben Monaten so viel Energie, dass sie die Energie für den Bau, den Betrieb und den Rückbau bereits wieder hereingeholt hat. Jede weitere Betriebsstunde liefert sauberen Strom – "netto" und mindestens 20 Jahre lang. Für andere konventionelle Energieerzeugungsanlagen ist dies in dieser Form nicht möglich. Übrigens: Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme wäre eine Stromversorgung in Deutschland auch mit 100 Prozent erneuerbaren Energien möglich. Das liegt zum einen an der Intensivierung des europäischen Stromaustauschs und zum anderen an der intelligenten Infrastruktur, dem sogenannten Smart Grid.
Windräder verschandeln die Landschaft
Windkraftanlagen zerstören das Landschaftsbild, sagen viele. Keiner will eine Windkraftanlage direkt vor der Nase haben. Doch Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Historische Windmühlen etwa wurden nach ihrer Fertigstellung als störend empfunden und sind heute Teil unserer Landschaft und Sehgewohnheit. Warum sollten wir uns also nicht auch an Windkraftanlagen auf unseren Feldern und in unseren Wäldern gewöhnen? Und schon zwei Prozent der Fläche von ganz Deutschland reichen aus, um den erforderlichen Beitrag an Windenergie zu leisten - was also wieder für dezidierte Windparks statt vieler vereinzelter Räder spricht.
Besonders in wertvollen Laub- und Mischwäldern oder Schutzgebieten dürfen keine Windkraftanlagen errichtet werden, da diese von der Windnutzung ausgeschlossen sind. Oft werden nur kleine Flächen für die Riesen benötigt. Durch Schädlingsbefall oder Dürre geschädigte Waldflächen werden daher vorrangig für den Bau von Windparks genutzt. Um die Beeinträchtigung durch nächtliche Lichtsignale zu reduzieren, hat das Bundeskabinett im Jahr 2023 zudem die Pflicht zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung beschlossen. Deutschlandweit werden alle Windenergieanlagen nach und nach mit einer neuen Technologie ausgestattet. Diese erfasst ankommende Flugobjekte – wie Flugzeuge – mithilfe von Radar und schaltet die Lichtsignale nur bei Bedarf ein. Auf diese Weise kann die Lichtaktivität einer Windkraftanlage um rund 90 Prozent verringert werden.
Ausblick
VDMA-Geschäftsführer Dennis Rendschmidt forderte Anfang 2025 von der nächsten Bundesregierung, die Dynamik bei der Windkraft beizubehalten. "Der Windenergieausbau muss ungebremst weitergehen", sagte Rendschmidt. "Denn er sichert unsere Energieversorgung, senkt die Stromkosten und schafft Arbeitsplätze." Er kritisierte Politiker wie CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz, der sich in den vergangenen Tagen und Wochen gegen die Windkraft ausgesprochen hatten: "Das ist eine energiepolitische Sackgasse." Die scheidende Bundesregierung hat im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und im Windenergie-auf-See-Gesetz feste Ausbauziele für die kommenden Jahre formuliert:
• Bis 2030 soll sich die Leistung von Windkraftanlagen auf 145 Gigawatt mehr als verdoppeln.
• Bis 2045 soll die Windkraft 230 Gigawatt erreichen.
• Bei der Solarenergie sollen es 2030 bereits 215 Gigawatt sein.
• Bis 2045 soll die Leistung der Solaranlagen insgesamt 400 Gigawatt betragen.
Ausbau der Batteriespeicher im Plan
Für den Erfolg der Energiewende ist auch der Ausbau von Batteriespeichern entscheidend. Da Wind- und Sonnenenergie stark wetterabhängig sind, benötigen sie solche Speicher, um eine durchgängige Versorgung sicherzustellen. Wenn zu viel Strom erzeugt wird, kann dieser gespeichert und bei zu wenig Wind oder Sonnenschein wieder abgegeben werden.
In den kommenden Jahren wird ein deutlich höherer Bedarf an Batteriespeichern bestehen. Eine Studie des Fraunhofer Instituts für Solare Energiesysteme schätzt den Bedarf an Speicherkapazität für 2030 auf 104 Gigawattstunden – Ende 2023 gab es in Deutschland Speicher mit etwa 12 Gigawattstunden. Auch wenn die Speicherkapazität noch weit vom 100-Gigawattstunden-Ziel entfernt ist, hat sie in den letzten Jahren stark zugenommen: Ende 2020 gab es erst 2,3 Gigawattstunden. Derzeit sind weitere große Speicher im Bau – in Bollingstedt, Schleswig-Holstein, entsteht beispielsweise einer der größten mit 239 Megawattstunden Speicherkapazität.
Und noch ein Gedanken und/oder Gefühle anregendes Zitat von Autor und Satiriker Marc-Uwe Kling zum Schluss:
"Ja, wir könnten jetzt was gegen den Klimawandel tun, aber wenn wir dann in 50 Jahren feststellen würden, dass sich alle Wissenschaftler doch vertan haben und es gar keine Klimaerwärmung gibt, dann hätten wir völlig ohne Grund dafür gesorgt, dass man selbst in den Städten die Luft wieder atmen kann, dass die Flüsse nicht mehr giftig sind, dass Autos weder Krach machen noch stinken und dass wir nicht mehr abhängig sind von Diktatoren und deren Ölvorkommen. Da würden wir uns schön ärgern."