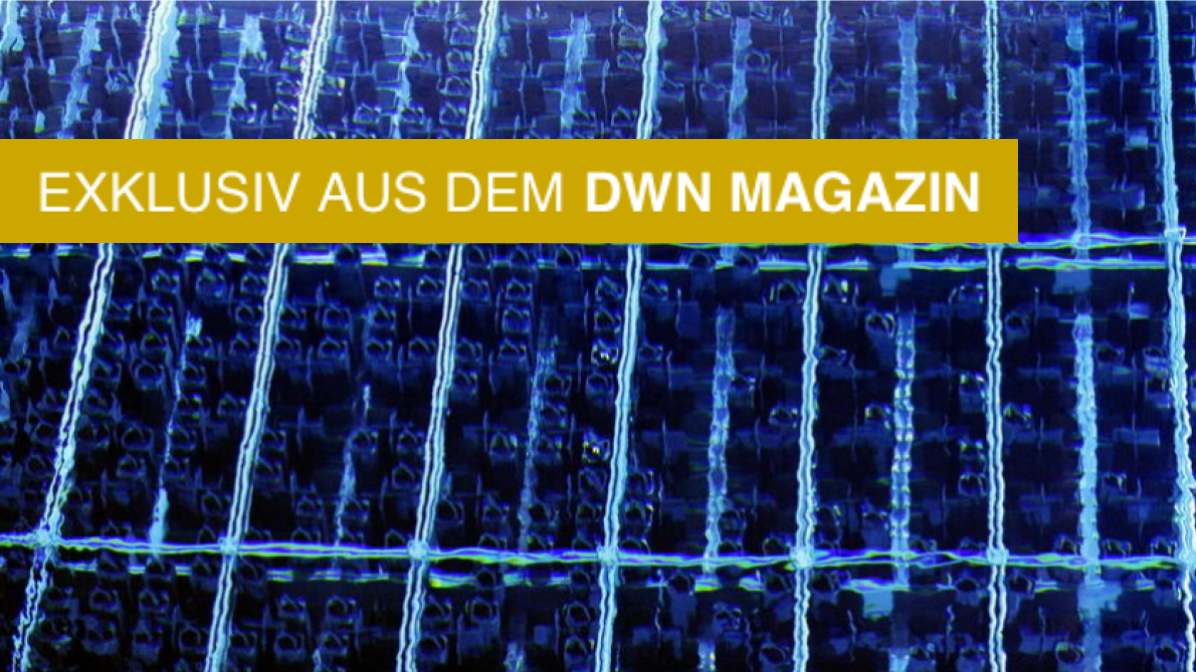Transmutation: Bedeutung und Chancen
Blei zu Gold machen, das war der Traum der Alchemisten im Mittelalter. Diese spezielle Transmutation ist mittlerweile technisch möglich, kostet aber so unglaublich viel Geld, Zeit und Energie, dass es sich zumindest noch nicht lohnt. Eine andere Form der Transmutation, also die Umwandlung von einer Materie in eine andere, hingegen könnte sich sogar sehr lohnen: Die Aufbereitung atomaren Mülls, der dadurch zum einen wieder nutzbar für die Energiegewinnung in Kernkraftwerken wird und zum anderen die Suche nach dem ewigen Atommüll-Endlager verkürzen könnte – und zum dritten wird bei der Transformation sogar Energie erzeugt. Die nukleare Transmutation schlägt also gleich drei Fliegen mit einer Klappe. Zumindest theoretisch. Praktisch ist die Technologie noch nicht so weit.
Atommüll entsorgen? Mit Transmutation nicht mehr notwendig
Die Transmutation soll die Strahlungsintensität des atomarem Abfalls reduzieren und die Halbwertszeit verkürzen. Bei dem Verfahren wird hochradioaktiver Abfall mit energiereichen, schnellen Neutronen beschossen, gespaltet und in Isotope mit deutlich kürzerer Lebensdauer umgewandelt. So zumindest das Grundprinzip der Transmutation, das 1964 erstmals beschrieben wurde. Der Begriff Atommüll umfasst allerdings vieles – und nicht alles davon eignet sich für die Transmutation. Es gibt schwachradioaktiven Abfall wie kontaminierte Schutzkleidung, mittelradioaktiven Abfall, etwa Teile aus dem Kraftwerk wie Rohre oder Isolationselemente, sowie hochradioaktiven Atommüll: Damit sind in der Regel die abgebrannten Brennstäbe aus den Reaktoren gemeint, die sehr lange strahlen, beim Zerfall viel Wärme freisetzen und deshalb in tonnenschweren Behältern aus Stahl und Gusseisen, dem Castor, aufbewahrt werden.
Einige Spaltprodukte, die sich im Atommüll befinden, besitzen extrem lange Halbwertszeiten. Plutonium-239 etwa, das nach einer Kernspaltung im Reaktor in den abgebrannten Brennstäben verbleibt, ist erst nach rund 24.000 Jahren zu schwachradioaktivem Uran-235 zerfallen – das wiederum mit einer Halbwertszeit über 700 Millionen Jahren weiter strahlt und erst danach in das stabile Bleiisotop übergeht. Andere Isotope, die in einem Kernkraftwerk entstehen, bleiben noch länger aktiv. Deshalb ist es notwendig, ein Endlager für den stark radioaktiven Abfall zu finden, das über sehr viele Jahre hinweg sicher bleibt. Laut Standortauswahlgesetz beträgt dieser Zeitraum in Deutschland eine Million Jahre.
Doch genau dieser hochradioaktive Abfall, der nur rund fünf Prozent des gesamten Atommüll-Volumens ausmacht, aber 99 Prozent seiner Radioaktivität erzeugt, ließe sich per Transmutation weiter nutzen. Zumindest ein Teil davon: Etwa ein Prozent der Elemente aus den alten Brennstäben ließe sich nach aktuellem Stand mit Transmutation umwandeln, zum Beispiel Plutonium, Americium, Neptunium und Curium, auch als Transurane bekannt. Sie strahlen besonders lange, haben also eine lange Lebensdauer, die sich durch die Transmutation verkürzen ließe. Und sie gehören zu den Stoffen, für die es am schwierigsten ist, ein sicheres Endlager zu finden. Vor der Transmutation müssen diese Transurane durch chemische Prozesse aus dem Brennstab herausgelöst werden.
Vorteile von Transmutation: Atommüll strahlt deutlich kürzer
- Auch nach der Transmutation strahlt der radioaktive Atommüll noch, die Radioaktivität nimmt aber schneller ab: Die Transmutation bewirkt, dass die Strahlung des auf diese Weise behandelten Atommülls nach 500 bis 1000 Jahren auf das Niveau von natürlich vorkommendem Uranerz abgesunken ist.
- Damit reduziert sich auch die Zeit, die der Abfall in einem sicheren Endlager verbringen müsste. Für den unbehandelten Atommüll wird in Deutschland aktuell nach Endlagern gesucht, die den Abfall eine Million Jahre beherbergen.
- Wenn durch Umwandlung weniger hochradioaktive Elemente im Abfall enthalten sind, bräuchte man dafür auch weniger Platz im Endlager. Durch Transmutation ließe sich das Volumen hoch radioaktiver, Wärme entwickelnder Abfälle vermutlich auf 9.500 bis 12.900 Kubikmeter reduzieren, also auf etwa ein Drittel. Man bräuchte allerdings zusätzlichen Lagerplatz für rund 100.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Abfall, der durch die Transmutation zusätzlich entsteht. Hierfür sind aber nicht so strenge Sicherheitsvorkehrungen nötig, ein Lager hierfür wäre einfacher zu finden.
Zwei verschiedene Varianten der Transmutation
In der Praxis sind zwei verschiedene Anwendungen der Transmutationstechnologie denkbar, die sich vor allem darin unterscheiden, wie die für die Transmutation notwendigen schnellen Neutronen erzeugt werden:
Beschleunigerbetriebenes System
Eine Transmutationsanlage, die den hochradioaktiven Atommüll umwandelt, die Halbwertszeit der strahlenden Isotope deutlich reduziert und somit den nuklearen Abfall entschärft – ein sogenanntes beschleunigerbetriebenes System.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Anlage ist ein Teilchenbeschleuniger, der dafür sorgt, dass am Ende Neutronen entstehen. Denn damit Transmutation überhaupt stattfinden kann, werden schnelle Neutronen benötigt, die auf den hochradioaktiven Abfall geschossen werden, um diesen zu spalten. Der Vorteil: In Transmutationsanlagen würde – anders als in Kernreaktoren, die zur Energiegewinnung eingesetzt werden – keine sich selbst erhaltende Kettenreaktion stattfinden, die im schlimmsten Fall einen nuklearen Unfall verursachen könnte – auch, wenn heutige Reaktoren dafür mittlerweile viele Sicherheitsvorkehrungen eingebaut haben. Der Nachteil: Transmutationsanlagen entschärfen den Atommüll „nur“, sie sind aber weniger zur Energiegewinnung geeignet.
Transmutationsreaktor
In den alten Brennstäben steckt noch jede Menge Energie, die durch Kernspaltung freigesetzt werden kann. Den Atommüll entschärfen und gleichzeitig Energie daraus gewinnen – das ließe sich in reaktorbetriebenen Systemen umsetzen, etwa in Leistungsreaktoren mit schnellen Neutronen. Diese Transmutationsreaktoren schaffen es, die schnellen Neutronen, die bei jeder üblichen Kernspaltung entstehen, aufrechtzuerhalten. Denn hier wird statt Wasser – wie es in den meisten derzeit betriebenen Atomreaktoren der Fall ist – metallisches Natrium als Kühlmittel eingesetzt, das die Neutronen, sobald sie entstehen, nicht abbremst. Mit diesen „am Leben gehaltenen“ schnellen Neutronen lässt sich somit auch in speziellen Leistungsreaktoren der Atommüll – also Plutonium und die Transurane Neptunium, Americium und Curium – umwandeln.
Aber nicht nur das: Treffen die „abgebremsten Neutronen“ auf das stabile Isotop Uran-238, das ebenfalls in großen Mengen (~ 95 Prozent) als Abfall in den alten Brennstäben steckt, kann Plutonium erbrütet werden. Das auf diese Weise erzeugte Plutonium wiederum kann durch weiteren Neutronenbeschuss transmutiert werden. Bei diesen Umwandlungsprozessen wird Energie freigesetzt, die der Reaktor auffangen kann. Der Atommüll aus den Brennstäben wird in Leistungsreaktoren also unter Energiegewinnung recycelt. Anders als in Transmutationsanlagen (beschleunigerbetriebenes System) kann in Leistungsreaktoren (reaktorbetriebenes System) jedoch eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion entstehen, die einen Reaktorunfall zumindest theoretisch möglich macht.
Erste Reaktorversuche mit Transmutation laufen bereits
Ein erstes reaktorbetriebenes System ist bereits in Russland in Betrieb. Der BN-800, ein natriumgekühlter Leistungsreaktor (schneller Brüter), läuft seit 2016. Aktuell dient er allerdings der Transmutation von Kernwaffen, nicht der von Atommüll – obwohl er technisch dazu in der Lage wäre. Das japanische Kraftwerk Monju, ebenfalls ein natriumgekühlter schneller Brüter, wurde nach nur 250 Betriebstagen im Jahr 2010 wegen zweier Unfälle geschlossen. Beide Male führten Natriumbrände zum Ausfall, denn das Kühlmittel ist im Kontakt mit Wasser und Luft leicht entzündlich. Auch Flüssigsalzreaktoren, die flüssiges Salz als Kühlmittel nutzen, werden im Zusammenhang mit Transmutation genannt, befinden sich jedoch noch in einer frühen Entwicklungsphase.
Zwei Testanlagen im Aufbau
Derzeit entstehen zwei Demonstrationsanlagen – in Japan die Anlage J-Parc, in Belgien die Anlage MYRRHA. Beide sind keine Transmutationsanlagen, sondern Versuchsanlagen für ein beschleunigerbetriebenes System – eine Voraussetzung für den späteren Bau einer Transmutationsanlage. Etwa um das Jahr 2030 soll der Beschleuniger MYRRHA betriebsbereit sein. Bis dahin wird das Projekt schätzungsweise 1,6 Milliarden Euro verschlungen haben.
Neben Belgien sind mehrere Partner an MYRRHA beteiligt: die Europäische Union, Frankreich, Italien, Spanien sowie Kasachstan und Japan. Auch Deutschland war an den Planungen beteiligt. Da man sich langfristig jedoch lieber auf die Suche nach einem sicheren Endlager fokussieren möchte, ist das deutsche Engagement bei solchen Forschungsvorhaben merklich zurückgegangen.
TU München und TÜV sehen große Potenziale
Dass Transmutation möglich und sogar lukrativ ist, haben Experten der TU München und des TÜVs postuliert. Die Umsetzungsstudie für den Bau einer Transmutationsanlage wurde von der Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND beauftragt. Dabei wurde ein fiktives Szenario geprüft, in dem die Umwandlungsanlage in einem der stillgelegten Atomkraftwerke entsteht, die in Deutschland mittlerweile als Zwischenlager für hochradioaktiven Atommüll dienen, auch weil so kein Atommüll quer durch Deutschland transportiert werden müsste. In der Bundesrepublik gibt es zwei zentrale Zwischenlager in Gorleben und Ahaus sowie vierzehn dezentrale Zwischenlager, darunter zwölf Standorte an oder in der Nähe ehemaliger Atomkraftwerke sowie spezielle Lager wie Jülich und Lubmin, die eine Sonderstellung einnehmen.
Technologiekonzept von Transmutex
In der Studie soll das Schweizer Start-up Transmutex die Transmutation durchführen. Das Transmutationskonzept sieht pro Standort drei Anlagen vor:
1) Beschleunigergetriebener Reaktor mit Bleikühlung und einer thermischen Leistung von 604 MW
2) Anlage zur pyrochemischen Wiederaufarbeitung zur Brennstoff- und Targetfertigung
3) Konditionierungsanlage für die verbleibenden und entstehenden Abfälle.
Rückgewinnung wertvoller Rohstoffe
Neben der eigentlichen Umwandlung radioaktiver Abfälle ermöglicht das Projekt laut Studie auch die Rückgewinnung verschiedener wertvoller Materialien aus abgebrannten Brennelementen. Dazu zählen unter anderem Uran sowie die kostbaren Edelmetalle Rhodium und Ruthenium, die in verschiedenen Industriezweigen benötigt werden. Darüber hinaus entstehen beim Umwandlungsprozess die Edelgase Xenon und Krypton. Ebenso können die Elemente Cäsium und Strontium gewonnen werden, die unter anderem als sogenannte Radioisotope in Medizin oder Forschung eingesetzt werden. Der Prozess erzeugt zudem erhebliche Mengen Hitze, die in Fernwärmenetze eingespeist werden könnte.
Die Bundesagentur für SPRIND erklärte, bereits die erste Demonstrationsanlage wäre laut der Studie hochrentabel. Die Anlage würde die Investitionskosten von rund 1,5 Milliarden Euro und jährliche Betriebskosten von gut 115 Millionen Euro mehrfach wieder einspielen. Den Ausgaben stünden nämlich Einnahmen aus den gewonnenen Elementen, der Entsorgung atomarer Abfälle und der Prozesswärme gegenüber. Bei einem Betrieb an einem ehemaligen AKW-Standort würden sich die Baukosten um rund 30 Prozent senken lassen.
BASE (Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung) sieht keine Umsetzbarkeit
Eine Realisierbarkeit dieser Behauptung erkennt das BASE nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen nicht. Die Anlage umfasst gleich drei Komponenten – einen Teilchenbeschleuniger, eine nukleare Wiederaufarbeitungsanlage und einen neuartigen Kernreaktor – von denen heute keine existiert. Die für eine erfolgreiche Umsetzung notwendigen technologischen Entwicklungen befinden sich noch auf dem Niveau von Papier- oder höchstens Laborstudien. Studien im Auftrag des BASE haben außerdem gezeigt, dass selbst im hypothetischen Erfolgsfall ein tiefengeologisches Endlager durch Transmutationstechnologien nicht ersetzt werden könnte.
Kann Transmutation ein Atommüll-Endlager ersetzen?
Selbst wenn Transmutation gelänge, bliebe ein Endlager für hochradioaktive Abfälle notwendig. Denn:
1) Selbst nach mehrfacher Transmutation verbleiben Transuran-Reste, die ein Endlager aufnehmen müsste.
2) Langlebige Spaltprodukte – sowohl bestehende als auch neu entstehende – müssten eingelagert werden.
3) Nur ein Teil der hochradioaktiven Abfälle liegt in Form von Brennelementen vor. Etwa 40 Prozent der Abfälle wurden im Rahmen der Wiederaufarbeitung verglast. Hier wäre eine erneute Partitionierung deutlich anspruchsvoller.
Die Leistungsfähigkeit sowie der Zeitpunkt einer möglichen industriellen Verfügbarkeit der Transmutation zur Behandlung radioaktiver Abfälle sind laut BASE ungewiss. Zudem sei zu berücksichtigen, dass sich die Menge an schwach- und mittelradioaktiven Abfällen, etwa aus dem Rückbau der Anlagen, erheblich erhöhen würde. Allein auf diese Technologie als Ersatz für ein Endlager für hochradioaktive Abfälle zu setzen, widerspreche BASE zufolge dem Verantwortungsprinzip. Dieses ist im Standortauswahlgesetz verankert und schreibt vor, dass ein bestmöglicher Schutz von Mensch und Umwelt vor den Wirkungen ionisierender Strahlung sowie die Vermeidung unzumutbarer Lasten für künftige Generationen gewährleistet sein muss. Für den Fall, dass die Transmutation in den kommenden Jahrzehnten oder Jahrhunderten tatsächlich zur industriellen Reife entwickelt werden und sich die Menge hochradioaktiver Abfälle reduzieren ließe, sieht das Standortauswahlgesetz allerdings Korrekturmöglichkeiten vor. Laut Gesetz sollen die hochradioaktiven Abfälle bis zum Verschluss des Endlagers rückholbar bleiben.
Anforderungen an ein Endlager für Atommüll
An einem Endlager kommt man also vermutlich nicht vorbei. Die Endlagerforschung hat drei Gesteinsarten identifiziert, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit über eine Million Jahre ein Endlager sicher einschließen können: Granit-, Ton- und Salzformationen. Diese müssten tief unter der Erde Raum für etwa 28.000 Kubikmeter Atommüll bieten – so viel Platz wäre nötig, um allein den hochradioaktiven Abfall einzulagern, also rund 17.000 Tonnen Schwermetall. Bisher hat man in Deutschland dafür keinen geeigneten Standort gefunden. Der mittel- und schwachradioaktive Abfall erfordert zwar deutlich mehr Lagerraum – bis zu 620.000 Kubikmeter –, stellt jedoch geringere Anforderungen an die Endlagerung, da er weniger strahlt und weniger Wärme entwickelt.
Transmutation löst das Problem Atommüll (noch) nicht
An der Suche nach einem geeigneten Endlager werden weder Deutschland noch andere Länder vorbeikommen. Die eigentliche Frage lautet: Soll unser nuklearer Abfall unbehandelt für eine Million Jahre in ein – bislang nicht vorhandenes – Endlager verbracht werden? Oder könnte ein Teil des Atommülls transmutiert werden – mit Technologien, die enorme Summen verschlingen, auf absehbare Zeit nicht verfügbar sind und damit zur Bekämpfung des Klimawandels womöglich zu spät kommen? Große Transmutationsanlagen existieren bislang nicht, und viele Fragen – etwa zur Abtrennung der hochradioaktiven Isotope, zur Brennstoffherstellung, zur Materialauswahl und zur Neutronenerzeugung – sind noch ungeklärt. Bis eine erste Anlage tatsächlich in Betrieb geht, dürften nach Einschätzung von Fachleuten rund 20 Jahre vergehen. Das Potential der Transmutation scheint allerdings groß - und erforschenswert.