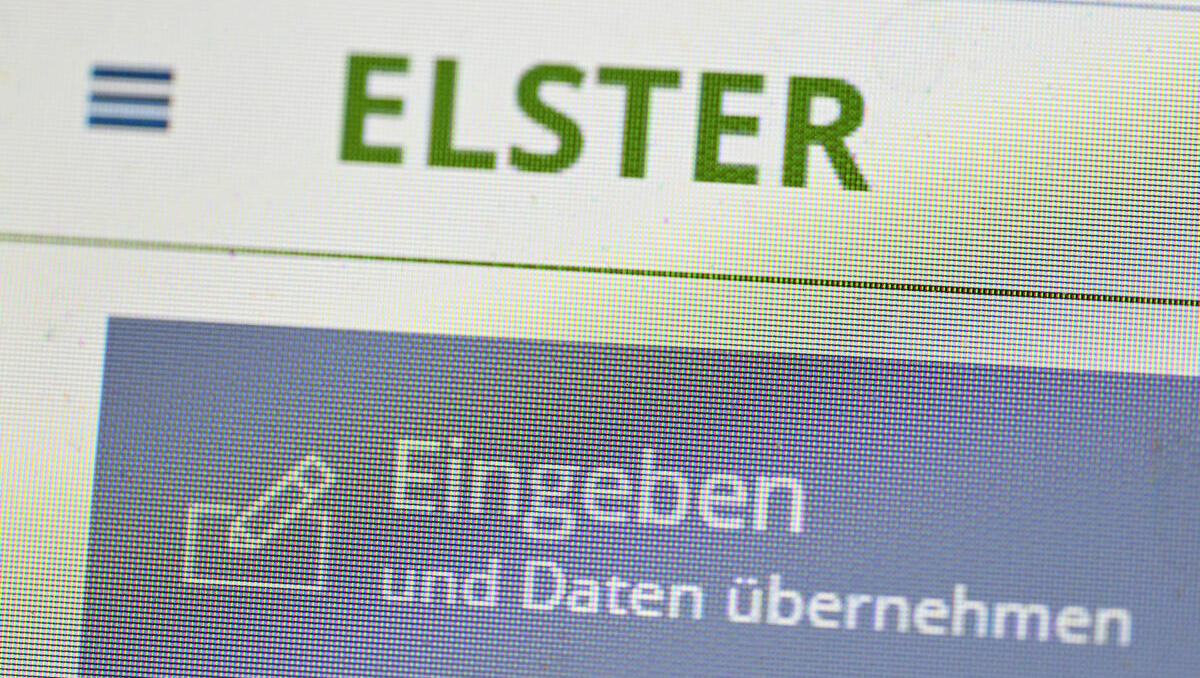DWN: Herr Behrens, was hat Sie dazu bewegt, Ihr aktuelles Buch über Chinas Entwicklungsweg zu schreiben – und warum gerade jetzt?
Uwe Behrens: Nach dem ich 27 Jahren in China und Indien gelebt und gearbeitet habe, kehrte ich 2017 zurück nach Deutschland. Hier war ich überrascht wie wenig Kenntnisse über China in den Medien sowie bei den Politikern vorhanden war. Halbwahrheiten wurden verbreitet und ein falsches Bild wurde vermittelt. Schon vor der Corona-Pandemie forderte mich ein Journalist auf, meine Erfahrungen in China aufzuschreiben. Die Zeit des Lockdowns konnte ich dann gut nutzen. Daraus wurden mit Unterstützung eines Lektors das erste Buch "Feindbild China - Was wir alles nicht über die Volksrepublik wissen". Das Buch erschien 2020. Da die im Buch verarbeitete Informationen ein reges Interesse fanden, entschloss ich mich, im folgenden Jahr über meine Berufserfahrungen als Logistiker für interkontinentale Landtransporte, einem Teil der Belt and Road Initiative, ein Buch mit dem Titel "Umbau der Welt - Wohin führt die Neue Seidenstraße führt" zu schreiben. Es ist 2022 erschienen. Viele Leserfragen erreichten mich mit der Bitte, über ein aktuelles Thema, der Überwindung der absoluten Armut in China, zu schreiben. Im Frühjahr 2024 reisten meine Frau und ich mehr als drei Monate mit dem Auto durch Chinas Provinzen, in denen in der Vergangenheit große Armut herrschte. Im August erschien das Buch "Chinas Gegenentwurf - Ein Weg in die Zukunft".
Bei den drei Büchern war für mich wichtig die Hintergründe und Zusammenhänge für die Entwicklung in China aufzuzeigen.
DWN: Sie haben insgesamt 27 Jahre in China gelebt und gearbeitet, zeitweise auch in Indien, und waren eng in eine Pekinger Nachbarschaft eingebunden. Wie hat diese internationale und persönliche Erfahrung Ihren Blick auf China geprägt?
Uwe Behrens: Um eine andere Gesellschaft zu verstehen, in einem anderen Kulturkreis zu leben sowie erfolgreich zu arbeiten, ist es nicht nur wichtig, die Kultur, die Geschichte zu kennen, sondern sich auch die verschiedenen Denkweisen, Gewohnheiten und Traditionen zu akzeptieren, als auch die verschiedene Lebensweise zu tolerieren. Mein Blick auf die Volksrepublik China war durch diese Haltung dadurch geprägt. Als Europäer kann man nicht erwarten, dass sich die chinesische Gesellschaft nach europäischen politischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Grundlinien ausrichtet. Die Chinesen, aber auch die Inder, müssen ihren eigenen Weg finden und verfolgen.
DWN: Auf Ihren Reisen quer durch China – gab es Situationen, in denen Ihre Eindrücke vor Ort nicht mit dem Bild übereinstimmten, das in westlichen Medien häufig vermittelt wird?
Uwe Behrens: Ich musste oft feststellen, dass die mediale Berichterstattung in Deutschland über China in den seltensten Fällen die Realität widerspiegelt. Im Vergleich zu Indien, in der größten Demokratie, die positive bewertet wird, reflektiert das über China gezeichnete Bild überwiegend negative Seiten. In Ländern mit 1,4 Mrd. Menschen gibt es positive und negative Entwicklungen. Im Falle Chinas werden die negativen hervorgehoben. Zwischen den entwickelten Megastädten und den zum Teil noch sehr rückständigen Provinzen, geprägt von Wüsten, Grasland und Gebirgen, bestehen große Unterschiede. Beispielsweise wird über die Provinz Xinjiang über Unterdrückung der uighurischen Minderheit berichtet, aber nicht wie sich der Lebensstandard dieser Minderheit um ein Vielfaches verbessert hat. Die Armut wurde überwunden, die Menschen leben frei, die Städte sind modern und offen. Terroristische Unsicherheiten wurden erfolgreich überwunden. Jeder ausländische Tourist kann in die Provinz reisen und sich davon überzeugen.
DWN: Welche Unterschiede zwischen dem Leben in den großen chinesischen Städten und den ländlichen Regionen sind Ihnen in Bezug auf Lebensstandard und Armutsbekämpfung besonders aufgefallen?
Uwe Behrens: Noch vor dreißig Jahren bestanden gewaltige Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den östlichen Küstenregionen und dem Inland oder den westlichen Wüstenprovinzen. Diese Unterschiede wurden systematisch abgebaut. Die Provinz Guizhou war über Jahrhunderte durch Armut geprägt. Ich reiste im vergangenen Jahr mit dem Auto mehrere Monate durch die Provinz. Es gibt keine absolute Armut mehr. Auch die kleinsten Dörfer haben Straßenanbindung, Elektrizität, Internet. Allerdings gibt es zwischen Städten wie Shanghai, Shenzhen, Peking und Kleinstädten noch Differenzen. Im Rahmen der nachhaltigen Armutsüberwindung und der Wiederbelebung des ländlichen Raumes entwickeln sich gerade gegenwärtig die Kleinstädte und dörfliche Gemeinden in großen Schritten.
DWN: In Ihrem Buch betonen Sie die Bedeutung des „Jahrhunderts der Demütigung“ – also der Zeit ausländischer Einmischung und Schwäche Chinas zwischen Mitte des 19. und Mitte des 20. Jahrhunderts – für das heutige Selbstverständnis des Landes. Wie wirkt diese Erfahrung noch im Verhältnis zu Europa und den USA nach?
Uwe Behrens: Nach meiner Erfahrung sind die Chinesen sehr offen. Sie sind bereit die Vergangenheit hinter sich zu lassen und in eine gemeinsame Zukunft zu schauen. Mir als Deutschen wurde nie eine negative Bemerkung betreffend die Niederschlagung des Boxeraufstandes oder der Kolonialisierung Qingdaos geäußert. Im Gegenteil. Deutschland wird, besser wurde, mit großer Hochachtung angesehen. Die chinesische Bezeichnung für Deutschland bedeutet übersetzt als das „Land der Tugenden“. Nach meiner Erkenntnis spielten die Erfahrungen weder in der Politik noch im Verhalten der Menschen eine Rolle.
Durch die negative Berichterstattung über China in Deutschland, die den Chinesen auch nicht verborgen bleibt, oder das undiplomatische Verhalten deutscher Politiker, ändert sich das Bild. Wenn der deutsche Außenminister in Front eines japanischen Kriegsschiffes über eine militärische Kooperation Deutschlands mit Japan spricht, da China drohe, Grenzen zu seinen Gunsten zu verschieben, dann werden Erinnerungen an die Zusammenarbeit Deutschlands und Japans während des zweiten Weltkrieges wach.
Diese Haltung Deutschlands gegenüber China wird das Verhältnis mit Sicherheit nicht verbessern.
DWN: Sie stammen aus der DDR und haben als Transportökonom in den 1980er-Jahren Bahnprojekte nach Asien mitorganisiert. Inwiefern hat dieser berufliche Hintergrund Ihre Sicht auf Chinas heutige Infrastrukturpolitik beeinflusst?
Uwe Behrens: Ich habe an der Hochschule für Verkehrswesen namens „Friedrich List“ in Dresden studiert. Friedrich List war ein international hoch anerkannter National- und Transportökonom. Er hat das Eisenbahnwesen sowohl in Deutschland als auch Amerika mitgeprägt. Die Infrastruktur, die Eisenbahn, sind eine Voraussetzung für die Industrialisierung. Die Chinesen habe Friedrich List studiert. Ich wurde mehrfach von Transportexperten darauf angesprochen. Auch in der DDR wurden die Lehren von List hochgehalten.
In China spiegelt das Bahnnetz für den Gütertransport und die Hochgeschwindigkeitszüge, sowie die damit verbundene Verlagerung der Straßentransporte auf die Schiene und der inländischen Personentransporte vom Flugzeug auf die Bahn die umweltfreundliche Verkehrspolitik wider. In Deutschland ist Friedrich List offenbar vergessen.
DWN: Sie beschreiben Chinas Armutsbekämpfung als gesamtgesellschaftliches Projekt, bei dem Infrastruktur eine Schlüsselrolle spielt. Welche konkreten Strategien halten Sie dabei auch für andere Länder, zum Beispiel in Europa, für interessant?
Uwe Behrens: Der Armutsbekämpfung liegt ein zentraler staatlicher Plan zu Grunde. Um beispielsweise in der Provinz Guizhou den Tourismus zu entwickeln, bestand die staatliche Planung darin, die landschaftlichen Touristenregionen verkehrstechnisch zu erschließen. Alle Dörfer wurden an das Straßennetz angebunden. Hunderte Brücken wurden gebaut und Tunnel gegraben. Heute gibt es hier die welthöchsten und -längsten Brücken, die gleichzeitig im Rahmen der Neuen Seidenstraßen Initiative wichtige internationale Straßen und Bahnverbindungen darstellen. Ich sehe für Europa auf diesem Gebiet der Infrastrukturentwicklung ebenfalls einen hohen Bedarf.
DWN: Können Sie ein konkretes Beispiel aus China nennen, bei dem der Bau von Infrastruktur – etwa Straßen, Eisenbahnen oder Energieversorgung – nachhaltig geholfen hat, Armut zu überwinden?
Uwe Behrens: Die Provinz Guizhou ist dafür ein gutes Beispiel. Jedes Dorf ist verkehrstechnisch und mit Elektrizität sowie Wasser und Abwasserversorgung angebunden. Nicht nur der Tourismus konnte dadurch gefördert werden, sondern auch das lokale, traditionelle Handwerk, die Volkskunst. Ich konnte mich während meiner dreimonatigen Reise durch die Provinzen überzeugen. Am meisten aber hat mich die Internetanbindung beeindruckt. An jeder „Milchrampe“ bestehen mindestens 4 G, meist 5G, Netzverbindungen. Diese fördern die lokale Industrie, den Tourismus, als auch die Kommunikation mittels der sozialen Medien. Das ist eine wichtige Errungenschaft für die nachhaltige Hebung des Wohlstandes der Bevölkerung.
DWN: Kritiker im Westen sagen, dass Chinas Armutsbekämpfung zulasten politischer Freiheiten gehe. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld zwischen sozialer Sicherheit und individueller Freiheit?
Uwe Behrens: In Indien konnte ich sehr wohl sehen, dass ein armer Bauer, oder ein Bewohner eines Slums, sich nicht um politische Freiheiten kümmert. Er muss ums Überleben seiner Familie kämpfen. Politische Freiheiten können meiner Kenntnis nach erst dann wirklich wahrgenommen werden, wenn die absolute Armut überwunden, fundamentale soziale Sicherheit gewährleistet ist. Die Kritik verdeutlicht die Unkenntnis im Westen über die konkreten Bedingungen in den Ländern, die um die Überwindung der Armut kämpfen. Mit der sozialen Sicherheit entwickeln sich die gesellschaftlichen und individuellen Freiheiten, die auch kulturell geprägt sind. Auch das kann man in China verfolgen.
DWN: Sie haben Bahntransporte zwischen Europa und Asien schon in den 1980er-Jahren organisiert – lange bevor die „Neue Seidenstraße“ ein politisches Schlagwort wurde. Was hat sich seitdem grundlegend verändert?
Uwe Behrens: Die kontinentalen Bahntransporte in den 1980er Jahren wurden im Wettbewerb zum Seetransport von privaten Spediteuren organisiert, allerdings subventioniert durch die sowjetischen Eisenbahnen, die harte, westliche Währungen erwirtschafteten wollte.
Heute werden die kontinentalen Bahntransporte von den Bahnen Chinas, Zentralasiens und Russlands organisiert, um Alternativen zum Seetransport durch die sogenannten Flaschenhälse wie die Straße von Malakka oder den Suezkanal zu schaffen. Die Bahnen werden staatlich unterstützt, vor allem von China, um die Industrialisierung der Transitländer zu fördern oder ganz neue Handelsrouten zu erschließen. So verkehren heute regelmäßige Güterzüge zwischen China und dem Iran oder der Türkei, zwischen Russland und Vietnam durch China oder Russland nach Indien über den Iran.
DWN: In Afrika und Lateinamerika setzt China stark auf den Bau von Straßen, Häfen und Bahnlinien. Sehen Sie darin vor allem gegenseitige Entwicklungschancen oder auch die Gefahr einer neuen wirtschaftlichen Abhängigkeit?
Uwe Behrens: Bei der Erschließung neuer Straßen, Häfen und Bahnlinien geht es um die Entwicklung neuer Handelsrouten in beiden Richtungen und nicht um die Ausbeutung lokaler Rohstoffe durch eine Kolonialmacht wie in der Vergangenheit. Der Handel fördert die Industrialisierung und diese wiederum den Wohlstand. In den Häfen entstehen Sonderwirtschaftszonen nach chinesischem Model der 80er und 90er Jahre. An den Bahnlinien neue Fabriken. Insbesondere die Länder in Afrika, Südostasien oder Lateinamerika verlangen zunehmend, dass die Rohstoffe vor dem Export örtlich verarbeitet werden, um die Wertschöpfung im eigenen Land zu erhalten. Diese Entwicklung fördert China. Für alle afrikanischen Länder, mit einer Ausnahme, hat es die Importzölle für alle Erzeugnisse der Länder aufgehoben. Indem sich die Länder des Globalen Südens wirtschaftlich entwickeln, werden sie unabhängiger.
DWN: Viele westliche Beobachter unterstellen, dass hinter solchen Projekten geopolitische Machtambitionen stehen. Was entgegnen Sie dieser Sichtweise?
Uwe Behrens: Die westlichen Beobachter sollten sich die Realitäten anschauen. Die VR China initiierte die Neue Seidenstraßen Initiative, oder auch Belt and Road Initiative, 2013 offen für alle Länder. Bis auf die EU-Länder und die USA sind 140 Länder dieser Initiative beigetreten, nicht weil sich dadurch abhängig gemacht werden, sondern weil sie durch die Infrastrukturprojekte am internationalen Handel teilnehmen, ihre Industrie aufbauen können. Die Kredite werden aus Ergebnissen der Industrialisierung oder durch die verarbeiteten Rohstoffe finanziert. Infrastrukturprojekte haben eine längere Amortisationszeit als industrielle und bedürfen daher auch langfristige Finanzierungsrahmen. Die freundschaftlichen und partnerschaftlichen Beziehungen zwischen China und den anderen Ländern des „Globalen Südens“ wachsen entsprechend. Damit wachsen ebenfalls Organisationen wie die BRICS, der SOZ oder deren Finanzinstitute. Die Abhängigkeit vom Dollar, der gerade in den letzten Jahren vermehrt als politische Waffe gegenüber Drittstaaten eingesetzt wurde, verringert sich.
Das Beispiel China veranlasste die USA ähnliche Projekte anzukündigen. Dabei denke ich an eine Straße von Aserbaidschan über Armenien in die Türkei die den Namen Trump tragen soll oder den Lobito Bahnkorridor als Gegenprojekt zur von China vor 60 Jahren gebauten Bahn in Ostafrika, der Tansania-Sambia-Railway.
DWN: Wo sehen Sie klare Vorteile des chinesischen Entwicklungsmodells gegenüber dem westlichen – und umgekehrt?
Uwe Behrens: Es gibt eine chinesische Weisheit, die sinngemäß lautet: „möchtest Du einer Familie helfen Fisch zu essen, dann gibt ihr keinen Fisch, sondern lehre sie, wie sie Fische fangen kann“. Nach diesem Prinzip richtet sich das chinesische Entwicklungsmodel. Aufbau von Infrastruktur, einer lokalen Industrie und eines Bildungswesens, sowie Ausbildung von Fachkräften, die verpflichtet werden in ihr Land zurückzukehren. All das kann von der westlichen Entwicklungshilfe nur schwer feststellen. Im Gegenteil: Deutschland bemüht sich in ärmeren Ländern ausgebildete Fachkräfte aus diesen Ländern nach Deutschland zu werben. Das ist eine Form von Neokolonialismus!
DWN: Sie betonen, dass China in erster Linie Handel treiben will. Was müsste Europa aus Ihrer Sicht tun, um in dieser Hinsicht konkurrenzfähig zu bleiben und zugleich unabhängiger zu werden?
Uwe Behrens: Freier Handel beruht auf gegenseitigen Vorteil. Europa war in den letzten 45 Jahren sehr erfolgreich im Handel mit China. Auch für China war das eine Erfolgsstory, es konnte sich zu einer Industrienation entwickeln. Auf Grund des großen Marktes, der großen Zahl von ausgebildeten Fachleuten entwickelt sich China gegenwärtig zu einem Innovationszentrum. Siehe zum Beispiel die Elektromobilität, die Robotik, Chemieindustrie oder die Medizintechnik. Europa sollte sich in diese Entwicklung mit einbinden. In der Autoindustrie kann man das sehen. Die Forschungseinrichtungen verschiedener Automobil- Unternehmen befinden sich in China und gemeinsam werden neue Modelle für China und Drittmärkte entwickelt, gebaut und gehandelt. Umgekehrt sollte Europa chinesische Unternehmen einladen Joint Ventures zu gründen, um über diesen Weg chinesische Technologien nach Europa zu holen und gemeinsam Handel treiben. Das führt nicht zu Abhängigkeiten, wenn gleichzeitig mit anderen Ländern, wie Indien oder den Ländern der ASEAN, Afrikas, Amerikas industriellen Kooperation und Handel betrieben wird.
DWN: Wenn Sie auf Ihre jahrzehntelange Erfahrung mit China zurückblicken – welche Lehre würden Sie sich wünschen, dass europäische Politikerinnen und Politiker aus dem chinesischen Entwicklungsweg ziehen?
Uwe Behrens: Eines erscheint mir sehr wahrscheinlich: die Hegemonie der westlichen Industriemächte gehört zum vergangenen Jahrhundert. Die wirtschaftliche Entwicklung der asiatischen Länder bestimmt zunehmend den internationalen Handel, manche Geostrategen sprechen vom „Asiatischen Jahrhundert“. Europa sollte sich als gleichberechtigter Partner für einen fairen Freihandel einsetzten, gemeinsam mit diesen Ländern, China eingeschlossen, die Regeln dieses Jahrhunderts schreiben. Es wäre wünschenswert, wenn europäischen Politiker die veränderte globale Situation anerkennen würden und ihre Politik darauf einstellen würden.
***
Info zur Person: Uwe Behrens, geboren 1944, Studium an der Hochschule für Verkehrswesen »Friedrich List« in Dresden, Promotion, Vertreter der DDR bei Intercontainer in Basel, Logistiker bei Deutrans-Transcontainer. Ab 1990 arbeitete er in China für verschiedene Logistikunternehmen und übernahm 2000 auch das Management eines französischen Joint Ventures in Indien. 2017 nach Deutschland zurückgekehrt, kontrastierte er seine Beobachtungen und Erfahrungen mit den Darstellungen in den Medien und lieferte mit seinem viel beachteten Buch "Feindbild China" (2020) eine erfrischend kenntnisreiche und kompetente Beurteilung des neuen China. Einen zweiten Band zum Thema legte er mit "Der Umbau der Welt. Wohin für die Neue Seidenstraße?" (2022) vor. Sein aktuelles Buch, "Chinas Gegenentwurf", ist kürzlich erschienen.