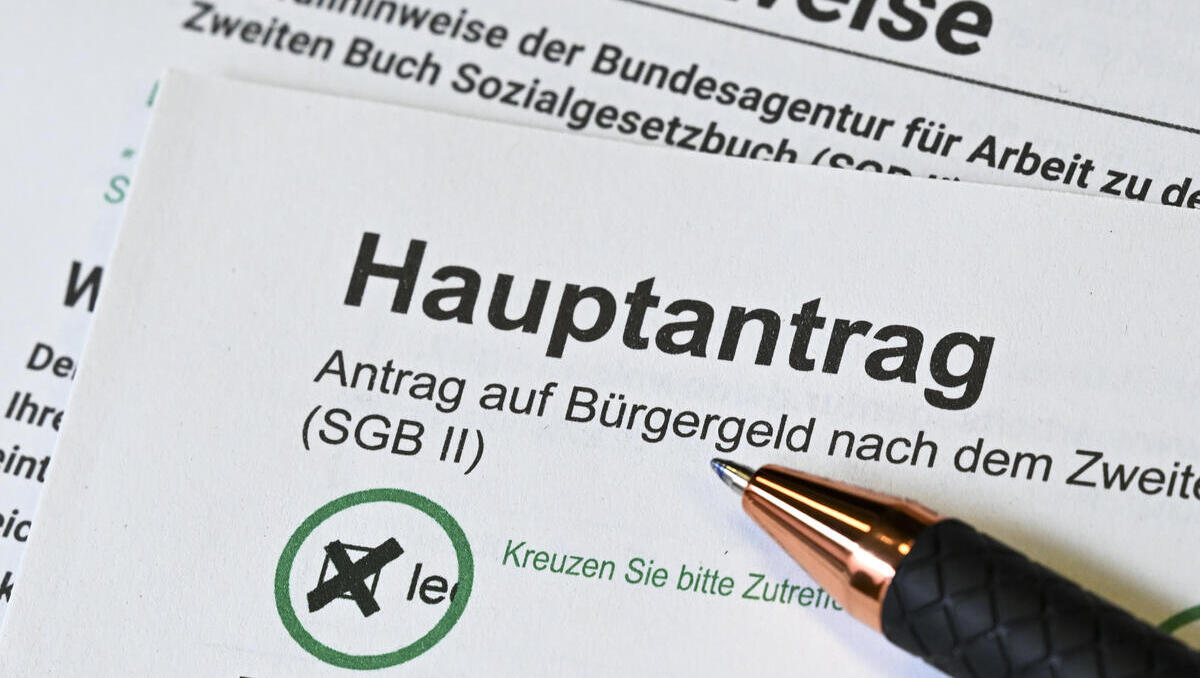Die EU feierte kürzlich einen großen Erfolg: Sie unterzeichnete vor wenigen Wochen ein Freihandelsabkommen mit Neuseeland. Zölle auf die Exporte der EU nach Neuseeland wurden abgeschafft, wie auch für neuseeländische Lebensmittel, die in die EU gelangen sollen. Darunter fallen etwa Kiwis und Rindfleisch. Hinzu kommen eine Reihe Regulierungen für den Dienstleistungsmarkt, Datenströme und Unternehmenszugänge. Hervorgehoben wird, dass viele europäische Produkte, von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis hin zum ungarischen Tokaij-Wein, nun zollfrei nach Neuseeland verkauft werden können.
Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dazu, „dieses moderne Freihandelsabkommen“ würde Unternehmen, Landwirtschaftsbetrieben und Verbrauchern beider Seiten große Chancen bieten, „mit sozialen und klimapolitischen Verpflichtungen, wie wir sie bisher noch nie hatten.“ So könne es einerseits gerechtes und grünes Wachstum stimulieren und zugleich die wirtschaftliche Sicherheit gestärkt werden. Auch zeige dieses Abkommen, wie die Union „ihr Engagement in dieser Boom-Region intensiviert“ und damit ihre Strategie für den indopazifischen Raum umsetzt.
Neuseeland ist ein isolierter Inselstaat mit etwas mehr als fünf Millionen Einwohnern. Die EU mit knapp 450 Millionen Einwohnern dürfte hier nur wenig zur Umsatzsteigerung in europäischen Landwirtschaftsbetrieben und Weinkellern beitragen. Doch wirklich interessant sind aber die sogenannten Nachhaltigkeitsverpflichtungen, die von beiden Seiten angenommen werden müssen. In dem einseitig von der EU entwickelten Ansatz geht es um „Die Macht von Handelspartnerschaften: gemeinsam für ein grünes und gerechtes Wirtschaftswachstum.“ Das Handelsabkommen erscheint als ein Vorzeigeprojekt für potenzielle Partner, das eines beweisen soll: Handelsabkommen mit der EU funktionieren und sind sogar für beide Seiten gewinnbringend. Denn daran haben bislang viele größere Volkswirtschaften ihre Zweifel.
Freier Handel in Zeiten des Protektionismus
Der Pazifikraum gerät zunehmend ins Visier europäischer Handelspolitik. Länder wie Indien, Thailand, die Philippinen und Indonesien wachsen, bieten große, junge Märkte und könnten in vielen Bereichen die Volkswirtschaft China als Partner ersetzen. Daneben gelten die Mercosur-Staaten als besonders interessant: Das Bündnis aus Uruguay, Paraguay, Brasilien und Argentinien bietet hochwertige Landwirtschaftsprodukte zu günstigen Konditionen und einen ebenso wachsenden Markt, auf dem sich europäische Produkte wie Autos und Maschinen hervorragend verkaufen lassen.
Ebensolche Produkte werden in der Volksrepublik zunehmend selbst hergestellt. Auch die USA schotten sich mit dem Inflation Reduction Act (IRA) zunehmend gegen ausländische Hersteller ab. Die Europäische Union hält auch in Zeiten des wachsenden Protektionismus am Prinzip des globalen Freihandels fest. Während die Weltmächte China, Russland und die USA ihre heimischen Industrien schützen, wollen viele Länder weltweiten Freihandel per Abkommen fortführen. Die EU hätte also genügend potenzielle Partner. Doch die Art und Weise, wie sie ihre Abkommen durchsetzen will, stößt zunehmend auf Unverständnis.
Freier Handel — aber nur nach grüner Façon
Brüssel strebt Partnerschaften an, die zwar beiden Seiten dienlich sein sollen. Doch zur Unterzeichnung stellt Brüssel besondere Anforderungen an die potenziellen Partner. Diese sollen sich an Richtlinien halten, die etwa den Datenschutz und vor allem den Umweltschutz betreffen. So wurde etwa der Mercosur-Deal schon im Jahr 2019 beschlossen, die Ratifizierung dauert aber weiter an. Die Frage, ob sich das riesige Abkommen nach fast 25 Jahren zäher Verhandlungen noch retten lässt, kann derzeit niemand beantworten.
Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva schimpfte derweil über „grünen Neokolonialismus“, den die europäischen Verhandlungspartner unter dem Deckmantel des Klima- und Umweltschutzes führen würden. Sein paraguayischer Amtskollege Peña forderte gar, die Verhandlungen mit Brüssel einzufrieren.
Landwirte, Lobbyisten und grüne Politiker für mehr Kontrolle
Doch Europa bleibt dabei: Noch zu Beginn des Jahres erklärte Frankreichs Präsident Macron, die Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten lägen auf Eis, da südamerikanische Produzenten sich nicht an die neuen Vereinbarungen halten wollten. Auch französische, irische und deutsche Bauernverbände blockieren Freihandelsabkommen mit Staaten, die den europäischen Markt mit billigeren Produkten überschwemmen könnten. Ihr Wirken sollte nicht unterschätzt werden, so wurde das TTIP Freihandelsabkommen mit den USA unter anderem wegen französischem Lobbyismus vonseiten Macrons, der seine Landwirte schützen wollte, ausgesetzt. Umweltschutz dürfte hier ein eher zweitrangiges Anliegen sein, wichtig erscheint die Wettbewerbsfähigkeit.
Auch von der deutschen Wirtschaft werden Forderungen laut, die laufenden Verhandlungen mitsamt aller Richtlinien zum Umweltschutz abzuschließen. So forderte etwa Ulrich Ackermann, Leiter der VDMA Außenwirtschaft: „Nur mit einem Abkommen haben wir Einflussmöglichkeiten auf die Nachhaltigkeitsstandards in Brasilien und den anderen Ländern.“ Insofern müsse der Mercosur-Deal endlich abgeschlossen werden.
CBAM: Freihandel mit protektionistischem Einschlag?
Ganz in diesem Sinne forciert die Europäische Kommission indessen die Senkung von Emissionen weltweit. Mithilfe des Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sollen Waren, die in die EU importiert werden, auf ihre Emissionsabgaben geprüft werden. Haben sie keine Angabe, werden sie verteuert. Unter die Produkte fallen etwa Wasserstoff, Strom, Düngemittel, Zement oder Eisen. Grundsätzlich soll CBAM damit heimische Unternehmen vor unlauterem Wettbewerb schützen. Doch kann dieser Freihandel mit protektionistischem Einschlag funktionieren?
Abgesehen von drohenden Klagen aus Südkorea, Großbritannien oder China droht durch CBAM ein bürokratisches Chaos in der EU selbst. So müssen alle Produktionsschritte, die eine Ware durchlaufen hat, auf ihre Emissionsbilanz geprüft werden. Die Rechtsunsicherheit für Unternehmer, Landwirte und andere Produzenten ist vorprogrammiert. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bei diesem unklaren Regelwerk die europäischen Unternehmen jegliche Kostenvorteile einbüßen und es zu hochkomplexen Rechtsstreitigkeiten kommen wird.
Der grüne Neokolonialismus betrifft somit nicht nur potenzielle Handelspartner, die den Kontinent mit Schlüsseltechnologien und seltenen Erden versorgen könnten. Er belastete auch heimische Produzenten aus der EU. Und während sich die Verhandlungen etwa mit den Mercosur-Staaten über weitere Jahre hinziehen, wenden sich viele Länder entnervt von der EU ab — ganz zur Freude der Volksrepublik China.