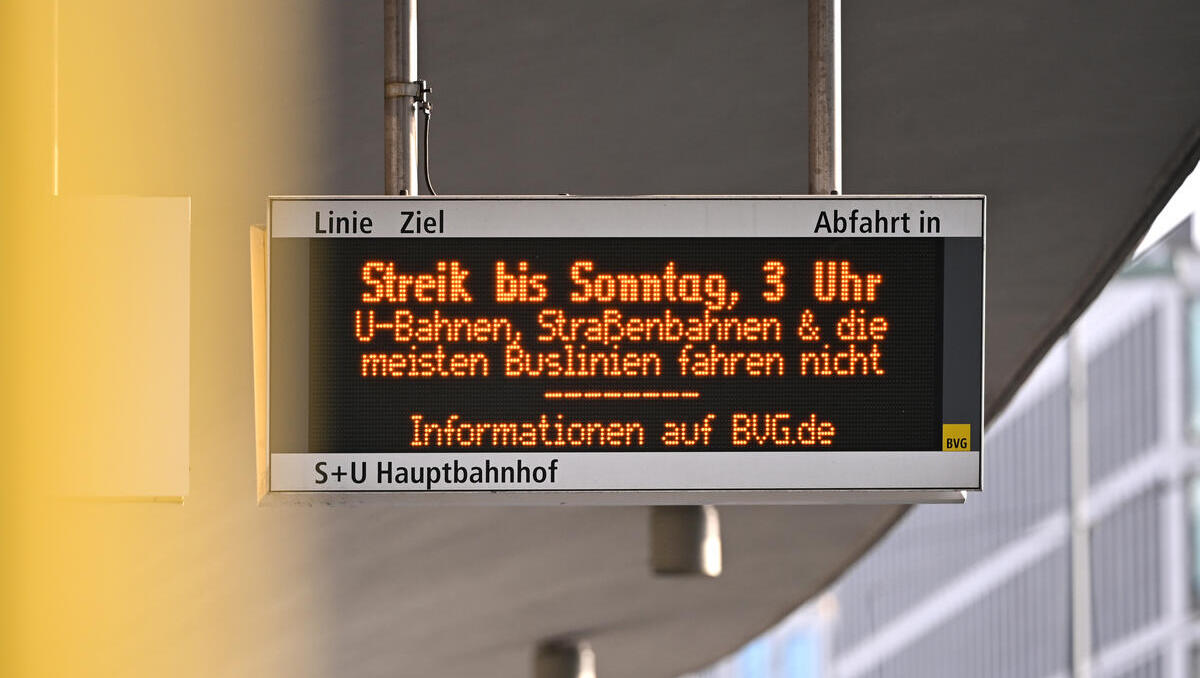Eine Strompreiszone für alle
Wird Deutschland bald wieder in Zonen aufgeteilt? Wenn es nach ENTSO-E geht, dem Verband europäischer Netzbetreiber, soll genau das geschehen. Deren Vorstoß sieht fünf verschiedene Preiszonen für Strom statt wie bislang eine einheitliche Zone gemeinsam mit Luxemburg vor. Ob das so sinnvoll ist, daran scheiden sich schon länger die Geister. In einigen Teilen Deutschlands könnte die Aufteilung in Strompreiszonen die Energie kräftig verteuern, in anderen vergünstigen. Entsprechend begrüßt der windgesegnete deutsche Norden die Idee, und der industriestarke, aber stromschwache Süden hält wenig davon und würde den Status Quo viel lieber erhalten - mit ein paar Extra-Gaskraftwerken, natürlich ebenfalls im Süden.
Aktuell bildet Deutschland zusammen mit Luxemburg eine sogenannte Gebotszone. Bis zum Jahr 2018 gehörte auch Österreich dazu. Der Strompreis hier richtet sich nach Angebot und Nachfrage und kann unabhängig von der Netzsituation und dem Transport des Stroms an der Strombörse gehandelt werden. Wer in Deutschland Strom an der Börse kauft, zahlt also überall gleich viel - egal, ob der Strom in Rostock oder Friedrichshafen verbraucht wird. Nicht selten führt das zu teuren Fehlanreizen: Etwa wenn ein Batteriespeicher am Bodensee sich mit Strom vollsaugt, obwohl die Netztrassen von Nord nach Süd bereits voll ausgelastet sind. Der vermeintliche Nord-Strom kommt dann teuer aus einem süddeutschen Gaskraftwerk – die Kosten für diesen sogenannten "Redispatch" geben die Netzbetreiber an die Verbraucher weiter.
Regionale Unterschiede prägen die Energielandschaft
Denn in Deutschland gibt es regional große Unterschiede bei der Stromerzeugung. In Norddeutschland weht viel Wind, und dort stehen mehr Windräder als etwa im Süden. Wenn viel Wind weht, aber nicht viel Sonne scheint, dann entsteht günstiger Strom eben vor allem im Norden an den Küsten. Seit dem Atomausstieg können die südlichen Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg ihren Strombedarf nicht mehr aus eigener Kraft decken, während die Küstenregionen an Nord- und Ostsee dank gewaltiger Windparks auf hoher See weit mehr Strom produzieren, als sie selbst benötigen.
Der Strom muss also meistens vom Norden in den Süden transportiert werden. Doch es fehlt an Stromtrassen. Wird also an windreichen Tagen viel Windstrom produziert, kann das die Netze überlasten und die Übertragungsnetzkapazitäten stoßen an ihre Grenzen. Die Folge: Um einen Blackout zu vermeiden, müssen die Netzbetreiber eingreifen und die Einspeisungen aus den Kraftwerken anpassen. Ein teurer Prozess. Dazu kommt das stete Risiko einer Netzüberlastung und eines Stromausfalls, wie zuletzt in Spanien und Portugal. Die Folge: Gaskraftwerke im Süden fahren hoch, um den Bedarf auszugleichen. Das wiederum bedeutet, dass der Börsenstrompreis für Großkunden in ganz Deutschland steigt - auch im Norden, wo eigentlich viel günstiger Strom vorhanden ist.
Börsenstrompreise unterscheiden sich von Endkundenpreisen
Die Börsenstrompreise sind dabei nicht gleichzusetzen mit den Endkunden-Preisen, die Privathaushalte zahlen. Schließlich kommen zum reinen Strompreis noch vom Staat erhobene Lasten wie Netzentgelte und Stromsteuer hinzu. Zudem verdient der Stromanbieter mit. Der reine Strompreis macht nicht einmal die Hälfte der Stromkosten im Privathaushalt aus. Dennoch zahlen auch Verbraucher drauf, um die Mängel des aktuellen Systems auszugleichen.
Milliardenschwere Ausgleichszahlungen belasten Verbraucher
Ein weiteres Problem der einheitlichen Strompreiszone: Wenn die Gaskraftwerke hochfahren, weil die Überkapazitäten nicht aus dem Norden nach Süden transportiert werden können, werden Windanlagen-Betreiber für die Zwangspause entschädigt. Die Ausgleichszahlungen für die Strom-Produzenten summieren sich: Für das Jahr 2024 kamen so laut Bundesnetzagentur 2,8 Milliarden Euro zusammen. Auch diese Kosten werden auf die Verbraucher umgelegt.
Das Argument für die einheitliche Zone: Dadurch setzen sich die kostengünstigsten Erzeugungstechnologien unabhängig vom Standort durch, und die Anlagen mit den geringsten Einsatzkosten werden überregional genutzt, was die Beschaffungskosten von Strom senkt.
Infrastruktur stößt an ihre Grenzen
Die Infrastruktur bietet aber aktuell noch gar nicht die Möglichkeit, kostengünstig Strom durch ganz Deutschland zu transportieren - was dem Argument für die Einheitszone zumindest einigen Wind aus dem Offshore-Rad nimmt. Zu häufig sind die Netze überfordert. Nun sollen im Süden weitere Gaskraftwerke gebaut werden, um die Stabilität von Netzen und Preisen zu erhöhen. Könnte die Aufteilung der aktuell noch einheitlichen Preiszone in mehrere Preiszonen daher einen Vorteil bieten?
Europäische Netzbetreiber fordern Reform
Das jedenfalls sehen europäische Netzbetreiber so. In der Debatte um eine Reform des Stromnetzes in der EU haben sie sich neulich für eine Abschaffung der deutschlandweit einheitlichen Strompreiszone ausgesprochen. In einer Analyse schlagen sie vor, das bislang einheitliche Gebiet Deutschlands sowie Luxemburgs in fünf kleinere Zonen aufzuteilen – wirtschaftlich wäre dies offenbar am effizientesten. Kleinere Strompreiszonen könnten dafür sorgen, dass der regionale Strompreis den wahren Gegebenheiten vor Ort entspricht, also dem tatsächlichen Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Strom in Norddeutschland mit seinen Offshore-Windparks könnte dann wesentlich billiger sein als im Süden des Landes. Mit gravierenden Folgen für Betriebe und private Haushalte.
Schweden als Vorbild für Strompreiszonen
In Schweden ist das Konzept bereits seit 2011 in Gebrauch. Die EU-Kommission setzte es dort durch. Nun unterscheidet sich der durchschnittliche Börsenstrompreis - übers Jahr gesehen - in den vier einzelnen Zonen Schwedens teils deutlich voneinander. Neben Schweden gibt es in drei weiteren Staaten mehrere Gebotszonen: In Dänemark bestehen zwei, in Norwegen fünf und in Italien sogar sechs Zonen. Für Deutschland werden auf EU-Ebene verschiedene Zuschnitte geprüft: Im Gespräch sind zwei, drei, vier oder sogar fünf Zonen.
Eine kleine Randnotiz: Die Schweden beschweren sich gerne mal, dass für Deutschland nur eine Strompreiszone gilt. Dies würde die Preise in anderen EU-Ländern zu manchen Zeiten in die Höhe treiben – beispielsweise bei einer Dunkelflaute wie etwa im November 2024.
Deutschlands Energiewende braucht mehr Strom
Das Thema Energie ist für Deutschland und seine Wirtschaft von enormer Bedeutung. Die erneuerbaren Energien sollen aufgrund der Klimakrise weiter ausgebaut werden, von aktuell etwas mehr als 50 Prozent Anteil am Stromverbrauch auf mindestens 80 Prozent bis zum Jahr 2030. Hinzu kommt: Die zunehmende Elektrifizierung der Sektoren Verkehr, Industrie und Wärme führt dazu, dass sich der Strombedarf in Deutschland bis 2045 wahrscheinlich verdoppeln wird.
Bundesregierung verteidigt einheitliche Preiszone
Die deutschen Übertragungsnetzbetreiber sehen diese Studie kritisch: Das Ergebnis sei derzeit nicht geeignet, um eine Aufteilung der bestehenden Preiszone zu begründen.
Das Bundeswirtschaftsministerium schreibt dazu in seiner Analyse "Strommarktdesign der Zukunft": "Eine große, einheitliche Gebotszone mit vielen Marktteilnehmern sorgt für hohe Liquidität im Stromhandel." Ein weiteres Argument gegen die Aufteilung: "In kleineren Gebotszonen können Strombeschaffungskosten steigen, da in den einzelnen Zonen weniger - und damit auch weniger günstige - Optionen zur Verfügung stehen." Zudem bringe "die hohe Komplexität" einer Neueinteilung viele Unwägbarkeiten mit sich. Zu den Kritikern einer möglichen Neuregelung gehören auch die Bundesnetzagentur, der Verband der erneuerbaren Energien (BEE) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU).
Netzausbau verändert Rahmenbedingungen
Außerdem ist in dem nach Vorgaben der EU erstellten Bericht vieles noch gar nicht eingerechnet – unter anderem der bereits auf Hochtouren laufende Netzausbau zwischen Nord- und Süddeutschland. Wichtige Leitungen wie Südlink und Südostlink wären bereits in Betrieb, bevor der neue Strompreiszonen-Zuschnitt in Kraft wäre – und würden die Grundlagen des Strommarkts deutlich verändern.
Regionale Preisunterschiede prägen Industriestandorte
Die wichtigste Folge von verschiedenen Strompreiszonen wäre wohl: Über das Jahr würden Unterschiede im Strompreis zwischen den Zonen entstehen. Experten gehen davon aus, dass dann Industrie-Betriebe im Süden Deutschlands durchschnittlich mehr für ihren Strom an der Börse zahlen müssten. In welchem Maße, das ist schwer abzuschätzen. Die regionalen Preisunterschiede könnten außerdem Auswirkungen auf die räumliche Ansiedlung von Industrie, Erneuerbare-Energie-Anlagen, Speichern und Elektrolyseuren zur Wasserstoff-Gewinnung haben. Die Auswirkungen auf Privathaushalte sind unklar: Aber zwei Studien, die die Auswirkungen auf die gesamten Stromkosten, inklusive Netzentgelte, im Jahr 2035 betrachten, kommen zu dem Ergebnis, dass der durchschnittliche Strompreis durch eine Teilung der Strompreiszone sinken würde.
Union lehnt unterschiedliche Preiszonen strikt ab
Neben Bayern haben sich auch Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gegen eine Aufteilung des Landes in Strompreiszonen positioniert. Norddeutsche Bundesländer wie Schleswig-Holstein dagegen fordern die Aufteilung. Nun muss sich die neue Bundesregierung in den kommenden sechs Monaten mit der Analyse der europäischen Netzbetreiber befassen. In den Koalitionsverhandlungen hatte sich die SPD dafür eingesetzt, Veränderungen am Status quo zumindest zu prüfen. Am Ende setzten sich CDU und vor allem CSU aber durch, im Koalitionsvertrag heißt es: "Wir halten an einer einheitlichen Stromgebotszone fest."
Deutschland wird voraussichtlich also einer Neuordnung der Strompreiszonen auf EU-Ebene nicht zustimmen. Damit ist das Thema aber nicht vom Tisch: Falls im Laufe des Jahres 2025 keine einstimmige Entscheidung der EU-Mitgliedsstaaten zustande kommt, trifft die EU-Kommission innerhalb von sechs Monaten eine endgültige Entscheidung über den künftigen Zuschnitt der Strompreiszonen. Dies wäre nach jetzigem Zeitplan spätestens im Frühjahr 2026 der Fall. Eine Neuregelung der Preiszonen umzusetzen, das dürfte jedenfalls Jahre dauern.