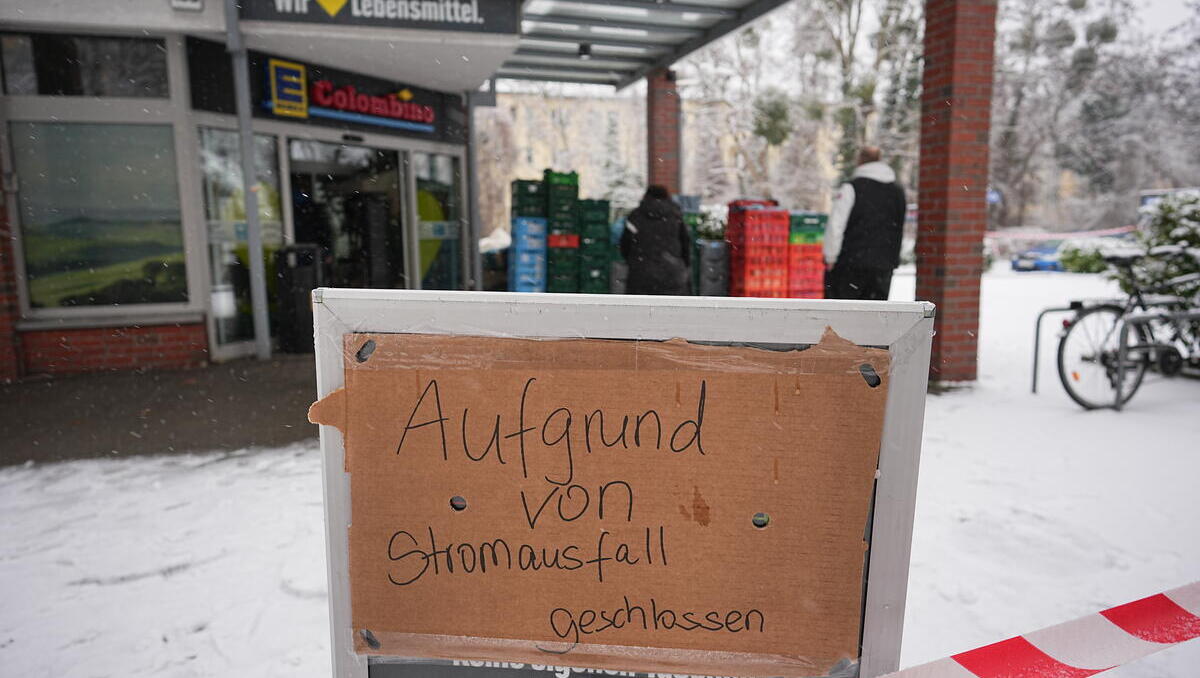Peter Thiel und das Weltbild der Tech-Milliardäre
Im Juli 2025 verhängte der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine Strafe von 2,4 Milliarden Euro gegen Google wegen wettbewerbswidriger Praktiken. Im Kern ging es um die Bevorzugung eigener Dienste in der Google-Suche und die Frage, ob der Konzern seine marktbeherrschende Stellung zulasten von Wettbewerbern missbraucht hat. Bereits im Juni war Apple verpflichtet worden, 13 Milliarden Euro an den irischen Staat nachzuzahlen. Der Grund: Steuervergünstigungen, die Dublin dem Konzern seit den 1990er-Jahren gewährt hatte und welche die EU-Kommission als unzulässige staatliche Beihilfe wertete. Beide Urteile haben eine Vorgeschichte. Die Google-Klage geht auf ein Verfahren der EU-Kommission aus dem Jahr 2017 zurück und wurde seitdem durch mehrere Berufungen des US-Konzerns verzögert. Der Streit um Apples Steuerpraxis in Irland begann im Jahr 2016, wurde 2020 zunächst vom Gericht ausgesetzt und erst nach erneuten Anhörungen wieder aufgenommen.
Zwar sind Milliardenstrafen aus Brüssel keine Ausnahme mehr, doch die beiden jüngsten Urteile des EuGH im Umgang mit Big Tech markieren eine neue Qualität. Erstmals wurden innerhalb weniger Wochen gleich zwei Verfahren gegen die wertvollsten Unternehmen der Welt mit zweistelligen Milliardensummen abgeschlossen. Zudem zeigte sich, dass Brüssel seine Linie gegenüber Big Tech durchaus konsequent bis zum Ende durchsetzen kann.
Während Brüsseler Richter Milliardenstrafen gegen US-Konzerne wie Google und Apple verhängen, herrschen im Silicon Valley ganz andere Leitbilder. SpaceX-Gründer Elon Musk erklärte im Frühjahr 2025 auf einer Investorenkonferenz in Austin, die Zukunft sei „eine ohne Grenzen, in der Regulierung nur ein Hemmschuh“ sei. Wenige Wochen später legte Meta-Chef Mark Zuckerberg nach: Regulierung könne zwar Innovation bremsen, doch Unternehmen wie Meta seien „zu groß, um gestoppt zu werden“.
Eine Analyse der Stiftung Neue Verantwortung, eines Think Tanks für Technologie- und Sicherheitspolitik mit Sitz in Berlin, beschreibt das Selbstverständnis der Tech-Eliten im Frühjahr 2025 als „libertären Kapitalismus“, in dem staatlichen Regeln als Bedrohung und nicht als Rahmenbedingung gesehen werden.
„Ich glaube nicht länger, dass Freiheit und Demokratie miteinander vereinbar sind.“ (PayPal-Mitgründer Peter Thiel)
Laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2025 versteht sich Big Tech längst als politische Kraft, in der sich die Milliardäre des Silicon Valley als Architekten einer neuen Weltordnung sehen. Das Kalkül von Bezos, Zuckerberg und Musk ist offenkundig: Wer die digitale Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert auch die politische Macht. In seiner vielbeachteten Biografie „The Contrarian: Peter Thiel and Silicon Valley’s Pursuit of Power“ skizziert der US-Journalist Max Chafkin den deutschstämmigen PayPal-Gründer und Milliardär als eine Mischung aus Tech-Guru, Philosophenkönig und Staatskritiker und als Architekten eines neuen Denkansatzes: Freiheit über alles, staatliche Kontrolle als Hindernis, Chafkin beschreibt ihn als „contrarian“, also als jemanden, der sich systematisch gegen alle gängigen Narrative positioniert.
Thiels Geist des staatsfeindlichen Libertariers prägt bis heute das Denken im Silicon Valley und beeinflusst die Haltung so gut wie aller Tech-Milliardäre gegenüber staatlicher Regulierung. In Europa richtet sich die Sorge genau auf dieses Weltbild – allerdings weniger in seiner ideologischen Form, sondern auf seine praktischen Folgen: aggressive Steuervermeidung, zunehmende Marktkonzentration und ungleicher Wettbewerb.
Die „Paypal“-Mafia
| 1998 gründen Peter Thiel und Max Levchin an der Eliteuni Stanford das Start-up Confinity. Quasi gegenüber arbeitet Elon Musk mit X.com an einer Online-Bank. 2000 fusionieren beide Firmen zu PayPal. Musk will die Marke in „X“ umbenennen, doch Thiel setzt sich durch und Musk verlässt das Unternehmen. 2002 verkauft Thiel PayPal für 1,5 Milliarden Dollar an eBay. Aus dem Gründerkern erwächst ein Netzwerk, das als „PayPal-Mafia“ bis heute das Silicon Valley prägt. Thiel baut mit Palantir ein einflussreiches Softwarehaus auf (heute geführt von Alex Karp), Musk gründet Tesla und SpaceX und nutzt seine Reichweite auch politisch. Reid Hoffman schafft LinkedIn, Levchin das Fintech Affirm und David Sacks den Dienst Yammer. 2007 verleiht das US-Magazin Fortune der Gruppe mit einem inszenierten Titelblatt den bis heute bekannten Namen. |
Brüssel auf Steuerjagd bei Big Tech
Das Kalkül der US-Tech-Konzerne ist in Brüssel seit Jahren bekannt. Entsprechend verfolgt die EU-Kommission schon seit 2018 einen zweifachen Ansatz: Einerseits wurden Pläne für eine europäische Digitalsteuer vorgelegt. Vorgesehen war eine Abgabe von drei Prozent auf die Umsätze großer Digitalkonzerne, die weltweit mehr als 750 Millionen Euro und in der EU mindestens 50 Millionen Euro erzielen. Ziel war es, Gewinne dort zu besteuern, wo sie entstehen – bei den europäischen Nutzern.
Parallel dazu verschärfte Brüssel ab 2017 das Wettbewerbsrecht. Zunächst leitete die EU-Kommission milliardenschwere Verfahren gegen Google und Apple ein. Mit dem Digital Markets Act und dem Digital Services Act folgten zudem neue Regulierungsrahmen, die seit 2024 verbindlich gelten.
„Indem wir unsere Wettbewerbspolitik und digitale Regulierung durchsetzen, sorgen wir dafür, dass Big Tech sich fair verhält.“
(EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera)
Dennoch blieben die Gewinne der „Big Five“ ungebrochen: So steigerte Alphabet 2024 den Überschuss auf über 100 Milliarden Dollar, Apple erwirtschaftete knapp 94 Milliarden, Microsoft 88 Milliarden, Meta 62 Milliarden und Amazon 59 Milliarden Dollar. Dies ist vor allem durch eine niedrige effektive Steuerlast möglich. So können die Konzerne ihre Abgaben deutlich senken, indem sie konzerninterne Verrechnungspreise nutzen und Gewinne in standortfreundliche Jurisdiktionen wie Irland und Luxemburg verlagern.
Der Körperschaftsteuersatz für „trading income“, also für Unternehmensgewinne, lag in Irland seit dem Jahr 2000 zunächst für neu gegründete Unternehmen bei 12,5 Prozent und wurde 2003 auf alle Unternehmen ausgeweitet. Damit verschaffte sich Irland über zwei Jahrzehnte einen Standortvorteil, der Tech-Giganten wie Apple, Google, Meta oder Microsoft nach Dublin zog. Erst 2024 wurde im Rahmen der OECD-Reform für große Unternehmensgruppen ein Mindeststeuersatz von 15 Prozent eingeführt. In Deutschland liegt sie, inklusive Gewerbesteuer und Solizuschlag, zwischen 29 und 33 Prozent.
In Luxemburg betrug der kombinierte Satz aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer bis vergangenes Jahr 24,94 Prozent, ehe er zu Beginn dieses Jahres auf 23,87 Prozent gesenkt wurde. Dass internationale Konzerne trotzdem dort ansässig sind, liegt an großzügigen Ausnahmeregeln, individuellen Vereinbarungen mit den Steuerbehörden und einer über Jahrzehnte gewachsenen Infrastruktur für Holdinggesellschaften. Damit bietet das Herzogtum Unternehmen ähnliche Gestaltungsspielräume wie Irland, wenn auch auf einem anderen Weg.
Wie Trump Europas Digitalsteuer blockiert
August 2019, G7-Gipfel im französischen Atlantik-Badeort Biarritz: US-Präsident Donald Trump droht Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron mit Strafzöllen auf Wein und Käse. Anlass ist die Entscheidung von Paris, als erstes EU-Land eine Digitalsteuer auf die Umsätze von Google, Apple und Facebook einzuführen. Für Trump, seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin ein No-go. Ihre prompte Botschaft an Macron fällt unmissverständlich aus: Wer amerikanische Tech-Konzerne mit Sonderabgaben belegt, riskiert einen Handelskrieg.
„Wenn Frankreich oder die EU ihre Digitalsteuer einführen, dann belegen wir sie mit Zöllen auf Wein und Käse. So einfach ist das.“ (US-Präsident Donald Trump)
Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025 erneuerte Trump seine Drohungen. Diesmal allerdings nicht nur gegen Frankreich, sondern gegen die gesamte EU. Digitale Steuern, der Digital Markets Act und der Digital Services Act seien nichts anderes als Diskriminierung amerikanischer Firmen, schreibt er auf seiner Plattform Truth Social. Gleichzeitig kündigt er Strafzölle auf europäische Exporte und Exportbeschränkungen für Chips und andere Hightech-Komponenten an.
Für Brüssel ist die Lage heikel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera betonen öffentlich die regulatorische Autonomie Europas, doch hinter den Kulissen wächst die Sorge, dass harte US-Zölle den Binnenmarkt empfindlich treffen könnten. Schon die ersten Pläne für eine Digitalsteuer im Jahr 2018 scheiterten am Widerstand einzelner Mitgliedstaaten, allen voran Irland.
Statt eine eigene Digitalsteuer einzuführen, schließt sich die EU im Oktober 2021 der globalen Lösung der OECD an. 136 Staaten, darunter auch die USA, einigen sich auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent, die ab 2024 gelten soll. Für einen Moment scheint der große Wurf gelungen. OECD-Generalsekretär Mathias Cormann spricht von einem „historic agreement“, die G20 in Rom feiern das Abkommen als Meilenstein. Brüssel kann einen drohenden Handelskonflikt mit Washington abwenden und die Steuerfrage erstmals auf eine internationale Ebene heben.
Mindeststeuer: Globale Lösung mit Schlupflöchern
Doch die anfängliche Euphorie über die OECD-Einigung währt nicht lange. Hinter dem Abkommen steckt ein politischer Kompromiss, der auf Ausnahmen und Sonderregelungen basiert. Zahlreiche Branchen werden verschont, großzügige Abschreibungen und die Anrechnung nationaler Förderungen mindern den Effekt. Die Zeit analysiert im April 2025, Europa habe „eine globale Lösung akzeptiert, die viele Schlupflöcher lässt und kaum den ursprünglichen Anspruch erfüllt“.
Gerade Irland, das jahrzehntelang mit niedrigen Steuersätzen erfolgreich Big-Tech-Konzerne angelockt hat, steht im Fokus der Kritik. Denn sollte die 15-Prozent-Grenze strikt angewendet werden, würden zwar die Steuereinnahmen des Landes steigen, es würde aber zugleich seine Standortattraktivität verlieren. „Das irische Modell gerät unter Druck, die EU steht vor einem Umbruch“, heißt es in einer Analyse des Digital-Thinktanks Basecamp, einer zum Telefónica-Konzern getragenen Plattform für Fragen der Digitalpolitik, aus dem Februar 2022. Weil die OECD-Lösung in den Augen vieler EU-Mitgliedstaaten nicht ausreicht, nehmen nationale Vorstöße an Gewicht zu.
Big Techs Gegenwehr: Malicious Compliance und Lobbydruck
Doch nicht nur Washington und einzelne EU-Staaten bremsen. Auch die Tech-Konzerne selbst gehen auf Konfrontationskurs und versuchen, neue EU-Regeln wie den Digital Markets Act (DMA) und den Digital Services Act (DSA) durch „malicious compliance“ auszuhöhlen. Das heißt, sie setzen die Gesetze zwar formal um, schränken aber parallel ihre Dienste ein oder schaffen neue Hürden.
Gleichzeitig fließen Milliarden an US-Dollars in Lobbyarbeit. Nach Angaben der Organisation Corporate Europe Observatory geben die großen Digitalkonzerne in Brüssel jährlich mehr als 100 Millionen Euro für politische Einflussnahme aus. Damit übertreffen sie sogar die Öl- und Pharmaindustrie.
Die Strategie der Digitalkonzerne ist klar: Regulierung verzögern und die öffentliche Debatte beeinflussen. „Big Tech ist nicht nur ein ökonomischer, sondern ein politischer Machtfaktor geworden“, resümiert eine Studie der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Jahr 2023.
„Die EU zeigt Zähne”
Die EU hat in den vergangenen Jahren zwei zentrale Instrumente geschaffen, um die Macht der Plattformkonzerne zu begrenzen. Der Digital Markets Act (DMA) richtet sich an sogenannte „Gatekeeper“, also Plattformen, die eine besonders dominante Rolle einnehmen. Sie dürfen ihre eigenen Dienste nicht bevorzugen und müssen Schnittstellen für Wettbewerber öffnen. Der Digital Services Act (DSA) zielt stärker auf Inhalte. Danach sind Plattformen verpflichtet, illegale Beiträge schneller zu löschen und offenzulegen, nach welchen Kriterien ihre Algorithmen Inhalte sortieren.
Bei Verstößen drohen Strafen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Die Tagesschau kommentierte im Frühjahr 2025: „Die EU zeigt Zähne, doch die Frage bleibt, ob sie zubeißen kann.“ Denn Verfahren ziehen sich oft über Jahre hin, während sich digitale Märkte in wenigen Monaten verschieben können.
Innovation oder Abschreckung?
Die Befürworter einer Digitalsteuer und strenger Regeln argumentieren, dass ohne klare Vorgaben der Wettbewerb kippt. Kleinere Anbieter haben kaum Chancen, mit den großen Plattformen mitzuhalten, und Innovationen drohen auf der Strecke zu bleiben. Die Stiftung Neue Verantwortung bezeichnet die Digitalsteuer deshalb als „Instrument europäischer Souveränität“.
Kritiker hingegen sehen die Gefahr, dass Europa seine Attraktivität für Investitionen schwächt. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) warnte bereits 2022, eine unilaterale Digitalsteuer könne „Investitionen abwürgen und Verbraucher belasten“.
Die Balance ist heikel: Europa will innovationsfreundlich sein und gleichzeitig Marktmacht begrenzen. Je länger die Umsetzung dauert, desto größer wird der Rückstand gegenüber den USA und China.
Europa hadert und Big Tech kapert (das Bankgeschäft)
Ein Thema, das in den politischen Diskussionen in Brüssel und Berlin bislang scheinbar zu kurz kommt, ist der Vorstoß großer Technologieunternehmen in den Finanzsektor. Schon 2017 warnte das US-Politik- und Wirtschaftsportal Axios in einem Beitrag mit dem Titel „Big tech’s next prey: Big Finance“ davor, dass Apple, Google oder Amazon als nächste große Beute die Finanzbranche ins Visier nehmen könnten.
Auch in Deutschland beschäftigt man sich schon länger mit diesem Thema. So veröffentlichte die Deutsche Bundesbank im September 2019 eine Studie mit dem Titel „BigTechs – GameChanger für Finanzindustrie und Zahlungsverkehr?”. Darin warnt Joachim Wuermeling, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank:
„BigTechs werden die Finanzindustrie im Allgemeinen und den Zahlungsverkehr im Speziellen tiefgreifend verändern – und, vielleicht noch wichtiger, sie tun dies bereits heute.“
(Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling)
Tatsächlich haben die Konzerne mit Diensten wie Apple Pay, Google Wallet oder Amazon Lending den Einstieg längst vollzogen. Mittlerweile spricht die Deutsche Bundesbank für das Jahr 2025 von einer möglichen „Erosion traditioneller Geschäftsmodelle“. Denn wenn Technologieunternehmen Finanzdaten, Konsumverhalten und Marktplatzinformationen kombinieren, entsteht eine Machtkonzentration, die den Wettbewerb verschiebt und potenziell auch systemische Risiken für die Finanzstabilität erzeugt.
Zwar fallen Zahlungsdienste in den Anwendungsbereich der EU-Zahlungsdiensterichtlinie, doch angesichts der engen Verzahnung mit dem Plattformgeschäft dürften sich nicht nur die Frankfurter Finanzaufseher fragen, wie verhindert werden kann, dass Finanzdaten zur Verstärkung marktbeherrschender Stellungen genutzt werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich künftig Aufsicht und Verbraucherschutz sicherstellen lassen, wenn Technologieunternehmen zugleich Händler, Zahlungsanbieter und Kreditgeber sind.
„Wenn Apple Finanzdaten sammelt, hat das eine andere Dimension als bei einer Regionalbank“, hieß es in einer Analyse des Handelsblatts. Der Befund macht deutlich, dass die Technologiekonzerne im Finanzsektor nicht mehr nur als Wettbewerber auftreten, sondern zunehmend Merkmale eines systemischen Risikofaktors zeigen.
Das geopolitische Spannungsfeld
Die Auseinandersetzung um Steuern und Regulierung ist daher längst nicht mehr nur eine wirtschaftspolitische Frage. Denn Big Tech fungiert zunehmend als Instrument amerikanischer Machtprojektion. Schon 2020 warnte Benjamin Revcolevschi, Europachef des französischen Cloud-Anbieters OVHcloud, in der Financial Times: „Wenn Europa die digitale Kontrolle verliert, verliert es die politische Kontrolle.“
Trumps zweite Amtszeit und sein erratisches Zollgebaren haben diese Konfliktlage weiter verschärft. Laut der Heinrich-Böll-Stiftung nutzen Elon Musk, Mark Zuckerberg und andere Milliardäre ihre Nähe zur US-Regierung, um europäischen Regulierungsdruck abzuwehren.
„Die Zukunft ist ein Ort ohne Grenzen, in dem Regulierung nichts anderes ist als ein Hemmschuh.” (Tesla-Gründer Elon Musk)
Zugleich eröffnet China europäischen Unternehmen zwar Investitionsmöglichkeiten, verlangt im Gegenzug jedoch Marktzugang und Technologietransfers. Damit gerät Europa in eine doppelte Abhängigkeit und sitzt zwischen den Stühlen Pekings und Washingtons.
Brüsseler Lackmustest aus Steuern, Regulierung und Investitionen
Die künftige Antwort Brüssels soll auf drei Pfeilern basieren. Erstens wird nach wie vor über eine europäische Digitalsteuer verhandelt. Ob und wann diese eingeführt wird, ist offen. Zwar gilt seit Anfang 2024 die globale Mindeststeuer, deren Wirkung dürfte wegen zahlreicher Ausnahmen jedoch begrenzt bleiben.
Zweitens betrachtet die EU die Umsetzung des Digital Markets Act und des Digital Services Act, flankiert von Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, als zentrales Instrument.
Drittens sollen Investitionen in Programme wie „Digital Europe“ und den „Sovereign Infrastructure Fund“, an dem sich mehr als 90 Unternehmen beteiligen, eine eigenständige digitale Basis schaffen. Ob diese Strategie trägt, ist ungewiss.
Und so wird Europa wohl auch künftig von US-Technologiekonzernen abhängig bleiben. Hinzu kommen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen Washingtons, die durch das unvorhersehbare Verhalten des amtierenden US-Präsidenten für zusätzliche Unsicherheit sorgen.