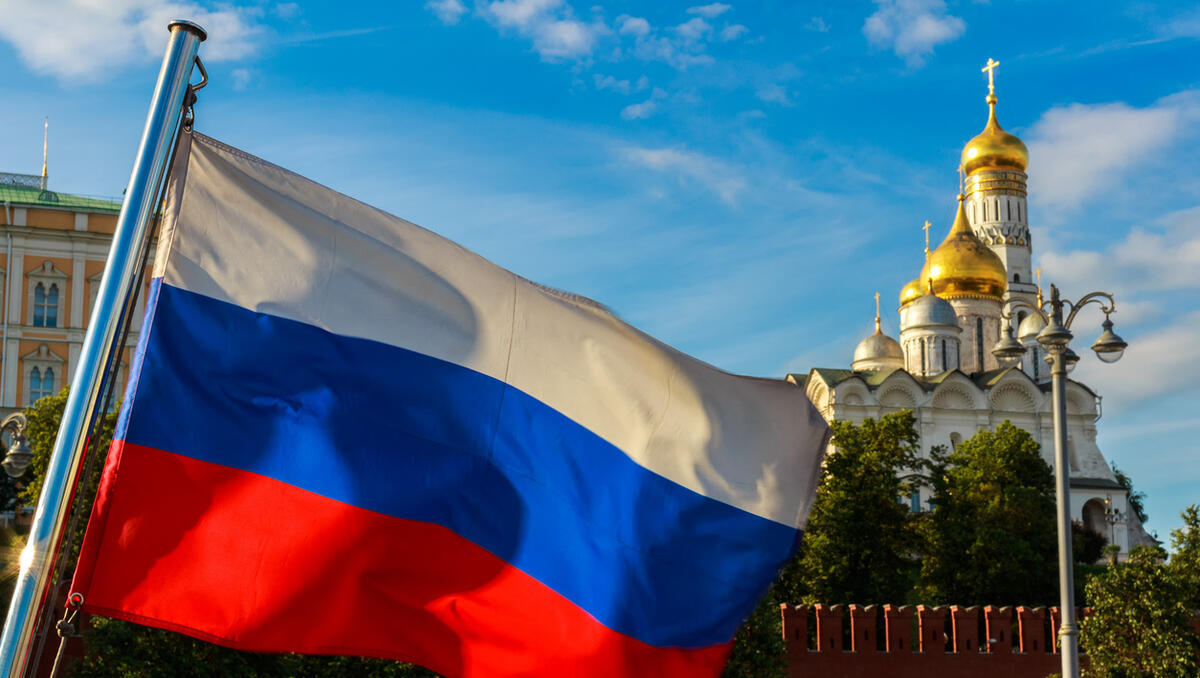Laut einer Studie des Ifo-Instituts ist das Bundesland Bayern seit 2019 kein Exportland mehr. Bayern bezieht mehr Waren aus dem Ausland als es exportiert. Seit 2019 stieg das Defizit im Güterhandel kontinuierlich an und erreichte 2022 einen Wert von 34,2 Milliarden Euro. Die Volkswirte schätzen, dass 80 Prozent des Güterdefizits auf strukturelle Gründe zurückzuführen ist. Daneben gab es krisenbedingte Effekte durch Corona und einen Preiseffekt infolge des Ukrainekrieges (Verteuerung von Energieimporten).
Die obigen Daten beziehen sich nur auf den Handel mit Sachgütern. Im Dienstleistungs-Segment sieht die Lage allerdings nicht besser aus. Bayern hatte 2022 ein Dienstleistungs-Defizit in Höhe von 20,4 Milliarden Euro. Insgesamt ergibt sich damit für den Freistaat ein Außenhandelsdefizit von 54,5 Milliarden. Das Ifo-Institut geht von einem dauerhaften Trend aus.
Bayerische Industrie nicht mehr so stark wie früher
Schaut man sich die Entwicklung in den einzelnen Industrien an, fällt auf, dass einige wichtige bayerische Exportbranchen zwischen 2019 und 2022 einen erheblichen Rückgang ihrer Exportüberschüsse erlebt haben, teilweise bis in den negativen Bereich. Besonders heftig war der Einbruch bei der Herstellung von elektrischer Ausrüstung. Auch metallische und chemische Erzeugnisse wurden vermehrt im Ausland produziert.
Die Automobilbranche, auf die knapp ein Viertel der bayerischen Exporte entfällt, wurde ebenfalls stark getroffen. Hier macht sich der allgegenwärtige Strukturwandel in den Daten bemerkbar. Bei Verbrennern findet ein Großteil der Fertigung in Deutschland beziehungsweise Bayern statt. Elektroautos hingegen werden einerseits generell vermehrt importiert und andererseits benötigen die deutschen Autobauer für die Produktion teure Vorprodukte (vor allem Batterien und Batteriemetalle), die zu einem sehr viel größeren Teil aus dem Ausland bezogen werden als bei Verbrennern.
Seit 2018 sinkt Bayerns Industrieproduktion fast im Gleichschritt mit der Deutschlands und ist jetzt niedriger als 2015. Dagegen stieg der industrielle Output im restlichen Euroraum deutlich an, insbesondere in Österreich.
„Im Vergleich mit unseren direkten Nachbarn, scheint es in Deutschland und Bayern Standortfaktoren zu geben, welche die Industrieproduktion belasten“, kommentieren die Autoren. Die Zahlen zu den Direktinvestitionen bestätigen dies. Zum Beispiel investieren Chemiefirmen, Maschinenbauer und die Autoindustrie inzwischen lieber im Ausland – etwa in den europäischen Nachbarländern, den USA und China.
Zugleich dümpeln in Deutschland die gesamtwirtschaftlichen Investitionsquoten in vor sich hin, was die Ifo-Ökonomen als ein weiteres Zeichen für einen geschwächten Produktionsstandort interpretieren. Die BIP-Quote der Ausrüstungsinvestitionen sinkt (2022: 6,55 Prozent), die Anlageinvestitionen (22,5 Prozent) stagnieren.
Standort Bayern/Deutschland verliert an Boden
Es gibt viele strukturelle Probleme in Bayern und ganz Deutschland, allen voran hohe Energiekosten, die Steuerlast, ambitionierte Dekarbonisierungsziele, Fachkräftemangel und mangelnde Digitalisierung.Das aktuelle Exportdefizit sei aber nicht zwingend ein Anzeichen dafür, dass Güter „Made in Bavaria“ nicht mehr weltweit gefragt sind und dass der Industriestandort Bayern massiv an Wettbewerbsfähigkeit verliert. Darauf weisen die Studienautoren explizit hin. Produkte, die in Bayern/Deutschland entworfen, aber dann final im Ausland zusammengebaut werden, würden in den Exportzahlen nicht auftauchen. Das Handelsdefizit reflektiere auch das Kalkül deutscher Unternehmen, näher an Rohstoffen und Kunden zu produzieren („Nearshoring“).
Fakt ist jedoch: Der Freistaat gehört zu den Top-Bundesländern und trägt die größte Last im Länderfinanzausgleich. Bayern stand symbolisch für die jahrzehntelang starke Handelsbilanz der Bundesrepublik, die mittlerweile nur noch minimal positiv ist. Hohe Exportüberschüsse waren Ausdruck der wirtschaftlichen Stärke Bayerns. Dieser Zustand ist nun schon seit fünf Jahren vorbei und das ist bedenklich.
Dass Bayerns Exportindustrie an Boden verliert, steht exemplarisch für Deutschlands wirtschaftlichen Niedergang und die schleichende Deindustrialisierung. Deutschland ist das einzige Industrieland der Welt, dessen Wirtschaftsleistung aktuell schrumpft. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamt sank letztes Jahr die preisbereinigte Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent. Die Lage in den energieintensiven Branchen ist mitunter desolat. Die Stimmung im Mittelstand ist schlecht. Viele Unternehmen und Investoren kehren dem Standort Deutschland den Rücken. 2022 kam es zu einem Rekordkapitalabfluss (negative Netto-Investitionen) von 125 Milliarden Euro.
Was ist gegen das Exportdefizit und die Standortschwäche zu tun? In der Ifo-Studie wird eine Angebotspolitik empfohlen, die „eine Entfaltung der Stärken Bayerns in einem tiefgreifenden strukturellen Wandel zulässt.“ Als wichtige Punkte werden unter anderem mehr Investitionen in Bildung und Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz von Automatisierung und Digitalisierung genannt. Die Energiepolitik müsse angepasst, das Stromangebot unter „Ausnutzung aller Möglichkeiten“ erhöht werden. Die Standortbedingungen seien auf breiter Front zu verbessern (Unternehmenssteuern, Bürokratie, Infrastruktur). Zudem müsse Forschung und Entwicklung stärker gefördert werden, auch um neue Produktionsverfahren zu entwickeln, die Rohstoffabhängigkeiten reduzieren würden.
Link zur Originalstudie