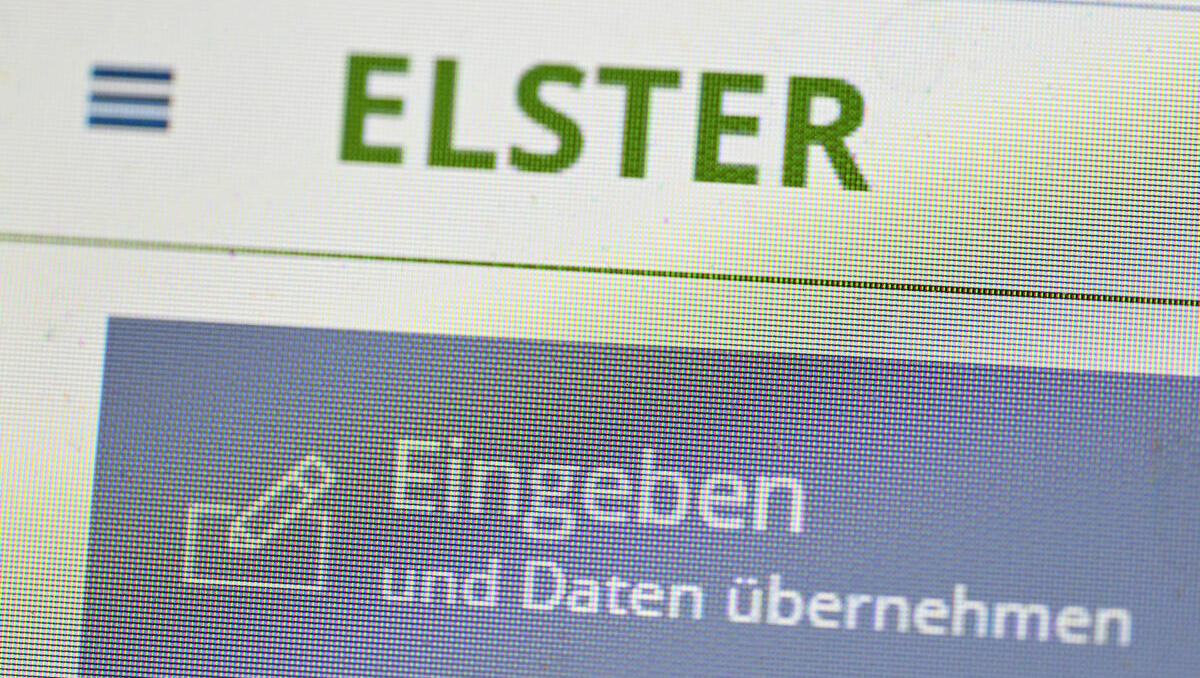DWN: „Deutschlands fette Jahre sind vorbei“ ist der Titel Ihres neuen Buches. Worauf gründete bisher Deutschlands Wohlstand und was hat sich in den letzten Jahren diesbezüglich verändert?
Gunther Schnabl: Der Wohlstand in Deutschland ist aus der marktwirtschaftlichen Wirtschafts- und Währungsreform des Jahres 1948 entstanden. Eine harte Deutsche Mark, die fortan von einer unabhängigen Deutschen Bundesbank gehütet wurde, bildete das Fundament für ein Wirtschaftswunder. Hohe Produktivitätsgewinne erlaubten steigende Löhne und den Ausbau des Sozialstaates. Die große Veränderung kam mit der Einführung des Euros im Jahr 1999, der schrittweise zu einer Weichwährung umgebaut wurde. Zentralbankfinanzierte Staatsausgaben, billige Energieimporte aus Russland und eine stärkere Ausrichtung der deutschen Wirtschaft auf China konnten für einige Zeit den Wohlstandsverlust, der aus dem weichen Euro resultierte, verdecken. Doch die Inflation, Zinserhöhungen der EZB, der Ukrainekrieg und eine geplatzte Immobilienblase in China haben die Realität nun sichtbar gemacht. Eine erhöhte Verhandlungsmacht der Gewerkschaften, der weitere Ausbau des Sozialstaates und eine immer weiter um sich greifende Regulierung führen unweigerlich zu dauerhaft erhöhter Inflation.
DWN: Die Inflation als Wohlstandsvernichter? Länder wie Italien hatten vor der Einführung des Euro doch auch ihren Wirtschaftsboom und hohen Wohlstand trotz zeitweiser hoher Inflationsraten?
Gunther Schnabl: Das ist richtig. Doch damals funktionierte der Währungswettbewerb in Europa noch. Während die unabhängige Deutsche Bundesbank eine stabilitätsorientierte Geldpolitik verfolgte, trugen die Banca d’Italia und die Banque de France zur Staatsfinanzierung bei. Deshalb waren die Inflationsraten in Italien und Frankreich höher und die Währungen werteten seit den 1970er Jahren immer weiter gegenüber der Deutschen Mark ab. Da die Aufwertung der Deutschen Mark deutsche Güter im Ausland teurer machte, waren die deutschen Unternehmen stetig gezwungen, die Effizienz zu erhöhen und gute neue Produkte zu entwickeln, um international wettbewerbsfähig zu blieben. Die daraus resultierenden Produktivitätsgewinne machten Deutschland und einige Nachbarländer, die ihre Währungen an die Deutsche Mark gebunden hatten, zu den Wachstumslokomotiven in Europa. Die südlichen Länder in Europa konnten über die Abwertungen ihrer Währungen gegenüber der Deutschen Mark und die gemeinsamen europäischen Institutionen an den Produktivitätsgewinnen partizipieren. Doch nun hat der weiche Euro die deutsche Industrie träge gemacht, so dass es nichts mehr zu verteilen gibt. Das schafft Verteilungskonflikte.
DWN: Nun liegt das Schicksal unserer gemeinsamen Währung in den Händen der EZB. Wie beurteilen Sie deren Politik der „Euro-Rettung“ in den letzten Jahren inklusive Mario Draghis berühmter Aussage „whatever it takes“?
Gunther Schnabl: Der Ausdruck „Koste es, was es wolle“ impliziert bereits, dass es Kosten gegeben hat. Ich meine damit nicht nur die milliardenschweren Rettungspakete und die umstrittenen Target2-Salden, sondern vor allem den umfangreichen Ankauf von Staats- und Unternehmensanleihen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Die EZB hat dadurch den Regierungen im Euroraum – insbesondere auch der deutschen Regierung – zusätzliche Finanzierungsspielräume eröffnet, die sie auf Dauer von Staatsanleihekäufen der EZB abhängig gemacht haben dürften. Der Widerstand gegen einen weichen Euro aus Deutschland scheint damit auf Dauer gebrochen. Die jüngste Ankündigung der EZB, dass sie im Rahmen ihrer neuen Strategie wieder Anleihen kaufen will, deutet darauf hin.
DWN: Ist der Euro also dazu verdammt, eine Weichwährung zu bleiben?
Gunther Schnabl: Ich sehe derzeit keine große Alternative. Die Ausgabenverpflichtungen aller Regierungen in der EU sind hoch, insbesondere im Sozialbereich. Mit den geringen Geburtenraten und der Alterung der Gesellschaften kommen wachsende Belastungen auf die gesetzlichen Rentensysteme zu. Hinzu kommt, dass die Regierungen unter Angela Merkel trotz eines immensen Anstiegs der Staatsausgaben die Infrastruktur und die Verteidigung vernachlässigt haben. Gleichzeitig wünschen sich immer mehr Arbeitnehmer eine bessere „Work-Life-Balance“. Und dann ist da noch die Herkulesaufgabe der Klimarettung. All das deutet auf eine dauerhaft weiche Währung hin.
DWN: Dabei war der Euro ja ursprünglich einmal angetreten, den Dollar in seiner Rolle als Weltleitwährung herauszufordern. Dieser Versuch ist gescheitert. Weil er eine Weichwährung ist? Und: Ist der Dollar dies nicht?
Gunther Schnabl: Frankreich hat mit dem Euro zwei Ziele verfolgt. Erstens sollte die währungspolitische Dominanz von Deutschland in Europa gebrochen werden. Ein Berater des französischen Präsidenten Francois Mitterand soll die Deutsche Mark als „Atombombe“ bezeichnet haben. Frankreich wollte bei den geldpolitischen Entscheidungen in Europa mitreden. Zweitens sollte die führende Rolle des US-Dollars als internationaler Leitwährung herausgefordert werden. Der Präsident Giscard d’Estaing hatte die Stellung des Dollars als Weltleitwährung als exorbitantes Privileg bezeichnet. Frankreich hat das erste Ziel erreicht. Bei Entscheidungen der EZB hat die Stimme der Deutschen Bundesbank heute das gleiche Gewicht wie die Stimme der Banque de France (und der Zentralbank von Zypern). Allerdings hat die bereits früh einsetzende schleichende Transformation des Euros in eine Weichwährung die Chancen des Euro als internationaler Leitwährung zunichte gemacht. Die Deutsche Mark hat in den 1970er Jahren dem Dollar den Leitwährungsstatus in Europa abgerungen, weil sie stabiler war. Ende der 1970er Jahre konnten sich die USA aufgrund der hohen Inflation im Ausland sogar nur noch in Deutschen Mark oder Schweizer Franken verschulden. Das war wahrscheinlich der Grund, warum die USA ab 1979 unter dem neuen Zentralbankpräsidenten Paul Volcker eine plötzliche geldpolitische Kehrtwende zurück zu einem stabilen Dollar vollzogen. Hingegen ist der Euro heute nicht stabiler als der Dollar. Zwar ist der Dollar inzwischen auch weich, aber der Euro ist weicher. Seit Ausbruch der europäischen Finanz- und Schuldenkrise wertet der Euro im Trend gegenüber dem Dollar ab.
DWN: Kritiker werden Ihnen entgegnen, dass der Euro deswegen nicht funktioniert, weil es zwar eine einheitlich Geld-, aber keine einheitliche Wirtschafts- und Sozialpolitik gibt. Was entgegnen Sie denen?
Gunther Schnabl: Ich würde sagen, dass sie recht haben. Der Euro war von Beginn an eine Fehlkonstruktion. Der Währungsraum ist sehr heterogen einschließlich sehr unterschiedlicher wirtschaftspolitischer Denkweisen. Die Finanz- und Sozialpolitiken sind nicht in Brüssel zentralisiert, so dass sie in unterschiedliche Richtungen laufen. Bereits kurz nach Einführung des Euros haben unkoordinierte Finanzpolitiken dazu geführt, dass die wirtschaftliche Entwicklung innerhalb des Euroraums stark auseinandergedriftet ist. In Deutschland hat die Regierung Schröder Ausgaben gekürzt und Anreize für mehr private Alterssicherung gesetzt. Aufgrund der Austeritätspolitik sind die wachsenden deutschen Ersparnisse in den Süden abgeflossen, wo sie den Konsum und Übertreibungen auf den Immobilienmärkten angeheizt haben. Das hat in die europäische Finanz- und Schuldenkrise geführt, die wiederum die Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB gerechtfertigt hat, obwohl diese eigentlich nach den europäischen Verträgen verboten sind.
DWN: Stehen wir an einem Scheideweg? Entweder mehr Subsidiarität oder mehr Zentralismus?
Gunther Schnabl: Im europäischen Integrationsprozess gab es von Anfang an zwei Strömungen. Das ordoliberale Deutschland und später auch das Vereinigte Königreich unter Margret Thatcher setzten auf den Binnenmarkt, also den freien Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Arbeitskräften und Kapital. Der Binnenmarkt hat großen Wohlstand geschaffen. Frankreich und einige südliche Länder brachten gemeinsame Institutionen wie die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und die Europäische Zentralbank voran. Die gemeinsame europäische Agrar- und Regionalpolitik ermöglichten die Umverteilung von Ressourcen vom Norden in den Süden. Während sich beide Integrationsansätze im Zeitverlauf die Waage gehalten haben, scheint seit mindestens zehn Jahren die Zentralisierung die Oberhand gewonnen zu haben. Die Europäische Zentralbank hat durch den umfangreichen Ankauf von Staatsanleihen deutlich an Einfluss gewonnen. Die Europäische Kommission war immer aktiver bei Regulierungen. Sie könnte ihren Einfluss weiter ausweiten, wenn sie auf Dauer das Recht erhalten würde, eigene Staatsanleihen, sogenannte Euro-Bonds, herauszugeben. Das ist bereits im Zuge der Coronakrise für die Finanzierung des Hilfsprogramms NextGenerationEU als Ausnahme geschehen. Der Ukrainekrieg könnte ein neuer Ausnahmetatbestand werden, um EU-Anleihen auf Dauer zu etablieren, wie man aus Brüssel hört.
DWN: Zur Zeit beobachten wir, dass die BRICS- Staaten versuchen, sich dem Diktat des Dollars zu entziehen und eine De-Dollarisierung der Weltwirtschaft voranzutreiben. Wie stehen ihre Chancen? Und wäre dies nicht auch eine Chance für den Euro?
Gunther Schnabl: Die BRICS-Staaten haben insbesondere seit der Jahrtausendwende über den Aufbau von großen Dollarreserven kostspielige Kriege und Finanzmarktrettungsmaßnahmen der USA mitfinanziert. Darüber sind diese nicht glücklich, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Pro-Kopf-Einkommen deutlich niedriger liegen als in den USA. Allerdings ist die Suche nach Alternativen nicht einfach. Im Gegensatz zu den 1970er Jahren, als die Deutsche Mark eine ernstzunehmende stabile Alternative zum Dollar war, gilt dies heute für den Euro nicht mehr. Zwar sind die BRICS-Staaten groß und haben ein großes Handelsvolumen, was eine Voraussetzung für ein Land ist, das eine internationale Währung stellen will. Aber es fehlen die hoch entwickelten Finanzmärkte, die nötig wären, um eine BRICS-Währung als internationale Anlagewährung attraktiv zu machen. Um die Stellung des Yuan im internationalen Währungssystem voranzutreiben, müsste China die Kapitalverkehrskontrollen abbauen und die Finanzmärkte liberalisieren. Das ist derzeit sehr unwahrscheinlich. Zudem wären die BRICS als Staatengebilde mit einer gemeinsamen Währung noch sehr viel heterogener als die Europäische Währungsunion. Da sind die Chancen des Bitcoins deutlich größer, den Dollar als internationale Währung herauszufordern.
DWN: Um es noch einmal zu verdeutlichen: Welche Bedeutung hätte ein stabiler Euro, um die geopolitische Bedeutung der EU im Kontext sich verschiebender Machtachsen auf dem Globus zu wahren?
Gunther Schnabl: Ein stabiler Euro, wie er eigentlich in den europäischen Verträgen verankert ist, würde die Reformkräfte und damit die Wirtschaftskraft der Europäischen Union stärken. Er könnte dem zunehmend weichen Dollar den Rang als Weltwährung leicht streitig machen, weil er bereits als internationale Währung etabliert ist und es hoch entwickelte Euro-Finanzmärkte gibt. Das würde den Regierungen des Euroraums langfristig große zusätzliche Ausgabenspielräume eröffnen, die beispielsweise zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft genutzt werden könnten. Allerdings scheinen die politischen Zielsetzungen der Mehrheit der Regierungen in der EU und auch der Europäischen Kommission eher kurzfristig ausgerichtet zu sein, so dass sie sich eher weiter auf zentralbankfinanzierte Staatsausgaben verlassen dürften. Es ist nicht ausgeschlossen, dass eines Tages die Europäische Zentralbank die Europäischen Union durch den Ankauf von EU-Anleihen finanziert. Wenn das der Fall ist, müssten wir uns auf mehr Inflation, einen weiteren Verfall des Wohlstands in Europa und damit eine sich beschleunigende Kapitalflucht in die USA einstellen. Damit das nicht passiert, mache ich in meinem Buch Vorschläge für eine „ordnungspolitische Wende“ in Deutschland und Europa, deren Rückgrat die Rückkehr zur Preisstabilität ist.
***
Info zur Person: Gunther Schnabl ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen der Universität Leipzig, wo er das Institut für Wirtschaftspolitik leitet. Er ist Senior Advisor beim Flossbach von Storch Research Institute. Sein Forschungsinteresse gilt Fragen der Geldwert- und Finanzmarktstabilität sowie der japanischen Volkswirtschaft.