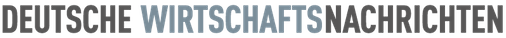Im zweiten Teil dieser Betrachtung wird deutlich, dass es sich bei der ungleichen Vermögensverteilung zwischen Ost und West nicht nur um eine Folge vergangener politischer Systeme handelt - lesen Sie dazu auch den Artikel Ungerechte Vermögensverteilung in Ost und West. Vielmehr sind es auch heutige wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen, die die Kluft weiter vertiefen. Doch wie genau sieht diese strukturelle Ungleichheit aus, und welche Folgen hat sie für die Generationen, die nach der Wiedervereinigung aufgewachsen sind? Ein genauerer Blick offenbart: Die Unterschiede sind gravierender, als viele ahnen.
Der geringe Anteil an Immobilienbesitzern im Osten hat jedenfalls vor allem historische Gründe. Während das Wirtschaftswunder im Westen es vielen Bürgern ermöglicht hat, Kapital (Geld, Gold und Aktien) und in Immobilien anzusparen, war in der DDR privater Vermögensaufbau bestenfalls auf einem Konto der Sparkasse möglich. Bei der Währungsunion mussten die Ersparnisse sogar auf die einzelnen Familienmitglieder umverteilt werden, um beim Umtausch die weitgehende Wertlosigkeit zu vermeiden.
Das häufig zu hörende Argument, die Bürger im Osten hätten doch auch 30 Jahre Zeit gehabt, ein Polster anzusparen und Vermögen zu bilden, geht fehl. Es so zu machen, wie die neuen Bekannten und Freunde aus dem Ersten vorexerzierten, ist nämlich rasch auf reale Standes-Grenzen gestoßen. Wer konnte vor 20 Jahren, als sich die ostdeutsche Gesellschaft in Abwicklung befand und ratlos nach Neuorientierung suchte, schon einen soliden Arbeitsvertrag vorweisen, um Vermögensaufbau nach bundesdeutschem Vorbild zu betreiben?
Der Ausverkauf der Grundstücke wurde wie ein Raubzug erlebt
Die Häuser waren zwar für eine gewisse Zeit sehr günstig, bei den Immobilienauktionen konnten indes nur selten Ostdeutsche mitbieten. Der Ausverkauf hat Spuren hinterlassen - für viele war es ein Raubzug.
Im Osten haben viele versucht aus ihrer existenziellen Not eine Tugend zu machen. Man versuchte es mit Selbständigkeit voran zu kommen, wenn es schon keine festen Jobs mehr gab. Was das praktisch heißt, hat etwa Anja Scholz 2007 anschaulich bei der Deutschen Bank am Prenzlauer Berg erlebt.
Null Bonität: Keine Arbeitsverträge, Selbstständige in prekären Verhältnissen
Die 31-Jährige wollte für ihre Alterssicherung sparen und überlegte deshalb, eine kleine Wohnung in Berlin zu erwerben. Als die Bankberaterin die (von ihr zur Einsicht verlangten) Steuerbescheide durchblätterte, lachte sie nur kurz lauthals auf. „Sie leben ja geradezu in prekären Verhältnissen“, sagte Anne B. höhnisch. „Wie wollen sie denn den Kredit für das Apartment je zurückzahlen?“
Der jungen Selbstständigen fehlten aus Sicht der Banken ein zum Kreditieren verlässlicher Arbeitsvertrag und die hinreichende Bonität. Sie brach das Projekt ab und ahnte, wie es in einigen Jahren mit ihrer Rente ausschauen würde. Die aus Westdeutschland Zugezogenen in ihrem Bekanntenkreis, legten derweil einfach das bei ihren Eltern oder Großeltern erbetene Vorerbe als Sicherheit auf den Tisch oder auch Bürgschaftserklärungen.
Die bittere Erkenntnis stößt im Nachhinein sauer auf: Der Wert der damals erworbenen Immobilie ist seither fast überall durch die Decke gegangen und wäre in nur noch sehr wenigen Jahren restlos abgestottert worden. Dafür ist jetzt zu spät! Die meisten jungen Leute in Städten wie Berlin befürchten, dass sie überhaupt keine Chance bekommen, die Anzahlung auf eine Immobilie zu leisten, angesichts der irrwitzigen Preise am Markt.
Die Deutschen liegen bei Eigentumsquote abgeschlagen im Peloton der Welt
Nun gut, die Eigentumsquote in Deutschland ist im europäischen Vergleich zwar auch im Westen gering. 57,9 Prozent aller Haushalte werden von Mietern bewohnt, befinden sich also in fremden Eigentum. „Deutschland hat unter den OECD-Staaten die zweitniedrigste Wohneigentumsquote. Die relativ hohe Grunderwerbssteuer und die fehlende steuerliche Abzugsmöglichkeit von Hypothekenzinsen für Eigennutzer sind zwei Gründe, bei denen der Staat ansetzen sollte“, sagt Cai-Nicolas Ziegler, CEO des Maklerportals Immowelt, die regelmäßig Vergleichsstudien zwischen Ost und West vorlegen. Er rät: „Immobilieneigentum ist ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge. Das Ziel der Politik muss sein, mehr Menschen den Zugang dazu zu erleichtern.“
Doch selbst in manchen Boom-Regionen sind die Zahlen geradezu dramatisch. In nur zwölf Prozent der Immobilien in Leipzig und 14 Prozent in Dresden wohnen tatsächlich Eigentümer, obwohl die Quadratmeterpreise dort im Vergleich zu den westdeutschen Großstädten vergleichsweise günstig wären.
Im Südwesten heißt es von jeher: „Schaffe, schaffe, Häuslebaue“
Deutlich besser sieht es indes nur in Baden-Württemberg und selbst in der dicht besiedelten Region Stuttgart aus, wo offenkundig das eherne Gesetz „Schaffe, schaffe, Häuslebaue“ Gültigkeit behält - und natürlich in Bayern. Entsprechend weisen die süddeutschen Städte Stuttgart (46 Prozent), München und Nürnberg (je 45 Prozent) den höchsten Anteil an Eigentumswohnungen auf.
„Es braucht ein gewisses Startkapital und darüber verfügen Haushalte in Ostdeutschland auch wegen niedrigerer Löhne tendenziell seltener“, lautet der Befund einer Studie des DIW für die Initiative „Forum for a New Economy“ von 2020. Insgesamt lassen sich auf das selbst bewohnte Haus zwischen elf und 16 Prozent Vermögensungleichheit zurückführen - und auf weiteren Immobilienbesitz zwischen 20 und 30 Prozent. Denn für Besserverdiener ist beim Eigenheim oft längst nicht Schluss. Sie kaufen immer häufiger Wohnungen, um sie gewinnbringend zu vermieten. Und durch diese Mieteinnahmen verschärft sich die Einkommensungleichheit. Einkommen aus Vermietung und Verpachtung werden gesellschaftlich immer wichtiger, sind abwe nur einseitig zwischen Ost und West verteilt.
Zwar ist auch im Osten der Anteil der Immobilien-Eigentümer seit der Wende von rund 25 Prozent auf 40 Prozent angestiegen, doch verglichen mit Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein ist das immer noch wenig. Hier liegt die Quote bei teilweise 60 Prozent. Unter den zehn Städten mit der niedrigsten Eigentumsquote befinden sich indessen neun Städte aus den neuen Bundesländern - selbst Berlin liegt immer noch darunter. Wobei Chemnitz (16 Prozent) mit Quadratmeterpreisen bei 1.100 Euro so günstige Kaufpreise wie kaum eine andere Stadt aufweist. Nur Salzgitter in Niedersachsen ist im Westen ähnlich billig zu haben.
Wo Volkseigentum herrschte, gäbe es keinen Vermögensaufbau mit Wohnungen
Wenn man sich die Lage im Ost-Teil Berlins vergegenwärtigt, mit seinen Plattenbauten im kommunalen Bestand, wird schlagartig das Dilemma offenkundig. Wo es kaum Eigentumswohnungen zum Erwerb gab (und gibt), weil der Übergang von Volkseigentum in den Bezirken nahtlos zu landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften erfolgt ist, haben junge Leute keine große Chance, ein eigenes Zuhause abzuzahlen und müssen auf stabile Mieten in aller Ewigkeit hoffen - ein Unsicherheitsfaktor, der belastet.
Im West-Teil Berlins hingegen befindet sich fast die gesamte Altbausubstanz seit jeher in Familienbesitz und wird von Generation zu Generation weitervererbt. Als Modebegriff hat sich das „Family Office“ etabliert, die dynastisch das Altvermögen für Kinder und Kindeskinder pflegen und vermehren sollen.
„Family Offices“ im Westen, im Osten kämpft jeder für sich allein
In Ostdeutschland kämpft indessen jeder für sich allein. Wohl erst die nächste Generation bekommt vielleicht die berechtigte Chance, ein Häuschen von den Großeltern in ruraler Umgebung zu erben, was natürlich nicht ansatzweise mit dem Wert einer städtischen Eigentumswohnung vergleichbar ist und die Schere weiterhin offen lässt - und verschärft.
Mit bloßer Arbeit wird sich die so grundverschiedene Ausgangslage bestimmt nicht mehr nivellieren lassen. Das hat sich über die Soziologen und Volkswirte allmählich auch in der Politik herumgesprochen. Die in gewissen Kreisen virulenten Diskussionen um ein sogenanntes Grunderbe muten allerdings geradezu hilflos an. Es wären erst grundsätzlich unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe vonnöten, bei Abschreibung und Steuersatz etwa, was freilich den Gleichbehandlungs-Grundsatz tangieren würde und deshalb in der Debatte regelmäßig bereits von vornherein verworfen wird.
Die Gretchenfrage: Wie halten wir es künftig mit der Erbschaftssteuer?
Bleibt die Frage nach der Erbschaftssteuer. „Da wäre natürlich schon die Politik in der Pflicht, diese Ungleichheit von Privat- und Betriebsvermögen aufzulösen und neu zu gestalten“, sagt Prof. Schumberger. „Die soziale Frage ist ja in vielen Bereichen brandaktuell: Wohnung, Bildung, Vermögensverteilung. Doch die Politik reagiert darauf kaum. Und eine Novellierung der Erbschaftssteuer scheint aktuell erst recht gar nicht auf der politischen Agenda zu stehen.“ Für den Soziologen frustrierend: „Mit anderen Themen lassen sich derzeit wohl mehr Wähler gewinnen als mit Fragen von Verteilung oder sozialer Gerechtigkeit.“ Dafür müssen wohl erst Wahlen das Boot zum Kippen bringen.