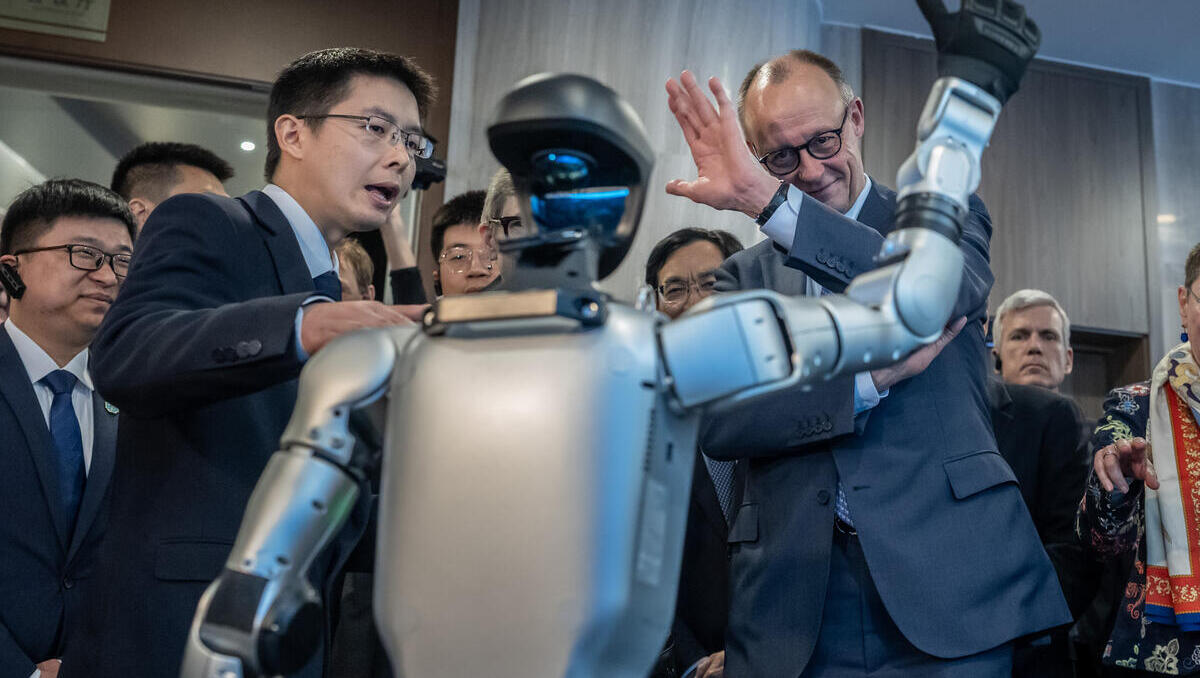Private Windkraftanlage: Lohnt sich das?
Windkraft spielt eine zentrale Rolle bei der Stromerzeugung – zumindest bei großen Anlagen. Sowohl die Windenergie an Land als auch Offshore-Windparks spielen eine bedeutende Rolle für die Energiewende. Doch wie sieht es bei kleinen Windkraftwerken für den Privatgebrauch aus? Wer mit einem Miniwindkraftwerk Strom erzeugen möchte, merkt schnell: Die Wirtschaftlichkeit hängt stark vom Standort ab und ist schwer kalkulierbar.
Lohnt sich eine private Windkraftanlage? Oder sollten Immobilienbesitzer davon lieber die Finger weg lassen? Klar ist: Es gibt einiges zu beachten - sowohl beim Kauf als auch bei der Montage.
Was sind private Windkraftanlagen? Definition
Eine private Windkraftanlage erzeugt Energie sowohl zur Selbstversorgung als auch für die Einspeisung ins öffentliche Netz. Es gibt sie in vielen verschiedenen Größen und Formen – sogar fürs Dach oder den Balkon. Die Rotorblätter haben meist eine Spannweite von zwei bis drei Metern. Solche Anlagen erreichen in der Regel eine Nennleistung von rund fünf Kilowatt, maximal 30 Kilowatt. Ihre Höhe beträgt typischerweise zehn bis 20 Meter. In Deutschland gelten je nach Bundesland und lokalen Vorschriften maximale Größen und besondere Regelungen.
Kleinwindkraftanlagen: Windenergie fürs Hausdach
- Kleinwindkraftanlagen: Für Wohngebiete und private Grundstücke geeignet, müssen aber sturmsicher sein.
- Hybride Systeme: Kombination aus Wind- und Solaranlagen zur Maximierung der Energieerzeugung.
- Mikro-Windkraftanlagen: Besonders kleine Turbinen für Dächer.
- Netzunabhängige Anlagen: Ideal für abgelegene Gebiete, oft mit Batteriespeichern kombiniert.
Bei Kleinwindanlagen unterscheidet man zwischen zwei grundlegenden Bauformen: Kleinwindkraftanlagen mit horizontaler oder vertikaler Rotorachse. Diese technische Unterscheidung beeinflusst sowohl die Leistungsfähigkeit als auch den Einsatzbereich der Anlagen.
Kleinwindkraftanlage horizontal
Horizontale Windkraftanlagen dominieren den Markt aufgrund ihrer hohen aerodynamischen Effizienz. Sie nutzen den Auftrieb, der durch die Luftströmung an den Rotorblättern entsteht. Typische Merkmale sind die horizontale Achse und die drei Rotorblätter. Es gibt zwei Haupttypen:
- Luv-Läufer: Die Rotorblätter befinden sich vor dem Mast in Windrichtung. Vorteil: Der Rotor weicht dem Windschatten aus.
- Lee-Läufer: Der Rotor ist hinter dem Mast angeordnet. Vorteil: Passive Windrichtungsnachführung, bei der sich die Anlage optimal zur Windrichtung ausrichtet.
Vorteile horizontaler Windkraftanlagen
- Gleichmäßige Belastung: Reduziert Schwingungen und verlängert die Lebensdauer.
- Höhere Masten möglich: Besonders im Binnenland steigert dies die Energieausbeute.
- Höherer Wirkungsgrad: Mehr Energie bei vergleichbarer Rotorfläche.
- Sturmsicherheit: Der Rotor kann aus dem Wind gedreht werden.
Kleinwindkraftanlage vertikal
Vertikale Windkraftanlagen wirken modern und futuristisch. Sie besitzen eine vertikale Rotorachse und gewinnen zunehmend Interesse – nicht zuletzt wegen ihres Designs. Doch im Vergleich zu horizontalen Anlagen haben sie einen geringeren Ertrag.
Nachteile vertikaler Windkraftanlagen
- Geringerer Wirkungsgrad: Eine Rotorfläche bewegt sich immer gegen die Windrichtung.
- Begrenzte Masthöhe: Schwingungen machen hohe Masten schwierig.
- Sturmsicherheit: Der Rotor kann nicht aus dem Wind gedreht werden.
- Geringere Wirtschaftlichkeit: Höhere Kosten pro erzeugter Kilowattstunde.
Technischer Vergleich: Kleinwindkraftanlage vertikal versus horizontal
Messungen unter realen Bedingungen zeigen: Horizontale Kleinwindanlagen erzielen bei gleicher Rotorfläche deutlich höhere Jahreserträge. Ihre aerodynamischen Vorteile führen zu einer effizienteren Energieumwandlung. Eine 5-kW-Mini-Windanlage mit einem Rotor von 4 Metern Durchmesser kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Je nach Standort können solche Anlagen jährlich 3.400 bis 4.900 Kilowattstunden Strom erzeugen.
Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 25,9 Cent pro Kilowattstunde entspricht dies einem Jahreswert von etwa 1.269 Euro – allerdings nur unter günstigen Windbedingungen.
Lohnt sich eine private Windkraftanlage fürs Eigenheim?
Wer hauptsächlich Stromkosten sparen und wirtschaftlich profitieren möchte, wird mit einer privaten Windkraftanlage in den meisten Fällen Schwierigkeiten haben. Als erster Schritt bietet sich immer die Installation einer Photovoltaikanlage an, da diese meistens wirtschaftlich sinnvoll ist.
Kleinwindanlagen leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, da sie im Gegensatz zu fossilen Energieträgern kein CO₂ ausstoßen. Allerdings sind sie verhältnismäßig teuer. Der Preis für ein Kilowatt Leistung bei Kleinwindkraftanlagen liegt im Durchschnitt bei etwa 5.000 Euro, variiert jedoch je nach Größe zwischen 3.000 und 10.000 Euro. Die hohen Investitionskosten machen eine wirtschaftliche Nutzung schwer kalkulierbar. Hinzu kommen Wartungs- und Instandhaltungskosten, die rund drei Prozent der Investitionssumme pro Jahr betragen.
Private Windkraftanlage kaufen: Beispielrechnung für private Windkraftanlagen
Die Wirtschaftlichkeit ergibt sich aus den Stromherstellungskosten – also den Kosten je produzierter Kilowattstunde (kWh). Private Windkraftanlagen erreichen meist eine Nennleistung von bis zu zehn Kilowatt. Die jährliche Stromproduktion hängt jedoch stark von der Windstärke und der Rotordimension ab.
Ein Beispiel: Eine Anlage mit fünf Kilowatt Nennleistung kann zwischen 2.500 und 10.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugen – abhängig vom Standort. In windschwachen Gebieten sinkt der Ertrag jedoch dramatisch, was die Rentabilität solcher Projekte in Frage stellt.
Private Windkraftanlagen kosten zwischen 2.000 Euro und über 30.000 Euro, abhängig von Größe und Leistung. Wartung, Instandhaltung und Versicherungen können erheblich variieren. Auch Windgeschwindigkeitsschwankungen, Subventionen und steuerliche Vorteile spielen eine Rolle, wurden hier jedoch nicht berücksichtigt.
Annahme: Gesamtkosten von 50.000 Euro bei einer Lebensdauer von 20 Jahren.
Stromproduktion: 200.000 kWh über 20 Jahre (entspricht 10.000 kWh pro Jahr).
Ergebnis: Die Stromherstellungskosten betragen 0,25 Euro pro kWh.
Private Windkraftanlagen können sich lohnen – aber nur unter optimalen Bedingungen und langfristiger Nutzung.
Einspeisevergütung für privaten Windstrom
In Deutschland können Betreiber privater Windkraftanlagen ihren überschüssigen Strom ins öffentliche Netz einspeisen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantiert dabei eine Vergütung von 8,03 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen bis zu 10 Kilowatt-Peak. Diese Vergütung entspricht der von kleinen Solaranlagen, wobei die Bedingungen regional variieren können. In den meisten Fällen ist es jedoch finanziell sinnvoller, den selbst erzeugten Strom vollständig für den Eigenbedarf zu nutzen.
Wann lohnen sich Kleinwindanlagen finanziell?
- Wenn der eigene Windstrom günstiger als der Strompreis des Energieversorgers ist.
- Wenn der selbst erzeugte Strom überwiegend selbst verbraucht und nicht ins Netz eingespeist wird.
Die Kosten des durch die private Windkraftanlage produzierten Stroms nennt man Stromgestehungskosten. Diese sollten idealerweise unter 30 Cent pro Kilowattstunde liegen, damit sie unter dem durchschnittlichen Haushaltsstrompreis bleiben. Mit einem privaten Windrad bis fünf Kilowatt Leistung lässt sich dies nur an sehr windstarken Standorten erreichen. Grundstücke im Wohngebiet bieten dieses Windpotenzial in der Regel nicht.
Das heißt: An den meisten Standorten wird der Strom aus einer Kleinwindanlage erheblich teurer sein als Netzstrom.
Die Motivation für die Anschaffung einer Windkraftanlage sollte daher vor allem in Umwelt- und Klimaschutzgründen, dem Interesse an Technik oder dem Wunsch nach mehr Unabhängigkeit liegen. In windarmen Wohngebieten bleibt die ökologische Sinnhaftigkeit jedoch zweifelhaft.
Eine mittlere private Anlage mit fünf Kilowatt amortisiert sich häufig erst nach 15 oder mehr Jahren. Ob und wann sich die Anschaffung lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
- Windstärke des Standorts: Bis zu 1000 Kilowattstunden Strom pro Jahr sind möglich.
- Regionale Stromkosten: Wie teuer ist der Haushaltsstrom vor Ort?
- Betriebs- und Wartungskosten: Was muss für Installation, Betrieb und Wartung bezahlt werden?
Private Windkraftanlage: Wirtschaftlichkeit für Gewerbebetriebe
Für Gewerbebetriebe mit höherem Strombedarf und Anlagen ab zehn Kilowatt Leistung können Kleinwindanlagen wirtschaftlich interessant sein - und Renditen ermöglichen.
Besondere Anforderungen an private Windkraftanlagen
Der wichtigste Erfolgsfaktor für private Windkraftanlagen ist natürlich die Windstärke am Standort. Ohne ausreichendes Windpotenzial sind weder Stromproduktion noch Ökobilanz zufriedenstellend. Private Windkraftanlagen sind deutlich standortkritischer als Solaranlagen. Während Solaranlagen nahezu überall Strom erzeugen, scheitern Windräder oft an unzureichender Windstärke. Standorte wie freie Flächen am westlichen Siedlungsrand, in Höhen- und Hanglagen oder an der Küste sind vielversprechend.
Private Windkraftanlagen allerdings stehen oft in Wohngebieten und müssen daher strenge Schallgrenzwerte einhalten. Ihre Höhe von meist nur zehn bis 15 Metern schränkt die Windausbeute erheblich ein, da in diesen Bereichen meist nur schwache Windverhältnisse herrschen. In bebauten Gebieten sind Hindernisse wie Häuser und Bäume zusätzliche Herausforderungen, weshalb eine gründliche Standortprüfung unabdingbar ist. Auch der Markt ist nicht ohne Risiken: Unseriöse Anbieter locken oft mit unrealistischen Leistungsversprechen.
An einem geeigneten Standort können kleine Windanlagen jedoch eine ideale Ergänzung zu Solaranlagen sein, vor allem in sonnenarmen Herbst- und Wintermonaten.
Wo lohnt sich eine private Windkraftanlage?
Die Wahl des Standorts ist entscheidend für den Erfolg privater Windkraftprojekte. Gute Bedingungen herrschen an Orten mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von mindestens fünf bis sechs Metern pro Sekunde. Regionen wie der Harz, der Schwarzwald oder die ländlichen Gebiete in Niedersachsen und Schleswig-Holstein bieten oft optimale Voraussetzungen.
Die Kleinwindanlage sollte idealerweise auf einem Mast im Garten in der Nähe des Gebäudes stehen. Die Installation auf Dächern von Einfamilienhäusern ist oft problematisch, vor allem wegen mangelnder Windverhältnisse. Eine Dachmontage könnte funktionieren, wenn eine Seite des Dachs frei angeströmt wird und der Mast eine ausreichende Höhe hat. Viele Privathäuser erfüllen diese Voraussetzungen jedoch nicht.
Neben der Windgeschwindigkeit sind auch Hindernisse wie Gebäude, Bäume oder Geländeformen sowie Extremwetterbedingungen zu berücksichtigen, die den Ertrag der Anlage schmälern können. Viele Hersteller bieten eine kostenpflichtige Standortanalyse an.
Sie finden für jedes Bundesland Deutschlands im Internet einen Energieatlas, der die Geschwindigkeit des Windes in verschiedenen Höhen angibt. Auch auf der Windkarte des Deutschen Wetterdiensts können Sie grob einschätzen, ob Ihre Region starke Winde zu verzeichnen hat. Für genauere Daten installieren manche Bauherren in der Zielhöhe ein Windmessgerät und messen über einen längeren Zeitraum, um so einen Mittelwert zu ermitteln. Dies kann durch selbstständige Windmessgeräte ab 250 Euro oder spezialisierte Dienstleister ab 700 Euro erfolgen.
Vorsicht bei Mini-Windkraftanlagen: Balkone meist ungeeignet
Diese sind grundsätzlich nicht zu empfehlen. Die Windverhältnisse auf Balkonen sind meist ungeeignet, da der Wind durch die Gebäudewand verwirbelt wird. Diese Turbulenzen kann der Rotor nicht effektiv nutzen. Außerdem besteht ein Sicherheitsrisiko durch den schnell drehenden Rotor, wenn dieser in Reichweite ist.
Wer ernsthaft Ökostrom produzieren möchte, sollte auf einen bodenständigen Mast setzen. Eine auf dem Boden montierte Kleinwindanlage bietet nicht nur bessere Windverhältnisse, sondern ist auch sicherer und effizienter.
Private Windkraftanlage: Unübersichtlicher Markt mit Qualitätsproblemen
Der Kleinwind-Markt ist schwer zu überblicken. Weltweit gibt es über 300 Hersteller und mehr als 1.000 verschiedene Modelle. Dabei bieten einige Unternehmen qualitativ hochwertige Windanlagen an, die ihre Funktionalität in unabhängigen Tests unter Beweis gestellt haben. Jedoch bemängeln Experten seit Jahren ein Qualitätsproblem in der Branche. Viele Windradmodelle sind nicht empfehlenswert. Käufer sollten daher auf unabhängige Prüfungen, Zertifizierungen und Langzeiterfahrungen achten, um Enttäuschungen zu vermeiden. Ein Problem in der Kleinwindkraftbranche ist das Auftreten unseriöser Anbieter mit mangelhafter Technik und irreführenden Versprechen. Typische Warnzeichen in der Werbung sind:
- Behauptungen von „Weltneuheiten“ und „einzigartigen Innovationen“
- Unrealistische Ertrags- und Renditeversprechen ohne Standortprüfung
Es empfiehlt sich, Herstellerangaben kritisch zu hinterfragen. Seriöse Anbieter können unabhängige Nachweise für die Funktionalität ihrer Anlagen vorweisen, beispielsweise:
- Offizielle Zertifizierung nach IEC 61400-2
- Dokumentierte Tests von Prüfinstituten
- Positive Langzeiterfahrungen neutraler Betreiber
Reine Windkanaltests oder Computersimulationen sind unzureichend.
Weitere und detaillierte Informationen finden Sie auch auf klein-windkraftanlagen.com oder anderen vergleichbaren Seiten.
Verbraucherzentrale NRW: Kritik an Kleinwindkraftanlagen
Die Verbraucherzentrale NRW äußert sich kritisch zu der Frage, ob sich Kleinwindanlagen für Privatbetreiber lohnen: „Wir meinen eher nein. Die Erträge der Windkraftanlagen sind sehr klein und hängen extrem stark vom Standort ab. Die Qualität dieser Anlagen ist nicht immer so ausgereift wie bei Solaranlagen, allein schon deshalb, weil nur geringe Stückzahlen produziert werden. Obendrein droht noch Ärger mit Nachbar:innen durch Vibrationen und Geräusche. Von einem wirtschaftlichen Betrieb kann keine Rede sein.“
Kleinwindkraftanlagen: Kosten-Beispielrechnung zeigt geringe Erträge
Die Verbraucherzentrale stellt folgende Beispielrechnung für eine typische Dachanlage an:
- Rotordurchmesser: 1,0 Meter
- Rotorfläche: 0,8 m²
- Stromerzeugung: 96 kWh pro Jahr
- Wert des Stroms: 33 Euro pro Jahr (bei vollständigem Eigenverbrauch)
Selbst bei einem doppelten Rotordurchmesser vervierfacht sich der Ertrag lediglich. Das bedeutet, dass Kleinwindanlagen im besten Fall einen kleinen zweistelligen Betrag an Stromwert erzeugen – bei schlechtem Standort eher weniger.
Solarstromanlagen sind laut Verbraucherzentrale in den meisten Fällen effizienter und zuverlässiger als Kleinwindkraftanlagen mit vergleichbarer Fläche.
Qualitätsmerkmale für Kleinwindkraftanlagen
Anders als in der Photovoltaikbranche, wo kontinuierlich an Wirkungsgrad und Langlebigkeit gearbeitet wird, ist dies bei Kleinwindkraftanlagen aufgrund des kleinen Marktes kaum zu erwarten. Die Lebensdauer solcher Anlagen ist ungewiss und liegt deutlich unter den 20 Jahren, die bei Solarmodulen üblich sind.
Interessierte sollten folgende Fragen stellen, bevor sie eine Anlage kaufen:
- Besichtigungsmöglichkeiten: Wo gibt es eine Anlage, die seit mehreren Jahren zuverlässig läuft?
- Sturmsicherheit: Ist die Anlage sturmsicher konstruiert?
- Lautstärke: Arbeitet die Anlage leise?
- Lebensdauer: Gibt es verlässliche Angaben zur Lebensdauer? Die Langlebigkeit einer Windkraftanlage ist von entscheidender Bedeutung für die Wirtschaftlichkeit.
- Zertifikate: Liegen Prüfzertifikate vor? Eine Konformitätserklärung gilt als wichtiger als eine CE-Kennzeichnung, da sie vom Hersteller garantierte Qualitäts- und Sicherheitsstandards bestätigt.
- Eignung: Ist die Anlage für die Netzeinspeisung zugelassen oder nur für den Campingbereich gedacht?
Unabhängige Informationsquellen wie die Seite klein-windkraftanlagen.com bieten weitere Orientierung, auch zu größeren Anlagen.
Für Wohngebäude kaum geeignet
Kleinwindkraftanlagen funktionieren unter idealen Standortbedingungen oder in speziellen Bereichen wie auf Booten oder entlegenen Hütten oft zuverlässig. Für Wohngebäude – sei es im Garten oder auf dem Dach – sind sie jedoch in der Regel weder wirtschaftlich noch sinnvoll.
Anmeldung, Versicherung und Genehmigung von Kleinwindkraftanlagen
Kleinwindkraftanlagen müssen sowohl beim Stromnetzbetreiber als auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet werden. Zudem empfiehlt es sich, die Gebäude- und Haftpflichtversicherung zu informieren, um sicherzustellen, dass mögliche Schäden durch die Anlage abgedeckt sind. Um überschüssige Energie ins Netz einzuspeisen oder Strom zu beziehen, wenn die Anlage nicht genug erzeugt, ist ein Zugang zum Stromnetz erforderlich. Vor der Inbetriebnahme muss meist eine behördliche Genehmigung vorliegen. Der Netzanschluss erfolgt durch eine Vereinbarung mit dem örtlichen Netzbetreiber. In den meisten Fällen ist ein Wechselrichter notwendig, um den erzeugten Gleichstrom in netzfähigen Wechselstrom umzuwandeln. In den meisten Bundesländern benötigen Kleinwindkraftanlagen mit einer Höhe unter zehn Metern keine Baugenehmigung. Dennoch müssen Abstands- und Lärmschutzvorschriften eingehalten werden. Da die Bauvorschriften Ländersache sind, lohnt sich ein Blick auf die Informationen des Bundesverbands Kleinwindanlagen.
Mikrowindanlagen für mobile Anwendungen
Kleinwindkraftanlagen mit einer Leistung unter einem Kilowatt eignen sich ideal für Wohnmobile und Segelschiffe:
- Segelschiffe: Profitieren von konstanten Windverhältnissen, wodurch die Energieversorgung optimal ergänzt wird.
- Wohnmobile: Wegen der Körperschallübertragung ist eine Dachmontage ungeeignet. Stattdessen sollte ein abgespannter Mast genutzt werden, was jedoch nur bei längeren Standzeiten praktikabel ist.
Kombination mit Photovoltaik
Experten empfehlen, zuerst eine Photovoltaikanlage zu installieren und diese bei Bedarf durch eine Kleinwindanlage zu ergänzen. An windstarken Standorten bietet die Kombination eine sinnvolle Strategie zur Eigenversorgung.
Förderung und Zukunft privater Windkraftanlagen in Deutschland
Privathaushalte können für den Bau von Windkraftanlagen verschiedene Förderungen beantragen:
- KfW-Förderung: Im Rahmen des Programms „Erneuerbare Energien – Standard (270)“ vergibt die Kreditanstalt für Wiederaufbau zinsgünstige Kredite für private Windkraftprojekte. Die Finanzierung kann bis zu 100 Prozent der Investitionskosten umfassen, wenn ein Teil der produzierten Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird.
- Förderungen durch das Bundesministerium für Landwirtschaft: Unterstützt die Planung und Errichtung privater Anlagen.
- Regionale Förderungen: In Nordrhein-Westfalen werden beispielsweise Standortanalysen bezuschusst. Auch Stadtwerke und Energieversorger bieten gelegentlich Förderprogramme an.
Private Windkraftanlage: Zukunftsperspektiven
Die Entwicklung privater Windkraftanlagen in Deutschland hängt von mehreren Faktoren ab:
- Technologische Weiterentwicklung: Fortschritte könnten zu effizienteren Anlagen führen.
- Regulatorische Rahmenbedingungen: Vereinfachte Genehmigungsverfahren könnten die Verbreitung fördern.
- Wirtschaftlichkeit: Experten erwarten, dass steigende Produktionszahlen die Preise langfristig senken könnten.
Sollten Sie eine private Windkraftanlage kaufen? Fazit
Vorteile
- Klimaschutz: Erneuerbare Energieerzeugung reduziert den CO₂-Ausstoß und fördert den grünen Stromanteil im Eigenheim.
- Energiekosteneinsparungen: Bei ausreichender Energieproduktion sinken die Stromkosten, möglicherweise sind sogar Einspeiseerlöse möglich.
- Förderprogramme: Finanzielle Unterstützung erleichtert die Investition.
Nachteile
- Hohe Anfangsinvestitionen: Die Kosten amortisieren sich häufig erst nach vielen Jahren.
- Windabhängigkeit: Schwankungen im Windaufkommen beeinträchtigen die Stromproduktion.
- Lärmbelästigung und Ästhetik: Geräusche und optische Beeinträchtigungen können problematisch sein.
Unterm Strich: Private Windkraftanlagen leisten zwar einen Beitrag zum Klimaschutz, jedoch ist ihre Wirtschaftlichkeit schwer vorherzusagen. Für die meisten Hausbesitzer bieten sie vor allem dann Vorteile, wenn der Strom für den Eigenverbrauch genutzt. In der Regel aber lohnt es sich nicht, außer man hat Freude an sowas oder den perfekten Standort.